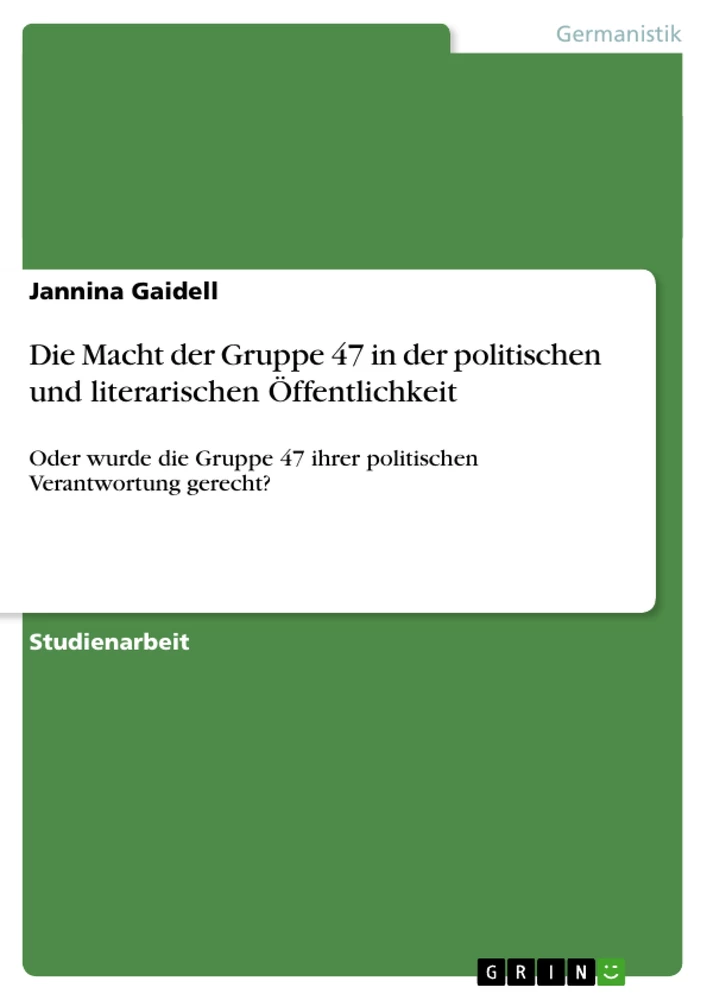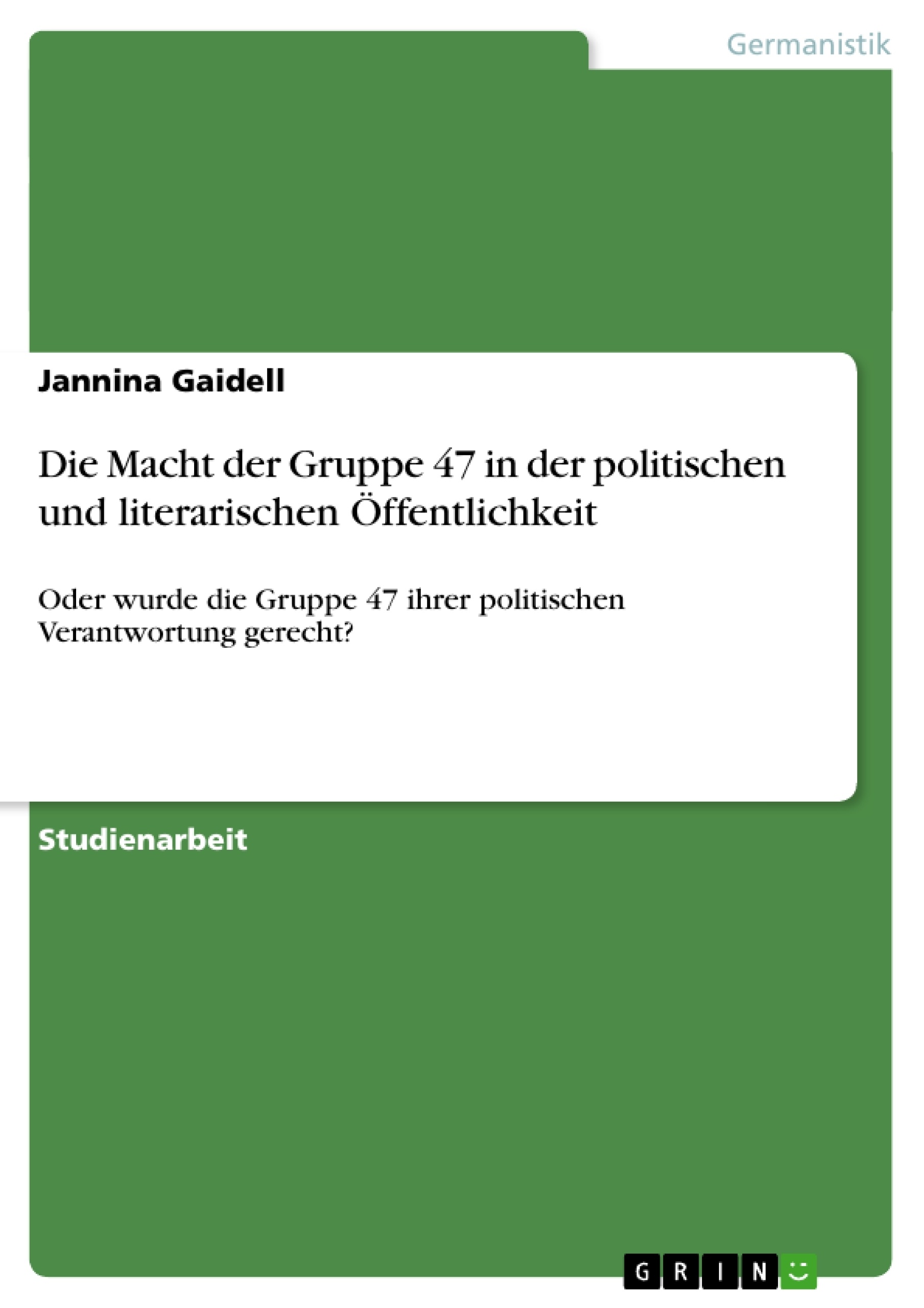Einleitung Seit dem Bestehen der modernen menschlichen Zivilisation ist es die Aufgabe der Intellektuellen gewesen, Verantwortung für die Gesellschaft und ihre Moral zu tragen. Sie sind dazu berufen, Werte und Wahrheiten hochzuhalten oder neu zu installieren, wenn diese verloren gehen, auf Veränderungen und Problematiken vorzubereiten und entsprechend Lösungen zu suchen. Die politische Meinungsbildung der Bürger bedarf einer Richtungsgebung, genauso wie die Politik auf die Legitimation durch Intellektuelle angewiesen bleibt Im Folgenden möchte sich meine Ausarbeitung damit beschäftigen, inwieweit eine bestimmte Gruppe Intellektueller, nämlich die Gruppe 47, ihrer politischen Verantwortung für die Weisung und Unterstützung der Bevölkerung im Deutschland des Wiederaufbaus gerecht wurde. Der erste Teil meiner Arbeit untersucht zunächst die Ausgangssituation und den politischen Ansatz der Gruppe 47, und versucht dann, unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, zu erläutern, wie aus einer politischen eine literarische Gruppe werden konnte und worin sie ihre politische Aufgabenstellung sah. Im zweiten Teil befasse ich mich zum einen mit den Reaktionen des deutschen Publikums auf die Vorgehensweise und Haltung der Gruppe, und erörtere ob, und in wieweit, sie ihre politische Verantwortung wahrnahm. Mein Interesse liegt hierbei an einer möglichst umfassenden Darstellung des Themas, weshalb sowohl Mitglieder als auch Kritiker der Gruppe zu Wort kommen. Der politische Ansatz Eigentlich begann alles mit der Arbeit einiger Schriftsteller an der Zeitschrift „der Ruf“ unter der Leitung von Hans Werner Richter und Alfred Andersch. Es handelte sich hierbei um die Idee eines „politisch-intellektuellen, eingreifenden Organs der „Jungen Generation““ , die den Anspruch erhob, den demokratisch- sozialistischen Neubeginn Deutschlands, politisch und literarisch mitzugestalten. Sie sahen sich der Aufgabe gewachsen, den Zeitgeist zu gestalten und die politische Meinungsbildung der Bürger in die richtige Richtung zu lenken. Dabei sah die BRD sich mit den Konsequenzen ihrer Vergangenheit konfrontiert, denn es galt die Verantwortung für das dritte Reich zu tragen, und dennoch als deutscher Teilstaat, der nicht an seine historischen Wurzeln vor `33 anknüpfen konnte, ein neues Selbstverständnis zu entwickeln. Ihre Legitimation sah die „Junge Generation“ in den bitteren Erfahrungen mit Faschismus und Krieg, die nach ihrer Aussage ihr Wirklichkeitsbewusstsein in dem Maße geprägt hatten, dass sie gegen falsche historische Versprechen immun sei. Ihrer kritischen und wachsamen Haltung gemäß, bezeichneten sie sich selbst als „nüchterne Generation“. Ferner begründete sie ihr Recht auf Mitgestaltung der BRD dadurch, dass sie, als „verratene Generation“, nicht durch ein Mitwirken am Faschismus beteiligt gewesen sei, sondern im Gegenteil einen von den Vätern „geopferte Generation“ sein.
Sprachrodung Die „Junge Generation“ erkannt das Faschismus- Erbe früh als ein Sprachproblem an, dass es zu bereinigen galt- sie stellten sich zur Aufgabe, das gesellschaftliche Bewusstsein zu entrümpeln, sich der schönschreiberischen Elemente zu entledigen und so zu einer neuen politischen und literarischen Sprache zu gelangen. Sie machten sich die Methode der Bestandsaufnahme zu eigen, und wollten die Wahrheit verbreiten- beides um den Preis der verklärenden Poesie
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der politische Ansatz
- Sprachrodung
- Konflikt mit den Ordnungshütern
- Vom Ruf zur Gruppe 47 - eine Übergangslösung?
- Selbstdarstellung der Gruppe 47
- Politischer Wandel zur Literatur
- Von der politischen Publizistik zur literarischen Werkstatt
- Das Publikum der Nachkriegszeit
- „Falscher Kompromiss?“
- Eskapismus?
- Psychologische Ansätze als Begründung für die Politikflucht
- Exkurs in die Politik
- Erreichte die Gruppe ihr Ziel?
- Gruppe 47 = Gruppe 47 1962?
- Das Aus
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht, inwieweit die Gruppe 47 ihrer politischen Verantwortung im Nachkriegsdeutschland gerecht wurde. Sie analysiert den Übergang der Gruppe von einer politisch-publizistischen zu einer literarischen Formation und untersucht die Reaktionen des Publikums auf deren Vorgehensweise und Haltung.
- Der politische Ansatz der Gruppe 47 und ihre anfänglichen Ziele
- Der Konflikt der Gruppe 47 mit den Besatzungsbehörden und die Folgen
- Die Transformation der Gruppe 47 von einer politischen zu einer literarischen Bewegung
- Die Rezeption der Gruppe 47 durch das deutsche Publikum
- Die Frage nach dem Erfolg der Gruppe 47 in Bezug auf ihre politischen Ziele
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert die historische Verantwortung von Intellektuellen für die Gesellschaft und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Erfüllung der politischen Verantwortung der Gruppe 47 im Wiederaufbau Deutschlands. Sie umreißt den Aufbau der Arbeit, der die Ausgangssituation und den politischen Ansatz der Gruppe untersucht, sowie die Reaktionen des Publikums auf deren Handeln.
Der politische Ansatz: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung der Gruppe 47 aus der Zeitschrift „Der Ruf“. Es schildert die anfänglichen politischen Ziele der „Jungen Generation“, die eine Mitgestaltung des demokratisch-sozialistischen Neubeginns Deutschlands anstrebte. Die Gruppe sah sich in der Verantwortung, den Zeitgeist zu prägen und die politische Meinungsbildung zu beeinflussen, basierend auf den Erfahrungen mit Faschismus und Krieg. Ihre Legitimation gründete sich auf dem Anspruch, als „nüchterne Generation“ und „verratene Generation“ frei von Mitverantwortung am Nationalsozialismus zu sein.
Sprachrodung: Dieses Kapitel beleuchtet das Bemühen der Gruppe 47 um eine neue, von nationalsozialistischen Elementen befreite Sprache. Die Gruppe versuchte, das gesellschaftliche Bewusstsein durch eine ehrliche Bestandsaufnahme und die Verbreitung der Wahrheit zu verändern – auch auf Kosten verklärender Poesie. Der Lizenzentzug für „Der Ruf“ im April 1947 markierte einen entscheidenden Wendepunkt und beendete abrupt den optimistischen politischen Aktivismus der Gruppe.
Konflikt mit den Ordnungshütern: Dieses Kapitel beschreibt den Konflikt zwischen der Gruppe 47 und den Besatzungsbehörden. Die Besatzungsmacht sah in dem politischen Aufbegehren der Gruppe eine Bedrohung ihres „Re-education“-Programms, welches eine unpolitische und unpolemische Entnazifizierung anstrebte. Die kritische Berichterstattung der Gruppe über den deutschen Widerstand und die Überlegungen zu einer Vermittlerrolle Deutschlands zwischen den Alliierten führten zu offener Pressezensur und letztendlich zum Verbot von „Der Ruf“ aufgrund von angeblichen „nihilistischen Tendenzen“.
Vom Ruf zur Gruppe 47 - eine Übergangslösung?: Dieses Kapitel analysiert den Übergang von „Der Ruf“ zur Gruppe 47 nach dem Verbot der Zeitschrift. Der Verlust der Publikationsmöglichkeit zwang die Gruppe zu einer Neuorientierung. Die Chancen, eine neue politische Zeitung zu gründen, waren gering, was den Übergang zu einer literarischen Gruppe begünstigte. Die Entscheidung für diese neue Form des politischen Engagements wird als Übergangslösung unter den gegebenen Umständen interpretiert.
Schlüsselwörter
Gruppe 47, Politische Verantwortung, Nachkriegsdeutschland, Literatur, Publizistik, Besatzungsmacht, „Der Ruf“, Re-education, Zeitgeist, politische Meinungsbildung, Demokratie, Nationalsozialismus, Widerstand.
Gruppe 47: Politische Verantwortung im Nachkriegsdeutschland - FAQ
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht, inwieweit die Gruppe 47 ihrer politischen Verantwortung im Nachkriegsdeutschland gerecht wurde. Sie analysiert den Wandel der Gruppe von einer politisch-publizistischen zu einer literarischen Formation und die Reaktionen des Publikums.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den politischen Ansatz der Gruppe 47, ihren Konflikt mit den Besatzungsbehörden, ihre Transformation von einer politischen zu einer literarischen Bewegung, die Rezeption durch das deutsche Publikum und die Frage nach ihrem Erfolg bezüglich ihrer politischen Ziele. Spezifische Kapitel befassen sich mit der Entstehung aus "Der Ruf", der Sprachfindung, dem Eskapismusvorwurf und der Entwicklung bis zur Auflösung der Gruppe.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit enthält Kapitel zu Einleitung, dem politischen Ansatz, der Sprachfindung, dem Konflikt mit den Ordnungshütern, dem Übergang von "Der Ruf" zur Gruppe 47, der Selbstdarstellung der Gruppe 47, dem politischen Wandel zur Literatur, dem Publikum der Nachkriegszeit, "Falschem Kompromiss?", Eskapismus, psychologischen Ansätzen, einem Exkurs in die Politik, der Zielerreichung, der Gruppe 47 im Jahr 1962 und dem Schluss.
Wie beschreibt die Arbeit den politischen Ansatz der Gruppe 47?
Die Arbeit beschreibt die Entstehung der Gruppe aus der Zeitschrift "Der Ruf" und deren anfängliche Ziele, die Mitgestaltung des demokratisch-sozialistischen Neubeginns Deutschlands. Die Gruppe sah sich in der Verantwortung, den Zeitgeist zu prägen und die politische Meinungsbildung zu beeinflussen, basierend auf den Erfahrungen mit Faschismus und Krieg. Sie beanspruchte eine Legitimation als "nüchterne Generation", frei von Mitverantwortung am Nationalsozialismus.
Welchen Konflikt hatte die Gruppe 47 mit den Besatzungsbehörden?
Die Besatzungsmacht sah in dem politischen Aufbegehren der Gruppe eine Bedrohung ihres "Re-education"-Programms. Die kritische Berichterstattung der Gruppe über den deutschen Widerstand und Überlegungen zu einer Vermittlerrolle Deutschlands zwischen den Alliierten führten zu offener Pressezensur und dem Verbot von "Der Ruf" wegen angeblicher "nihilistischer Tendenzen".
Wie erklärt die Arbeit den Übergang von "Der Ruf" zur Gruppe 47?
Der Verlust der Publikationsmöglichkeit durch das Verbot von "Der Ruf" zwang die Gruppe zu einer Neuorientierung. Da die Gründung einer neuen politischen Zeitung schwierig war, begünstigte dies den Übergang zu einer literarischen Gruppe. Diese Entscheidung wird als Übergangslösung unter den gegebenen Umständen interpretiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gruppe 47, Politische Verantwortung, Nachkriegsdeutschland, Literatur, Publizistik, Besatzungsmacht, „Der Ruf“, Re-education, Zeitgeist, politische Meinungsbildung, Demokratie, Nationalsozialismus, Widerstand.
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage ist, inwieweit die Gruppe 47 ihrer politischen Verantwortung im Wiederaufbau Deutschlands gerecht wurde.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Gruppe 47 und ihre Auseinandersetzung mit ihrer politischen Verantwortung im Nachkriegsdeutschland. Die detaillierten Schlussfolgerungen sind im Kapitel "Schluss" der Arbeit zu finden.
- Arbeit zitieren
- Jannina Gaidell (Autor:in), 2004, Die Macht der Gruppe 47 in der politischen und literarischen Öffentlichkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90416