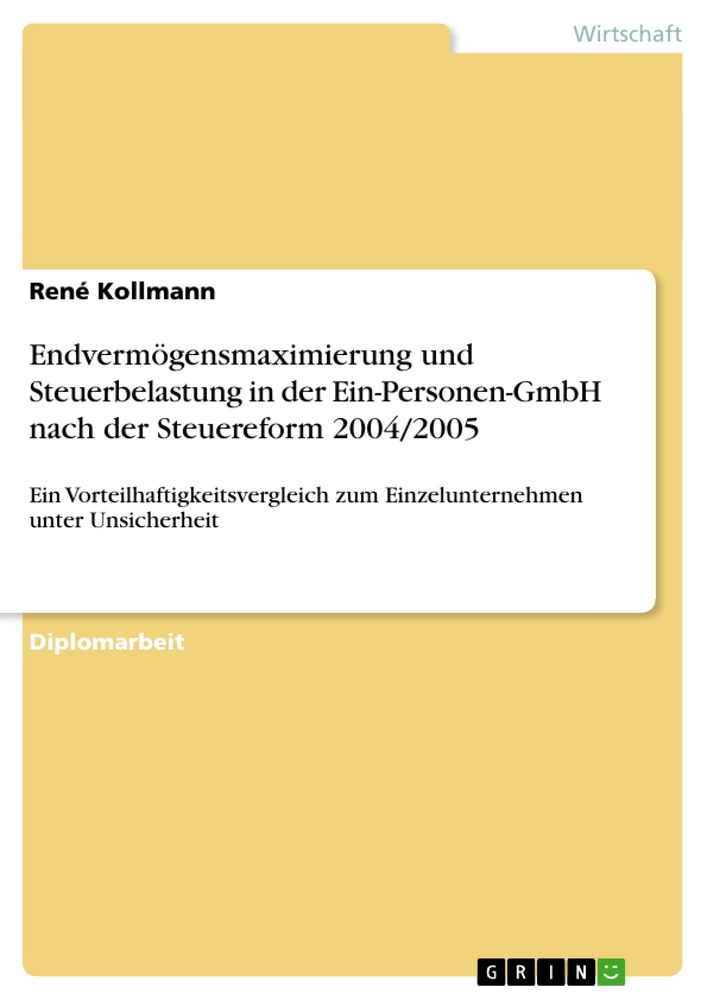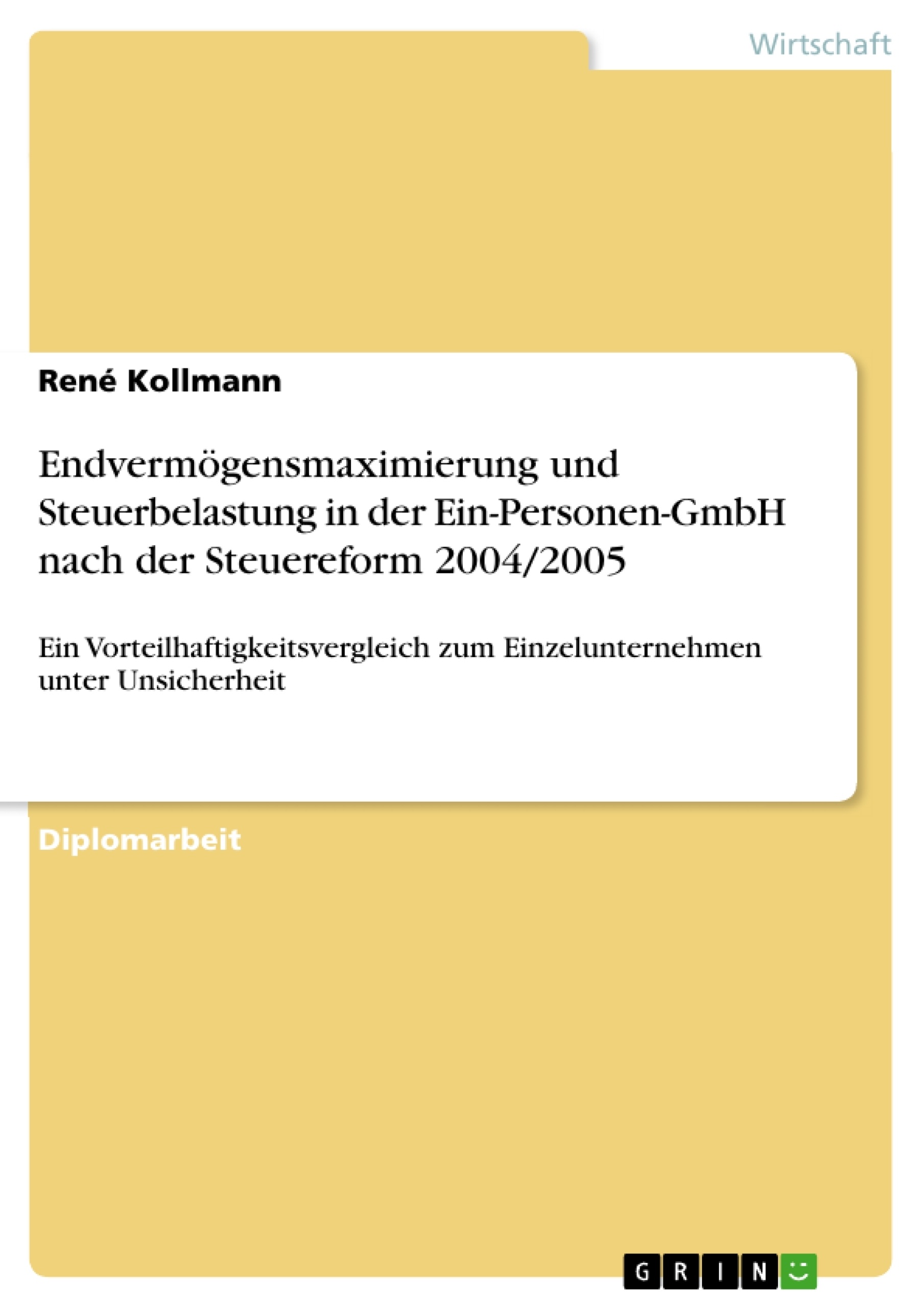In der deutschsprachigen Literatur wurden bisher überwiegend rein steuerrechtlich geprägte, einperiodische Rechtsformvergleiche publiziert, die nur einen groben Überblick über die Vorteilhaftigkeit von GmbH oder Einzelunternehmen nach der Steuerreform bieten. Je nach Betrachtungsweise und Prämissen wurden hier bereits die unterschiedlichsten Lösungen veranschaulicht. Mehrperiodische Vergleichsrechnungen wurden nur ausnahmsweise angestellt (anhand des European Tax Analyzers – ein Computersimulationsprogramm). Häufig findet man Publikationen über den Einfluss der Körperschaftsteuersenkung auf die Höhe von GmbH-Geschäftsführerbezügen mit durchwegs brauchbaren Entscheidungshilfen. Auch in diesen Berechnungen wurde meist von (verhältnismäßig) hohen und sicheren Gewinnerwartungen ausgegangen. Untersuchungen zur Vorteilhaftigkeit von Rechtsformen über mehrere Perioden mit unsicheren Gewinnerwartungen liegen bislang noch nicht vor.
Für die Wahl der optimalen Rechtsform sind eine Reihe verschiedener Entscheidungskriterien maßgeblich. Diese können quantifizierbar (z.B. die Steuerbelastung) oder nicht quantifizierbar (z.B. risikopolitische Überlegungen) sein. Mitunter vorentscheidend sind die Unternehmensgröße und die Art der Unternehmenstätigkeit. Vor allem bei Klein- und Mittelbetrieben spielt – neben dem risikopolitischen Aspekt – die Steuerbelastung trotz zahlreicher außersteuerlicher Bestimmungsfaktoren oft eine dominante Rolle.
Im vorliegenden Beitrag werden nun folgende quantitative Vergleiche zwischen einer GmbH und einem Einzelunternehmen angestellt:
• Thesaurierende GmbH vs. Einzelunternehmen mit Inanspruchnahme der begünstigten Besteuerung nicht entnommener Gewinne gem. § 11a EStG
• Ausschüttende GmbH vs. Einzelunternehmen bei Entnahme der Gewinne
Das Hauptaugenmerk wird hierbei auf die Endvermögen bzw. Konsummöglichkeiten gelegt. Als Nebenbedingungen werden auch die Steuer- und Gesamtabgabenbelastungen der Varianten dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Steuerliche Änderungen
- 1.2 Literatur
- 1.3 Problemstellung
- 2 Modellstruktur
- 2.1 Modellannahmen
- 2.1.1 Allgemeine Annahmen
- 2.1.1.1 Endvermögensmaximierung
- 2.1.1.2 Konsummaximierung
- 2.1.2 Steuerliche Grundlagen und Annahmen
- 2.1.2.1 Rechtsformspezifika der Ein-Personen-GmbH
- 2.1.2.2 Rechtsformspezifika des Einzelunternehmers
- 2.2 Beurteilung der Vorteilhaftigkeit
- 2.2.1 Endvermögensmaximierung als Kriterium
- 2.2.2 Konsummaximierung als Alternative
- 3 Modellierung der Renditen
- 3.1 Erwartungswert der Rendite
- 3.2 Markov-Prozess, Wiener Prozess und Prozess für Aktienkurse
- 3.3 Monte-Carlo-Simulation
- 4 Umsetzung der Simulation
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Simulationsergebnisse Endvermögensmaximierung
- 5.1.1 Entscheidung ohne Einfluss von Steuern
- 5.1.2 Entscheidung mit Steuereinfluss
- 5.1.3 Zusätzliche Ergebnisse bei Veränderung der Parameter
- 5.2 Simulationsergebnisse Konsummaximierung
- 5.2.1 Entscheidung ohne Einfluss von Steuern
- 5.2.2 Entscheidung mit Steuereinfluss
- 5.2.3 Zusätzliche Ergebnisse bei Veränderung der Parameter
- 5.3 Abgeleitete Ergebnisse
- 5.3.1 Gesamtbarwert der Investition und Performance der Investition
- 5.3.2 Gegenüberstellung aller Varianten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit vergleicht die Vorteilhaftigkeit einer Ein-Personen-GmbH und eines Einzelunternehmens nach der Steuerreform 2004/2005 unter Unsicherheit. Ziel ist es, quantitative Vergleiche hinsichtlich Endvermögensmaximierung und Konsummaximierung unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte und mehrperiodischer Renditenentwicklungen mittels Monte-Carlo-Simulation durchzuführen.
- Vergleich der Steuerbelastung von Ein-Personen-GmbH und Einzelunternehmen
- Analyse der Endvermögensmaximierung als Entscheidungskriterium
- Bewertung der Konsummaximierung als alternatives Entscheidungskriterium
- Anwendung der Monte-Carlo-Simulation zur Modellierung von Unsicherheit
- Einfluss verschiedener Parameter auf die Vorteilhaftigkeit der Rechtsformen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Rechtsformwahl zwischen Ein-Personen-GmbH und Einzelunternehmen ein. Es beschreibt die steuerlichen Änderungen durch die Steuerreformen 2004/2005, beleuchtet den aktuellen Stand der Literatur und formuliert die Problemstellung der Arbeit, die darin besteht, einen mehrperiodischen Vergleich unter Unsicherheit durchzuführen, indem sowohl Endvermögensmaximierung als auch Konsummaximierung als Zielgrößen betrachtet werden. Der Fokus liegt auf quantitativen Vergleichen thesaurierender und ausschüttender Varianten beider Rechtsformen.
2 Modellstruktur: Dieses Kapitel beschreibt die Modellstruktur, die für den Vergleich von Ein-Personen-GmbH und Einzelunternehmen verwendet wird. Es definiert detailliert die Modellannahmen, sowohl die allgemeinen Annahmen zum Investor und dem Unternehmen als auch die steuerlichen Grundlagen und Annahmen für beide Rechtsformen. Es werden Formeln zur Berechnung des Cashflows, der Investitionen, der Steuerbelastungen und des Endvermögens präsentiert. Die Kapitel behandelt sowohl die Endvermögensmaximierung als auch die Konsummaximierung als Zielfunktionen und erläutert die Vorgehensweise zur Bewertung der Vorteilhaftigkeit beider Rechtsformen.
3 Modellierung der Renditen: Dieses Kapitel erläutert die Modellierung der Renditen, die für die Simulation der Unternehmensentwicklung verwendet werden. Es beschreibt den Erwartungswert der Rendite, den Markov-Prozess, den Wiener-Prozess und das Modell für das Verhalten von Aktienkursen. Das Kapitel legt die Grundlage für die Monte-Carlo-Simulation, indem es die mathematischen Modelle für die Renditeermittlung präzisiert.
4 Umsetzung der Simulation: Dieses Kapitel beschreibt die Implementierung der Monte-Carlo-Simulation in VBA (Visual Basic for Applications) innerhalb einer Excel-Umgebung. Es erklärt die Struktur des Excel-Arbeitsblattes, die Deklaration der Variablen, die Verwendung von Schleifen (Do...Loop) zur Simulation mehrerer Perioden und Runden und die Integration der simulierten Renditen in die Berechnungen der Zielgrößen. Das Kapitel detailliert den Programmablauf und die Methodik der Simulation.
5 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Simulationen. Es analysiert die Ergebnisse sowohl für die Endvermögensmaximierung als auch die Konsummaximierung, sowohl mit als auch ohne Berücksichtigung von Steuern. Es untersucht den Einfluss verschiedener Parameter (außerbetriebliche Einkünfte, Geschäftsführerbezug, Risiko) auf die Ergebnisse und bietet eine detaillierte Interpretation der Simulationsergebnisse unter Verwendung von Diagrammen und Tabellen.
Schlüsselwörter
Endvermögensmaximierung, Konsummaximierung, Steuerreform 2004/2005, Ein-Personen-GmbH, Einzelunternehmen, Monte-Carlo-Simulation, Unsicherheit, Steuerbelastung, Rechtsformwahl, Kapitalwertmethode, § 11a EStG, Körperschaftsteuer, Einkommensteuer, Kapitalertragsteuer.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Vergleich Ein-Personen-GmbH und Einzelunternehmen nach der Steuerreform 2004/2005
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit vergleicht die Vorteilhaftigkeit einer Ein-Personen-GmbH und eines Einzelunternehmens nach der Steuerreform 2004/2005 unter Unsicherheit. Der Fokus liegt auf quantitativen Vergleichen unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte und mehrperiodischer Renditenentwicklungen mittels Monte-Carlo-Simulation.
Welche Zielsetzungen werden verfolgt?
Die Arbeit zielt darauf ab, quantitative Vergleiche hinsichtlich Endvermögensmaximierung und Konsummaximierung unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte durchzuführen. Es werden der Einfluss verschiedener Parameter auf die Vorteilhaftigkeit der Rechtsformen untersucht und die Monte-Carlo-Simulation zur Modellierung von Unsicherheit angewendet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Vergleich der Steuerbelastung beider Rechtsformen, die Analyse der Endvermögensmaximierung als Entscheidungskriterium, die Bewertung der Konsummaximierung als Alternative, die Anwendung der Monte-Carlo-Simulation und den Einfluss verschiedener Parameter (z.B. außerbetriebliche Einkünfte, Geschäftsführerbezug, Risiko) auf die Ergebnisse.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (mit Beschreibung der steuerlichen Änderungen und Problemstellung), Modellstruktur (mit Modellannahmen und Beurteilung der Vorteilhaftigkeit), Modellierung der Renditen (mit Erwartungswert, Markov- und Wiener-Prozess), Umsetzung der Simulation (Beschreibung der VBA-Implementierung in Excel) und Ergebnisse (Analyse der Simulationsergebnisse für Endvermögens- und Konsummaximierung mit und ohne Steuereinfluss).
Welche Modellannahmen werden getroffen?
Das Modell beinhaltet allgemeine Annahmen zum Investor und Unternehmen (z.B. Endvermögensmaximierung, Konsummaximierung) sowie steuerliche Grundlagen und Annahmen für beide Rechtsformen (Ein-Personen-GmbH und Einzelunternehmen). Es werden Formeln zur Berechnung des Cashflows, der Investitionen, der Steuerbelastungen und des Endvermögens verwendet.
Welche Simulationsmethode wird verwendet?
Die Arbeit verwendet die Monte-Carlo-Simulation zur Modellierung der Unsicherheit in der Renditenentwicklung. Der Erwartungswert der Rendite, der Markov-Prozess, der Wiener-Prozess und ein Modell für das Verhalten von Aktienkursen werden beschrieben und in die Simulation integriert.
Wie werden die Ergebnisse präsentiert?
Die Ergebnisse der Simulationen werden für sowohl Endvermögensmaximierung als auch Konsummaximierung, mit und ohne Berücksichtigung von Steuern, präsentiert. Der Einfluss verschiedener Parameter wird untersucht und die Ergebnisse werden mittels Diagrammen und Tabellen detailliert interpretiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Endvermögensmaximierung, Konsummaximierung, Steuerreform 2004/2005, Ein-Personen-GmbH, Einzelunternehmen, Monte-Carlo-Simulation, Unsicherheit, Steuerbelastung, Rechtsformwahl, Kapitalwertmethode, § 11a EStG, Körperschaftsteuer, Einkommensteuer, Kapitalertragsteuer.
Welche Software wurde verwendet?
Die Monte-Carlo-Simulation wurde in VBA (Visual Basic for Applications) innerhalb einer Excel-Umgebung implementiert.
Welche Zielgrößen werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet sowohl die Endvermögensmaximierung als auch die Konsummaximierung als Zielgrößen für den Vergleich der beiden Rechtsformen.
- Citation du texte
- Mag. René Kollmann (Auteur), 2006, Endvermögensmaximierung und Steuerbelastung in der Ein-Personen-GmbH nach der Steuereform 2004/2005, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90423