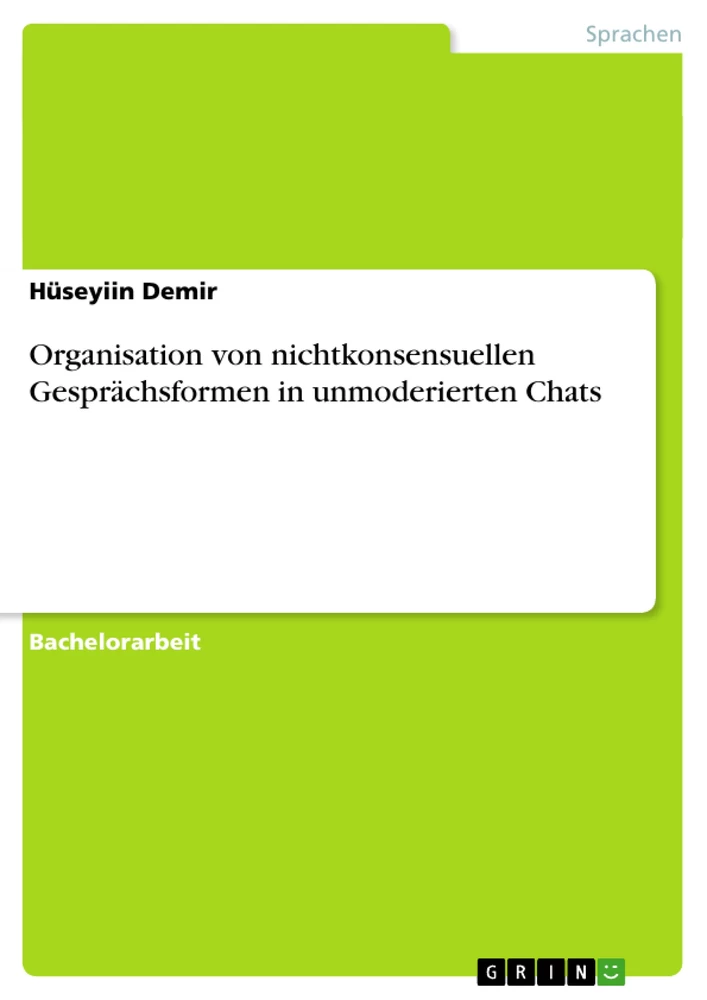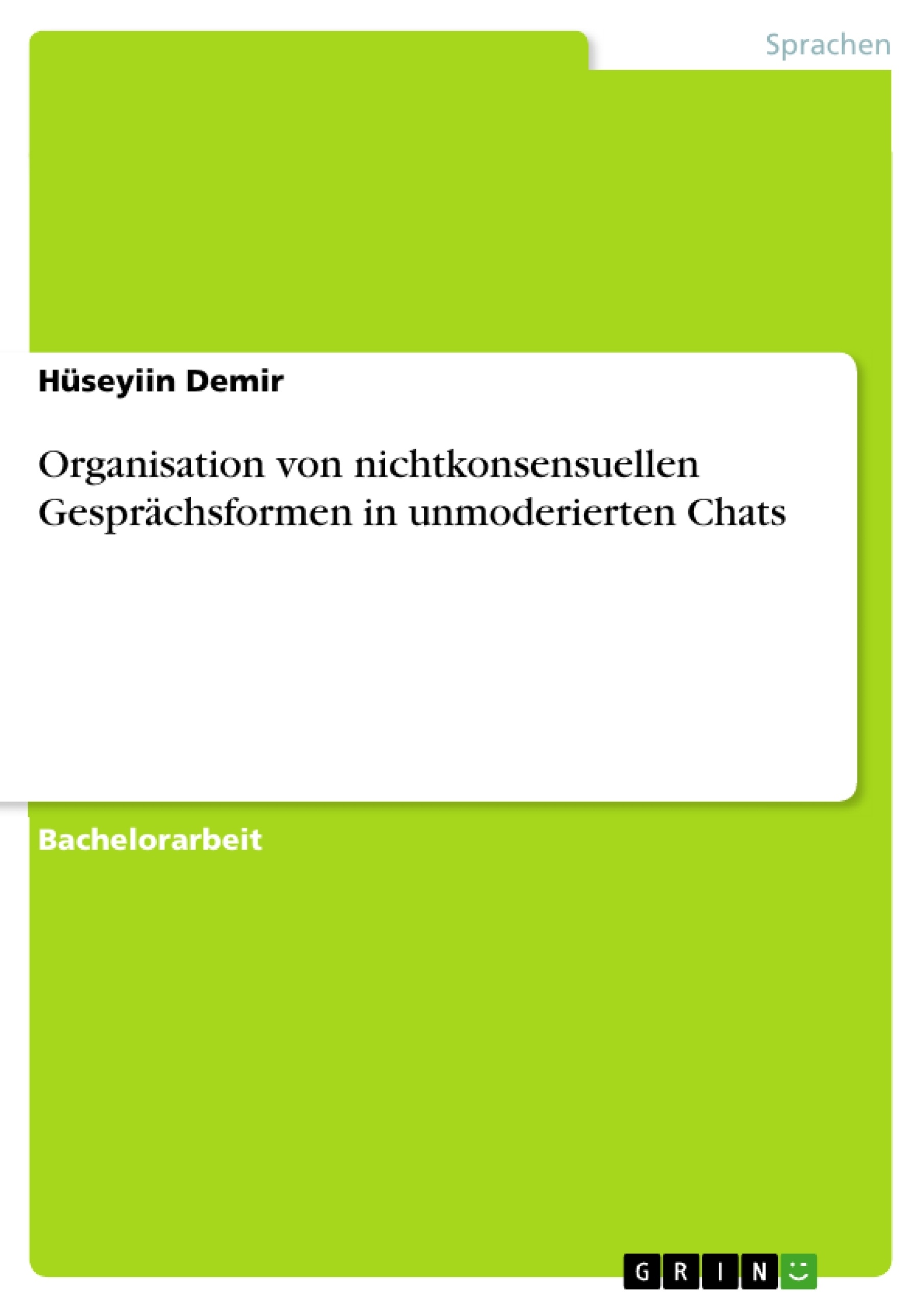Nach Geers (1999) wird durch die computervermittelte Kommunikation1 „die gesamte Natur der menschlichen Kommunikation verändert [...]“ (Geers 1999: 84) und Androutsopulos/Ziegler (2003) meinen, dass sie „neue Kommunikationspraktiken und Muster des Sprachgebrauchs ermöglicht, die einen entscheidenden Einfluss auf Sprachwandel haben können.“ (Androutsopoulos/Ziegler 2003: 1) Insgesamt kann demnach angenommen werden, dass die CvK der gegenwärtigen Tendenz entsprechend weiter an Bedeutung gewinnen wird.
Eine der beliebtesten Formen CvK ist der Chat. (Vgl. Runkehl et al. 1998: 73) Aus dieser Formulierung sollte aber nicht geschlossen werden, dass es „den Chat“ als solchen gibt.
Runkehl et al. (1998) meint hierzu:
„Es zeigt sich […], daß es sehr unterschiedliche Chats gibt und das Pauschalaussagen über das Chatten, wie man sie allzu häufig findet, problematisch sind.“ (Runkehl et al. 1998: 81)
Technisch gesehen bestehen drei Chat-Möglichkeiten, die in Kapitel 2 dargestellt werden sollen.
In der linguistischen Forschung, besonders in der Konversationsanalyse, sind mittlerweile einige Arbeiten zu finden, die sich aber zumeist nur mit sprachlichen Phänomenen im Chat beschäftigen. Nach Beißwenger/Storrer (2005) wird dabei jedoch vernachlässigt, dass der Chat eine Kommunikationstechnologie darstellt, die in zahlreichen verschiedenen Bereichen Anwendung findet. (Siehe 2.1) Die untersuchten Chats liegen zumeist ausschließlich im informellen Bereich und können als „Plauderchats“ bezeichnet werden. (Vgl. Beißwenger/Storrer 2005: 12)
In Rahmen dieser Arbeit wird untersucht, wie Kommunikationsteilnehmer unter den medialen bzw. technischen Bedingungen unmoderierter Chats die kommunikative Handlung Dissens bewältigen.
Aufgrund des begrenzten Rahmens dieser Arbeit beschränke ich mich auf die Untersuchung unmoderierter Chats, wobei die Ergebnisse zum Teil auch auf moderierte Chats übertragbar sind.
Die Frage ist gesprächsanalytisch interessant, da essenzielle Merkmale von nichtkonsensuellen Gesprächsformen, wie sie z.B. durch Gruber (1996) erläutert werden, im Chat nicht realisierbar sind. Dazu zählen vor allem Phänomene des Sprecherwechsels, wie Unterbrechungen und Überlappungen, aber auch bestimmte Ausdrucksweisen auf para- und nonverbaler Ebene, durch die emotionale Elemente der Kommunikation, denen in nichtkonsensuellen Gesprächsformen eine besondere Bedeutung zukommt, vermittelt werden können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Chat-Kommunikation
- 2.1 Technisches und kommunikatives Setting
- 2.2 Charakteristika der Chat-Kommunikation
- 2.2.1 Moderierte vs. unmoderierte Chats
- 2.2.2 Sprachliche Besonderheiten der Chat-Kommunikation
- 3. Schriftlichkeit vs. Mündlichkeit
- 3.1 Schriftlichkeit vs. Mündlichkeit in der Chat-Kommunikation
- 4. Konfliktkommunikation
- 4.1 Dissente Sequenzen und andere nichtkonsensuelle Gesprächsformen
- 4.2 Inhaltliche Merkmale
- 4.3 Formale Merkmale
- 4.4 Zur Rolle von Emotionen in nichtkonsensuellen Gesprächsformen
- 5. Übertragbarkeit der Organisationsstruktur nicht-konsensueller Gesprächsformen auf die Chat-Kommunikation
- 5.1 Exemplarische Untersuchung
- 5.2 Inhaltliche Ebene
- 5.3 Formale Ebene
- 5.4 Kompensations- und Substitutionsmöglichkeiten
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie Kommunikationspartner in unmoderierten Chats Dissens bewältigen. Der begrenzte Rahmen fokussiert auf unmoderierte Chats, wobei die Ergebnisse teilweise auf moderierte Chats übertragbar sind. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen, die das Fehlen bestimmter Merkmale der Face-to-Face-Kommunikation (Sprecherwechsel, nonverbale Kommunikation) für die Darstellung von Dissens im Chat mit sich bringt.
- Analyse der Bewältigung von Dissens in unmoderierten Chats
- Untersuchung der sprachlichen und formalen Besonderheiten von Dissens im Chat
- Vergleich von Chat-Kommunikation mit Face-to-Face-Kommunikation bezüglich Dissens
- Identifizierung von Kompensations- und Substitutionsstrategien im Chat
- Untersuchung verschiedener Chat-Typen (IRC vs. proprietäre Chats)
Zusammenfassung der Kapitel
2. Chat-Kommunikation: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Chat" und beschreibt das technische und kommunikative Setting. Es wird zwischen synchroner und asynchroner computervermittelter Kommunikation unterschieden und die technischen Grundlagen des Chats erläutert, sowie der Einfluss dieser Grundlagen auf die Kommunikation. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen moderierten und unmoderierten Chats, mit einer detaillierten Darstellung der sprachlichen Besonderheiten der Chat-Kommunikation und wie sich diese je nach technischer Grundlage unterscheiden.
3. Schriftlichkeit vs. Mündlichkeit: Aufbauend auf dem Modell von Koch/Oesterreicher (1990) klassifiziert dieses Kapitel den Chat im Spannungsfeld zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit. Es diskutiert die Einstufung des Chats als Gesprächsform und die damit verbundene Vergleichbarkeit mit der Face-to-Face-Kommunikation. Die Diskussion beleuchtet die spezifischen Merkmale des Chats im Hinblick auf seine Positionierung innerhalb dieses Kontinuums.
4. Konfliktkommunikation: Dieses Kapitel beschreibt nichtkonsensuelle Gesprächsformen im Chat, wobei der Fokus auf dissenten Sequenzen liegt. Es werden typische inhaltliche und formale Merkmale dieser Sequenzen analysiert, insbesondere das System des Sprecherwechsels im Chat und die Rolle von Emotionen in diesen Konfliktsituationen. Der Kapitelteil beleuchtet wie der Mangel an nonverbalen und paraverbalen Signalen die Darstellung von Emotionen und die Bewältigung von Konflikten beeinflusst.
5. Übertragbarkeit der Organisationsstruktur nicht-konsensueller Gesprächsformen auf die Chat-Kommunikation: Dieses Kapitel wendet die im vorherigen Kapitel erarbeiteten Merkmale nichtkonsensueller Gesprächsformen auf die Chat-Kommunikation an, unter Berücksichtigung verschiedener Chat-Formen. Eine exemplarische Untersuchung eines Chat-Protokolls illustriert, wie Chat-Teilnehmer Dissens bewältigen. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Kompensations- und Substitutionsstrategien, die verwendet werden, um die fehlenden Wahrnehmungskanäle der Chat-Kommunikation auszugleichen.
Schlüsselwörter
Chat-Kommunikation, unmoderierte Chats, Konfliktkommunikation, Dissens, computervermittelte Kommunikation (CvK), Sprecherwechsel, nonverbale Kommunikation, Kompensationsstrategien, sprachliche Besonderheiten, Face-to-Face-Kommunikation, Moderation, Sprachwandel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Analyse der Konfliktbewältigung in unmoderierten Chats
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht, wie Kommunikationspartner in unmoderierten Chats Dissens bewältigen. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen, die das Fehlen von Face-to-Face-Kommunikationsmerkmalen (Sprecherwechsel, nonverbale Kommunikation) für die Darstellung von Dissens im Chat mit sich bringt. Die Ergebnisse sind teilweise auch auf moderierte Chats übertragbar.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die Bewältigung von Dissens in unmoderierten Chats, untersucht die sprachlichen und formalen Besonderheiten von Dissens im Chat, vergleicht Chat-Kommunikation mit Face-to-Face-Kommunikation bezüglich Dissens, identifiziert Kompensations- und Substitutionsstrategien im Chat und untersucht verschiedene Chat-Typen (z.B. IRC vs. proprietäre Chats).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Chat-Kommunikation (inkl. technischem und kommunikativem Setting, Moderation, sprachlichen Besonderheiten), Schriftlichkeit vs. Mündlichkeit in der Chat-Kommunikation, Konfliktkommunikation (inkl. dissenter Sequenzen, inhaltlicher und formaler Merkmale, Rolle von Emotionen), Übertragbarkeit der Organisationsstruktur nicht-konsensueller Gesprächsformen auf die Chat-Kommunikation (inkl. exemplarischer Untersuchung, inhaltlicher und formaler Ebene, Kompensations- und Substitutionsmöglichkeiten) und Fazit.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Analysemethode, die auf der Untersuchung von Chat-Protokollen basiert. Es wird ein Vergleich zwischen Chat-Kommunikation und Face-to-Face-Kommunikation durchgeführt, um die spezifischen Herausforderungen der Chat-Kommunikation im Umgang mit Dissens zu beleuchten.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse?
Die Arbeit identifiziert sprachliche und formale Merkmale von Dissens in unmoderierten Chats und analysiert die Kompensations- und Substitutionsstrategien, die von Chat-Teilnehmern eingesetzt werden, um den Mangel an nonverbaler und paraverbaler Kommunikation auszugleichen. Die Ergebnisse zeigen die spezifischen Herausforderungen und Strategien der Konfliktbewältigung im Kontext computervermittelter Kommunikation auf.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Chat-Kommunikation, unmoderierte Chats, Konfliktkommunikation, Dissens, computervermittelte Kommunikation (CvK), Sprecherwechsel, nonverbale Kommunikation, Kompensationsstrategien, sprachliche Besonderheiten, Face-to-Face-Kommunikation, Moderation, Sprachwandel.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit computervermittelter Kommunikation, Konfliktkommunikation und Sprachwissenschaft beschäftigen. Sie bietet Einblicke in die spezifischen Herausforderungen und Strategien der Kommunikation in Online-Umgebungen.
Wo finde ich die detaillierte Analyse?
Die detaillierte Analyse der Konfliktbewältigung in unmoderierten Chats findet sich in den einzelnen Kapiteln der Arbeit, welche im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeführt sind. Die Kapitelzusammenfassungen bieten einen Überblick über die jeweiligen Inhalte.
- Citation du texte
- Hüseyiin Demir (Auteur), 2007, Organisation von nichtkonsensuellen Gesprächsformen in unmoderierten Chats, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90459