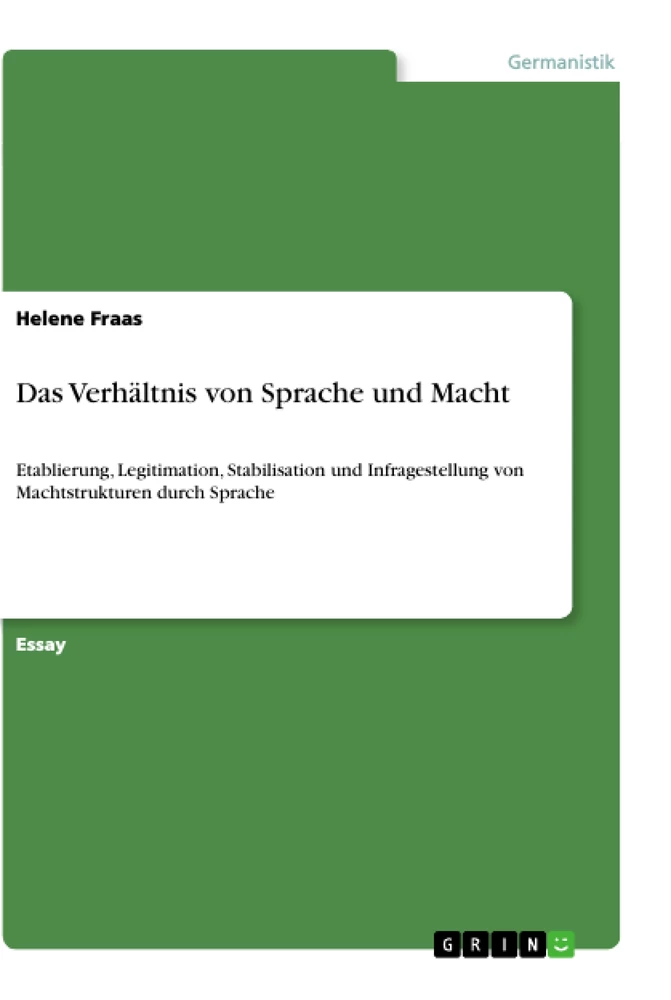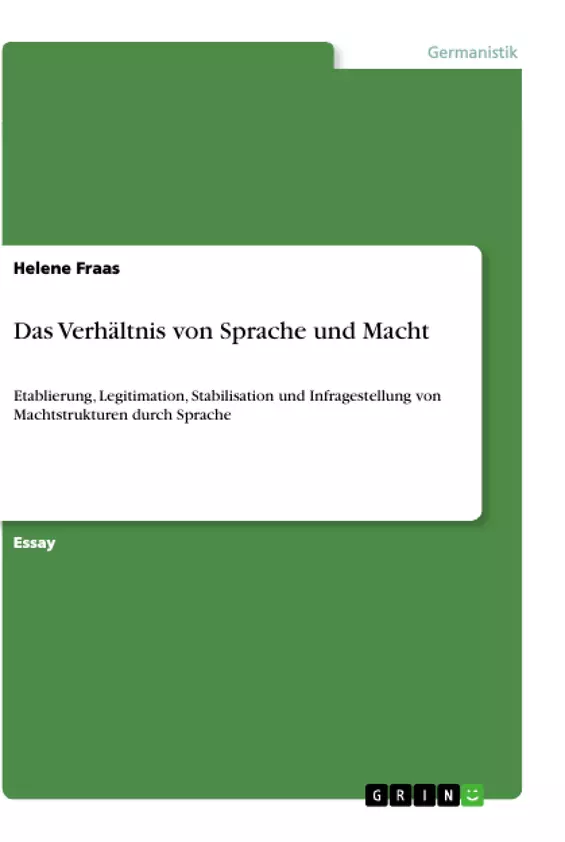Die Arbeit soll sich anhand dreier Perspektiven dem Verhältnis von Sprache und Macht widmen.
Den uns umgebenden Worten liegt eine Kraft aber auch eine gewisse Macht inne, welche erst dann sichtbar wird, wenn sie etwas auslösen. Sie besitzen die Stärke oftmals völlig ungeahnte Auswirkungen auf das Leben der Menschen und auf den Menschen selbst vorzunehmen. Die Thematisierung der Zusammengehörigkeit von "Sprache und Macht" ist in der germanistischen Linguistik hinsichtlich mehrerer Perspektiven zugänglich. Sei es die Diskursanalyse, frame-semantische Auslegungen oder die Politolinguistik - alle Perspektiven inkludieren ein gemeinsames Interesse: Wie wird Sprache als Machtinstrument eingesetzt? Wie gestaltet sich die Etablierung, Legitimation, Stabilisation und letztlich auch Infragestellung von Machtstrukturen durch Sprache? Wie stellen sich solche Machtstrukturen im Sprachgebrauch dar? Welche gesellschaftlich bedeutsamen Angelegenheiten werden unter dem Zusammenhang von "Sprache und Macht" diskutiert? Sprache ist demnach viel mehr als ein bloßes Mittel der Kommunikation, sondern ebenso ein facettenreiches Instrument sozialen Handelns und der Ausübung von Gewalt.
Inhaltsverzeichnis
- Sprache und Macht: Ein einführender Überblick
- Mehrsprachigkeit und Subjektivierung: Die Perspektive von Mecheril und Quehl
- Subjektivierende Wirkung von Sprache
- Sprache als Raum sozialer Distinktion
- Legitime und illegitime Sprachpraxen in der Schule
- Symbolische Verletzbarkeit und sprachliche Gewalt: Die Perspektive von Kuch und Hermann
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht das Verhältnis von Sprache und Macht aus verschiedenen linguistischen Perspektiven. Sie beleuchtet, wie Sprache als Machtinstrument eingesetzt wird, wie Machtstrukturen durch Sprache etabliert und infrage gestellt werden und welche gesellschaftlichen Auswirkungen dies hat.
- Sprache als Machtinstrument
- Die subjektivierende Wirkung von Sprache und Spracherwerb
- Legitime und illegitime Sprachpraxen
- Sprachliche Gewalt und symbolische Verletzbarkeit
- Die Rolle von Sprache in der Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe
Zusammenfassung der Kapitel
Sprache und Macht: Ein einführender Überblick: Dieser einführende Abschnitt legt die Grundlage für die gesamte Arbeit, indem er das komplexe Verhältnis zwischen Sprache und Macht einführt und die Bedeutung der sprachlichen Thematisierung von Machtstrukturen in der germanistischen Linguistik betont. Er skizziert verschiedene Perspektiven – Diskursanalyse, framesemantische Auslegungen und Politolinguistik – und stellt die zentrale Frage nach der Verwendung von Sprache als Machtinstrument in den Mittelpunkt. Die Einleitung deutet bereits die vielschichtige Rolle der Sprache an, die weit über die bloße Kommunikation hinausgeht und soziale Handlungen und die Ausübung von Gewalt umfasst. Die Arbeit verspricht eine Analyse dieses Verhältnisses anhand dreier verschiedener Perspektiven.
Mehrsprachigkeit und Subjektivierung: Die Perspektive von Mecheril und Quehl: Dieses Kapitel analysiert das Verhältnis von Sprache und Macht im Kontext der Mehrsprachigkeit, insbesondere im migrations-pädagogischen Bereich. Mecheril und Quehl betonen die subjektivierende Wirkung von Sprache und Spracherwerb. Sie zeigen auf, wie Sprachkompetenz die Gestaltung und Reorganisation von Lernprozessen beeinflusst und Handlungsfähigkeit ermöglicht. Der Kapitel befasst sich aber auch mit den ermächtigenden und einschränkenden Praxen der Kommunikation und dem Verhältnis von dominanten und nachrangigen Sprachen. Dabei wird die subjektivierende Wirkung von Sprache als sowohl ermächtigend wie auch unterwerfend dargestellt, mit der Betonung auf der Handlungsmacht von Sprache als Mittel zur Erschließung von Welt und zur Identitätsbildung. Ein zentrales Thema ist die soziale Distinktion durch Sprache, die unterschiedliche Anerkennung für verschiedene Sprachvarianten mit sich bringt. Die Schule als Ort der Legitimierung und Reproduktion sozialer Ungleichheiten wird kritisch beleuchtet.
Symbolische Verletzbarkeit und sprachliche Gewalt: Die Perspektive von Kuch und Hermann: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den symbolischen Gehalt von Sprache und deren Potenzial für Verletzung und Gewalt. Im Fokus steht nicht die physische, sondern die soziale Verletzbarkeit, die durch abwertende Äußerungen und die Herabsetzung des sozialen Seins entsteht. Kuch und Hermann argumentieren, dass Sprache konstitutiv für die soziale Existenz von Menschen ist, und deren Verletzung daher tiefgreifende Auswirkungen hat. Das Kapitel erörtert, wie abwertende Äußerungen soziale Ortsverschiebungen bewirken und Menschen von der Teilnahme am sozialen Austausch ausschließen können. Die Macht der Sprache manifestiert sich hier in ihrer Fähigkeit, den sozialen Status zu verändern und Menschen zu verletzen, indem sie ihre soziale Existenz in Frage stellt.
Schlüsselwörter
Sprache, Macht, Mehrsprachigkeit, Migrationsgesellschaft, Subjektivierung, Legitimität, illegitime Sprachpraxen, soziale Distinktion, sprachliche Gewalt, symbolische Verletzbarkeit, Bildung, gesellschaftliche Teilhabe, Handlungsfähigkeit, Anerkennung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Sprache und Macht - Ein einführender Überblick
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das komplexe Verhältnis von Sprache und Macht aus verschiedenen linguistischen Perspektiven. Sie beleuchtet, wie Sprache als Machtinstrument eingesetzt wird, wie Machtstrukturen durch Sprache etabliert und infrage gestellt werden und welche gesellschaftlichen Auswirkungen dies hat.
Welche Perspektiven werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert das Thema anhand dreier verschiedener Perspektiven: Ein einführender Überblick, die Perspektive von Mecheril und Quehl (Mehrsprachigkeit und Subjektivierung), und die Perspektive von Kuch und Hermann (Symbolische Verletzbarkeit und sprachliche Gewalt). Dabei werden verschiedene linguistische Ansätze wie Diskursanalyse, framesemantische Auslegungen und Politolinguistik berücksichtigt.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Zentrale Themen sind die Verwendung von Sprache als Machtinstrument, die subjektivierende Wirkung von Sprache und Spracherwerb, legitime und illegitime Sprachpraxen, sprachliche Gewalt und symbolische Verletzbarkeit, sowie die Rolle von Sprache in der Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe.
Was ist die Kernaussage des einführenden Kapitels?
Das einführende Kapitel legt die Grundlage der Arbeit, indem es das komplexe Verhältnis von Sprache und Macht einführt und die Bedeutung der sprachlichen Thematisierung von Machtstrukturen in der germanistischen Linguistik betont. Es skizziert verschiedene Perspektiven und stellt die zentrale Frage nach der Verwendung von Sprache als Machtinstrument in den Mittelpunkt.
Wie behandeln Mecheril und Quehl das Thema Sprache und Macht?
Mecheril und Quehl analysieren das Verhältnis von Sprache und Macht im Kontext der Mehrsprachigkeit, insbesondere im migrations-pädagogischen Bereich. Sie betonen die subjektivierende Wirkung von Sprache und Spracherwerb und zeigen auf, wie Sprachkompetenz die Gestaltung und Reorganisation von Lernprozessen beeinflusst. Sie beleuchten auch die ermächtigenden und einschränkenden Praxen der Kommunikation und das Verhältnis von dominanten und nachrangigen Sprachen.
Was ist der Fokus von Kuch und Hermann?
Kuch und Hermann konzentrieren sich auf den symbolischen Gehalt von Sprache und deren Potenzial für Verletzung und Gewalt. Sie untersuchen die soziale Verletzbarkeit, die durch abwertende Äußerungen und die Herabsetzung des sozialen Seins entsteht, und argumentieren, dass Sprache konstitutiv für die soziale Existenz von Menschen ist.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Sprache, Macht, Mehrsprachigkeit, Migrationsgesellschaft, Subjektivierung, Legitimität, illegitime Sprachpraxen, soziale Distinktion, sprachliche Gewalt, symbolische Verletzbarkeit, Bildung, gesellschaftliche Teilhabe, Handlungsfähigkeit und Anerkennung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst drei Kapitel: einen einführenden Überblick, ein Kapitel über Mehrsprachigkeit und Subjektivierung nach Mecheril und Quehl, und ein Kapitel über symbolische Verletzbarkeit und sprachliche Gewalt nach Kuch und Hermann.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Germanistik, Linguistik und Pädagogik, sowie für alle, die sich für das Verhältnis von Sprache, Macht und Gesellschaft interessieren.
- Quote paper
- Helene Fraas (Author), 2019, Das Verhältnis von Sprache und Macht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/904776