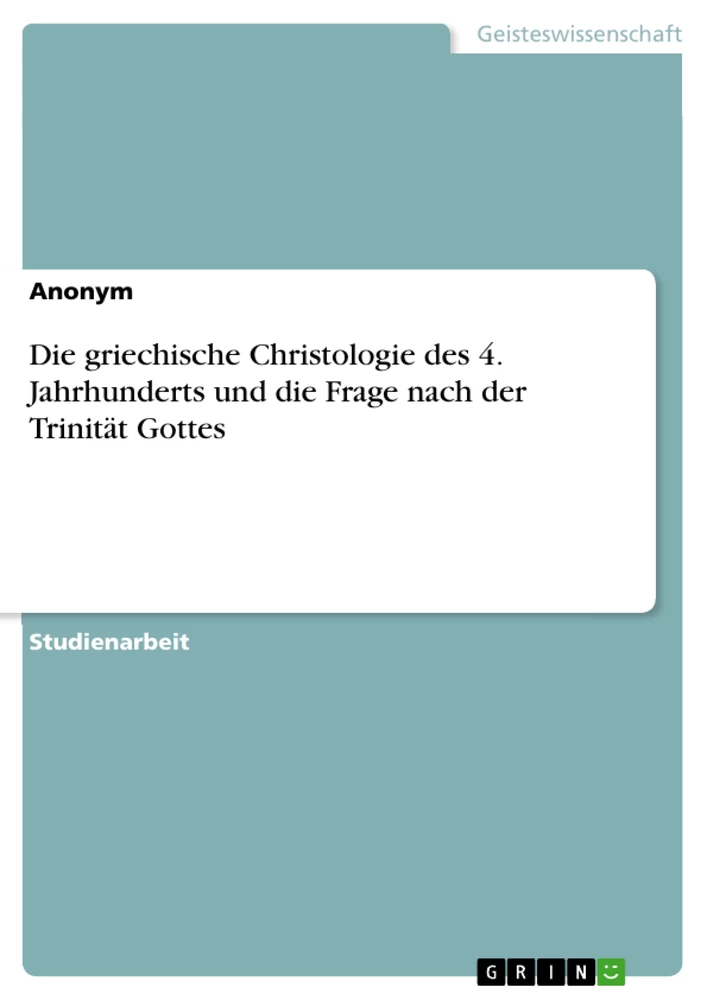Diese Arbeit wird sich mit den geschichtlichen und kirchlich-dogmatischen Hintergründen im vierten Jahrhundert beschäftigen und dabei den Fokus auf den Auslöser für die beiden ersten ökumenischen Konzilien und deren Beschlüsse legen . Dabei werden die dazwischenliegenden Turbulenzen thematisiert. Die im Bezug darauf entstandenen Logos-Sarx- und Logos-Anthropos-Modelle sollten als Alternative für die bis dato noch nicht geklärte dogmatische Frage gelten. Doch auch diese Christologien zeigen Schwächen und liefern einen Raum für neue Diskussionen rund um die Frage nach der Wesensart von Vater und Sohn im trinitätstheologischen Kontext. Ein anschließender Blick auf das Konzil von Konstantinopel, welches als das zweite ökumenische Konzil bekannt ist, soll aufzeigen, wie sich das in Nicäa beschlossene Glaubensbekenntnis grob veränderte und die ob der Klärung um die Wesensgleichheit von Vater und Sohn aus dem Konzil hervorging.
Im 21. Jahrhundert angekommen, sind die Glaubensgrundsätze des Christentums vollkommen klar. Die Christen, die einer monotheistischen Religion angehören, dem Glauben an einen Gott, glauben an die Dreifaltigkeit Gottes: Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. In der Antike duellierten sich verschiedene Theologen mit der genauen Beschreibung des Verhältnisses von Vater und Sohn und die damit verbundene Realisierung des Logos. Der zunächst thematisierte Arius löste mit seiner verfassten Christologie den größten Streit des vierten Jahrhunderts aus. Der nach ihm benannte „arianische Streit“ legte den Grundstein für eine Diskussion der verschiedensten Christologien und Verständnisfragen rund um den Logos und seine Beziehung zum Vater. Um diese Frage eindeutig zu klären und die kirchlichen, sowie politischen Auseinandersetzungen im Raum rund um Alexandrien zu klären, wurde ein Konzil einberufen, das als das erste ökumenische Konzil in die Geschichte eingehen sollte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Arius, der Häretiker.
- Das erste Konzil von Nicäa.
- Die nachnicäanische Zeit
- Das Logos-Sarx-Modell nach Apollinaris von Laodicea....
- Das Logos-Anthropos-Modell der beiden Theologenschulen..........\li>
- Das erste Konzil von Konstantinopel.
- Fazit...........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den geschichtlichen und kirchlich-dogmatischen Hintergründen der beiden ersten ökumenischen Konzilien im vierten Jahrhundert. Der Fokus liegt auf den Auslösern für diese Konzilien und deren Beschlüsse, sowie auf den zwischenzeitlichen Turbulenzen. Die im Zuge dieser Auseinandersetzungen entstandenen Logos-Sarx- und Logos-Anthropos-Modelle werden als alternative Ansätze zur Klärung der damaligen dogmatischen Fragen beleuchtet.
- Der arianische Streit und die Entstehung unterschiedlicher Christologien
- Die beiden ersten ökumenischen Konzilien von Nicäa und Konstantinopel
- Die Logos-Sarx- und Logos-Anthropos-Modelle als alternative Christologien
- Die Bedeutung der Wesensgleichheit von Vater und Sohn für die Trinitätslehre
- Die Entwicklung des christlichen Glaubensbekenntnisses im vierten Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung erläutert die grundlegenden Fragen der Christologie im vierten Jahrhundert und stellt den historischen Kontext des arianischen Streits dar.
- Arius, der Häretiker: Dieses Kapitel präsentiert die Person und die Christologie des Arius, der mit seinen Ansichten zur Gottesnatur den großen Streit des vierten Jahrhunderts auslöste. Es wird auf seine Lebensgeschichte, seine theologischen Ansichten und die Gründe für seine Ablehnung durch den Bischof von Alexandrien eingegangen.
- Das erste Konzil von Nicäa: Dieses Kapitel behandelt das erste ökumenische Konzil von Nicäa, das einberufen wurde, um die kontroversen Lehren des Arius zu verurteilen. Es werden die wichtigsten Themen des Konzils, die Beschlüsse, die Bedeutung des Konzils für die Entwicklung der christlichen Lehre und die Hintergründe des Konzils erläutert.
- Die nachnicäanische Zeit: Dieses Kapitel beleuchtet die Zeit nach dem Konzil von Nicäa und die Weiterentwicklung der christlichen Lehre in Bezug auf die Trinitätslehre. Es wird auf die verschiedenen Theologenschulen und ihre unterschiedlichen Interpretationen der nicänischen Glaubensformel eingegangen.
- Das Logos-Sarx-Modell nach Apollinaris von Laodicea: Dieses Kapitel stellt die Christologie des Apollinaris von Laodicea vor, der eine besondere Form der Inkarnationslehre entwickelte. Es wird auf die zentralen Elemente seiner Theorie, seine Kritik an anderen Christologien und die Gründe für seine Ablehnung durch die Kirche eingegangen.
- Das Logos-Anthropos-Modell der beiden Theologenschulen: Dieses Kapitel beleuchtet zwei verschiedene theologische Ansätze, die auf der Vorstellung von einem „Logos-Menschen“ basieren. Es wird auf die unterschiedlichen Perspektiven, die Argumente und die Kritik an diesen Modellen eingegangen.
- Das erste Konzil von Konstantinopel: Dieses Kapitel widmet sich dem zweiten ökumenischen Konzil von Konstantinopel und seinen Beschlüssen, die die dogmatische Entwicklung des christlichen Glaubens weiter prägten. Es wird auf die Gründe für die Einberufung des Konzils, die wichtigsten Themen und die Bedeutung seiner Beschlüsse für die Trinitätslehre eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen der frühchristlichen Dogmatik, insbesondere den arianischen Streit, die beiden ersten ökumenischen Konzilien, verschiedene Christologien wie das Logos-Sarx- und das Logos-Anthropos-Modell, die Trinitätslehre, die Wesensgleichheit von Vater und Sohn und die Entwicklung des christlichen Glaubensbekenntnisses.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Kern des arianischen Streits?
Arius lehrte, dass Jesus Christus als „Sohn“ ein Geschöpf Gottes sei und nicht wesensgleich mit Gott dem Vater. Dies führte zu einer tiefen Spaltung der frühen Kirche.
Was wurde auf dem Konzil von Nicäa (325 n. Chr.) beschlossen?
Das Konzil verurteilte die Lehre des Arius und legte fest, dass der Sohn „wesensgleich“ (homoousios) mit dem Vater ist, was im Nicänischen Glaubensbekenntnis festgehalten wurde.
Was unterscheidet das Logos-Sarx- vom Logos-Anthropos-Modell?
Das Logos-Sarx-Modell sieht im Logos die Seele des Fleisches Jesu, während das Logos-Anthropos-Modell betont, dass der Logos eine vollständige menschliche Natur (inklusive menschlicher Seele) angenommen hat.
Welche Bedeutung hatte das Konzil von Konstantinopel (381 n. Chr.)?
Es bestätigte Nicäa, erweiterte das Glaubensbekenntnis um die Gottheit des Heiligen Geistes und schloss damit die dogmatische Entwicklung der Trinitätslehre vorerst ab.
Wer war Apollinaris von Laodicea?
Ein Theologe, der das Logos-Sarx-Modell so extrem vertrat, dass er Jesus eine menschliche Vernunftseele absprach, was später ebenfalls als Häresie verurteilt wurde.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Die griechische Christologie des 4. Jahrhunderts und die Frage nach der Trinität Gottes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/904824