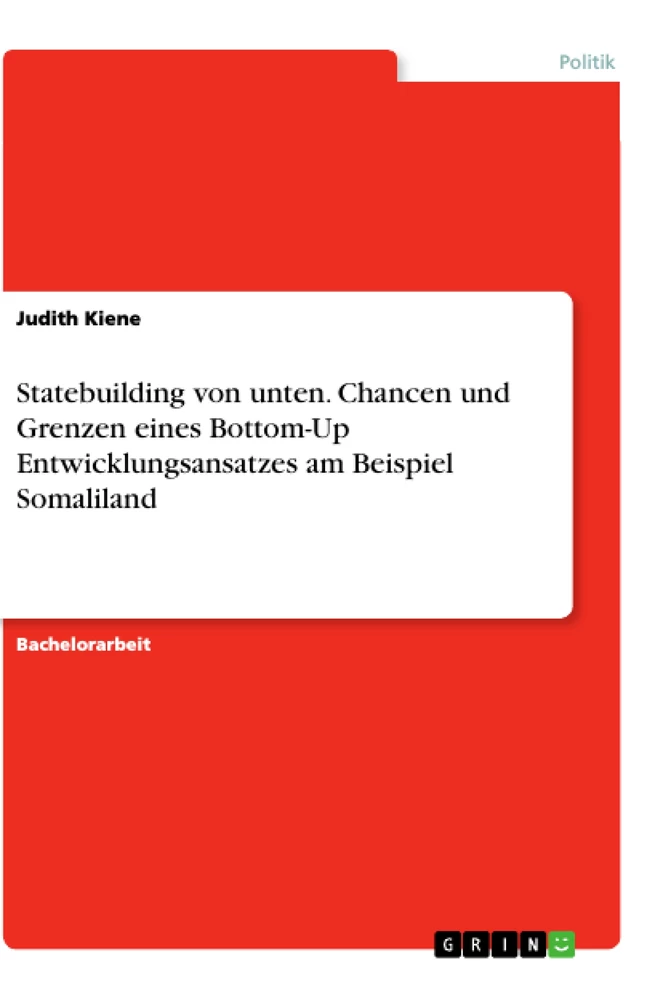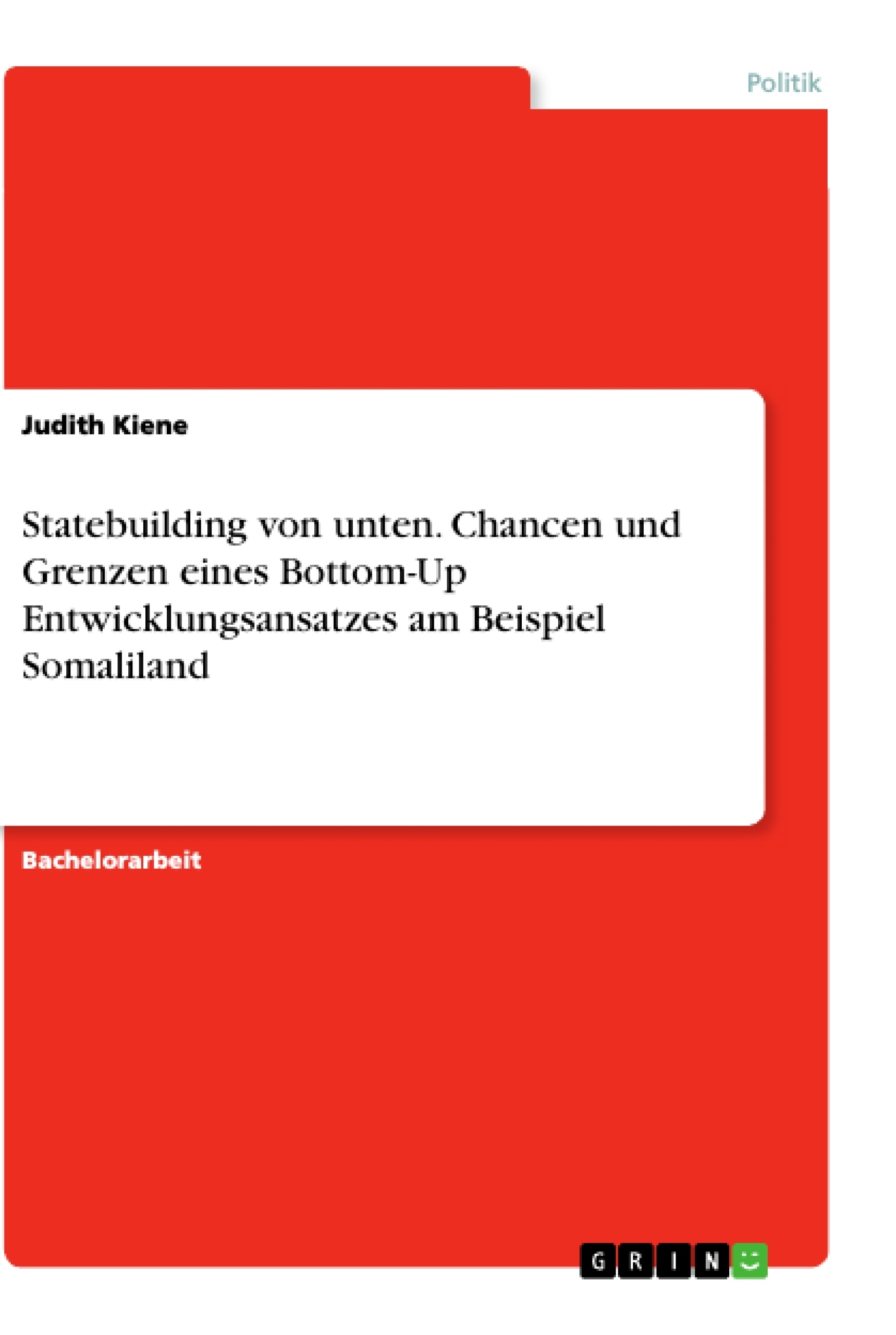Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Staatenbildung in Somaliland. Im Folgenden werden Statebuilding Strategien dargestellt und eine umfassende Analyse des Statebuilding-Prozesses in Somaliland erstellt.
Seit dem Ende des Kalten Krieges und dem sicherheitspolitischen Paradigmenwechsel nach dem 11. September 2001 werden zerfallene Staaten zunehmend als Bedrohung für die internationale Sicherheit wahrgenommen und der Fokus in den Programmen internationaler Organisationen, wie der UN, wurde zunehmend auf den Wiederaufbau staatlicher Institutionen gelegt. Als Lösung dieses Problems und zur Neutralisierung der Bedrohung ist das Konzept des Statebuilding entstanden, das darauf abzielt durch internationale Unterstützung Staaten wiederaufzubauen. Ein Ziel der Statebuilding-Interventionen in Form von Friedensmissionen ist bis heute Somalia, das seit dem Staatszerfall 1991 als Prototyp eines "failed state" beschrieben wird, da die Regierung gestürzt wurde und folglich Sicherheit sowie die Grundversorgung der eigenen Bevölkerung nicht mehr gewährleisten konnte.
Diese Interventionen haben allerdings bis zum heutigen Tage nur wenig konkrete Ergebnisse hervorgebracht: zwar fungiert Somalia auf dem Failed State Index seit 2017 nur noch auf Platz zwei hinter Jemen, jedoch stellen Piraterie und die islamistische Miliz Al-Shabaab eine erhebliche Bedrohung für die Sicherheit der Bevölkerung dar. Im Norden des Landes, in den Grenzen des ehemaligen Protektorats Britisch-Somaliland, hat sich seit der Sezession 1991 allerdings ein De-Facto Staat gebildet, der eigene Sicherheitskräfte, eine eigene Währung und ein aus zwei Kammern bestehendes Regierungssystem besitzt. Die Republik Somaliland hat durch lokal finanzierte Versöhnungskonferenzen einer eigenen nationalen Identität und der Integration von Clanstrukturen in die Regierung einen Statebuilding-Prozess eingeleitet. Dieser, in der Literatur immer wieder hervorgehobene, "Erfolg" im Statebuilding steht in scharfem Kontrast zum seit 1991 wiederholten Scheitern der internationalen Versuche, in Somalia durch einen Top-Down Ansatz eine effektive Regierung aufzubauen. Dabei wird versucht, die dominierenden politischen AkteurInnen eines Konflikts zu identifizieren und sie an den Verhandlungstisch zu bringen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Hintergrund: Friedensprozess und Statebuilding in Somaliland
- 1.2 Forschungsstand: Ansätze des Statebuilding
- 3. Ansätze des Statebuilding
- 3.1 Liberalization First
- 3.2 Institutionalization First
- 3.3 Security First
- 3.4 Civil Society First
- 3.5 Anwendbarkeit der Strategien in Somaliland
- 4. Methodisches Vorgehen
- 5. Fallstudie: Statebuilding in Somaliland
- 5.1 Integration von Clanstrukturen in das politische System
- 5.2 Somali National Movement (SMN) und nationale Identität
- 5.3 Lokale Finanzierung und wirtschaftliche Infrastruktur
- 5.4 Konflikte zur Regelstandardisierung und -konsolidierung
- 5.5 Nicht-Anerkennung und internationale Normen
- 5.6 Rolle der Diaspora
- 6. Chancen und Grenzen eines Bottom-Up Entwicklungsansatzes
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Chancen und Grenzen eines Bottom-Up Entwicklungsansatzes am Beispiel von Somaliland. Sie untersucht, wie die lokale Bevölkerung und lokale Institutionen durch die Integration von Clanstrukturen, die Entwicklung einer eigenen nationalen Identität und die Schaffung einer eigenen Wirtschaftsinfrastruktur einen eigenständigen Statebuilding-Prozess initiiert haben.
- Bottom-Up Ansatz im Statebuilding
- Integration von Clanstrukturen in politische Systeme
- Nationale Identität und Statebuilding
- Lokale Finanzierung und wirtschaftliche Entwicklung
- Somaliland im Kontext internationaler Nicht-Anerkennung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den Hintergrund des Statebuilding in Somaliland und beleuchtet den aktuellen Forschungsstand zu verschiedenen Ansätzen des Statebuilding. Anschließend werden verschiedene Strategien des Statebuilding, wie Liberalization First, Institutionalization First und Security First, vorgestellt und auf ihre Anwendbarkeit in Somaliland untersucht.
In Kapitel 5 wird der Statebuilding-Prozess in Somaliland im Detail analysiert. Dabei werden die Integration von Clanstrukturen in das politische System, die Rolle des Somali National Movement (SMN) bei der Entwicklung einer nationalen Identität, die lokale Finanzierung und die wirtschaftliche Infrastruktur sowie Konflikte zur Regelstandardisierung und -konsolidierung behandelt. Weiterhin werden die Auswirkungen der internationalen Nicht-Anerkennung und die Rolle der Diaspora für den Statebuilding-Prozess untersucht.
Das Kapitel 6 widmet sich den Chancen und Grenzen eines Bottom-Up Entwicklungsansatzes im Statebuilding, wobei die spezifischen Herausforderungen und Erfolgsfaktoren des Fallbeispiels Somaliland betrachtet werden.
Schlüsselwörter
Statebuilding, Somaliland, Bottom-Up Ansatz, Clanstrukturen, Nationale Identität, Lokale Finanzierung, Wirtschaftliche Infrastruktur, Nicht-Anerkennung, Internationale Normen, Diaspora, Friedensförderung, Konfliktlösung.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet den Statebuilding-Prozess in Somaliland von Somalia?
Somaliland nutzt einen Bottom-Up-Ansatz basierend auf lokalen Versöhnungskonferenzen und Clan-Integration, während in Somalia oft erfolglose Top-Down-Ansätze internationaler Organisationen dominieren.
Wie wurden Clanstrukturen in Somaliland integriert?
Traditionelle Clan-Strukturen wurden direkt in das politische System eingebunden, was zur Stabilisierung und Akzeptanz der nationalen Identität beitrug.
Welche Rolle spielt die internationale Nicht-Anerkennung?
Obwohl Somaliland ein de-facto Staat mit eigener Währung und Sicherheitskräften ist, erschwert die fehlende völkerrechtliche Anerkennung den Zugang zu globalen Märkten und Krediten.
Was ist ein „Bottom-Up“ Entwicklungsansatz?
Es ist ein Ansatz, bei dem die Staatenbildung aus der lokalen Gesellschaft heraus und durch Einbeziehung lokaler Akteure erfolgt, statt durch externe Vorgaben.
Welche Bedeutung hat die Diaspora für Somaliland?
Die Diaspora spielt eine zentrale Rolle bei der Finanzierung und dem wirtschaftlichen Aufbau des Landes, da offizielle internationale Hilfe oft begrenzt ist.
- Arbeit zitieren
- Judith Kiene (Autor:in), 2020, Statebuilding von unten. Chancen und Grenzen eines Bottom-Up Entwicklungsansatzes am Beispiel Somaliland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/904848