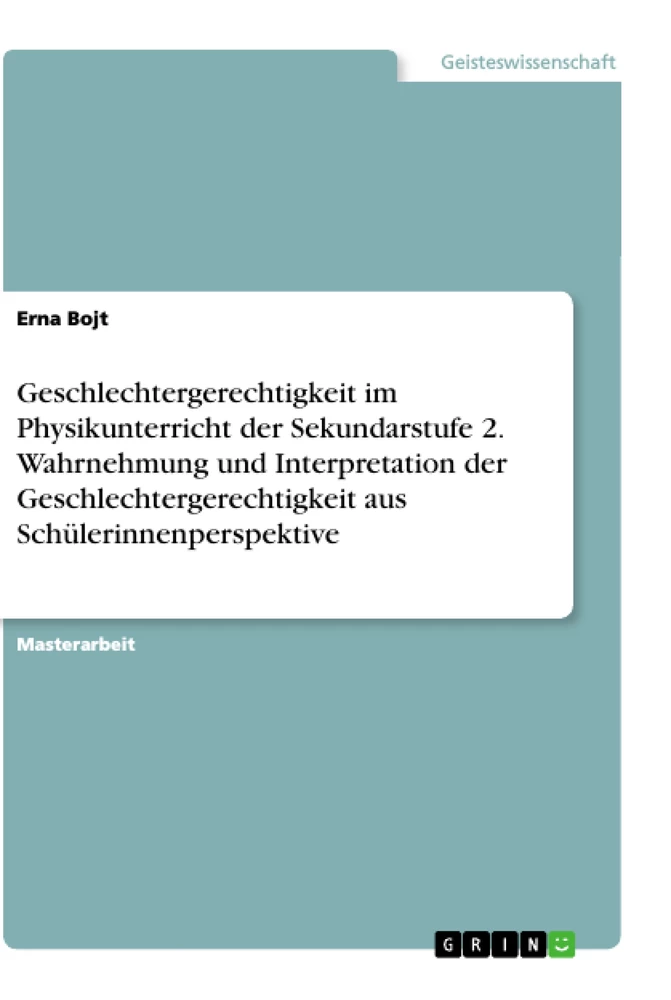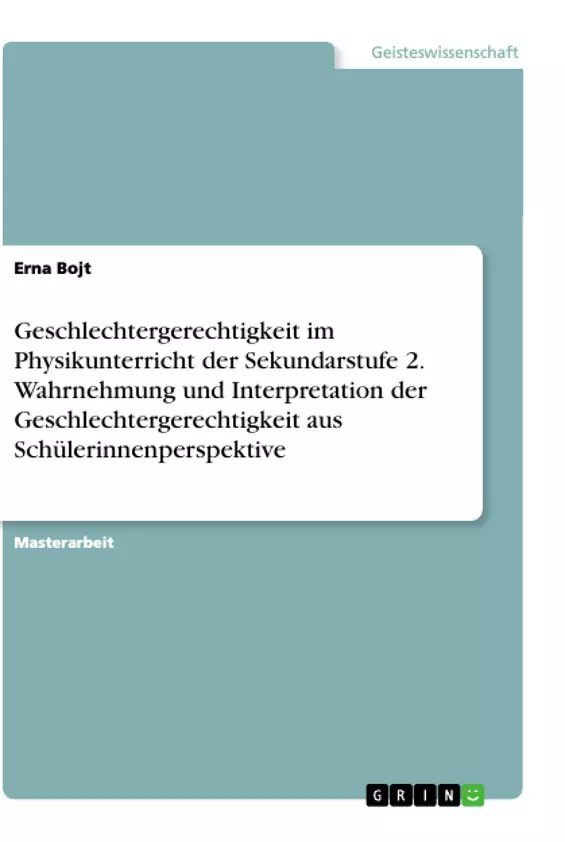Die Arbeit soll die Wahrnehmung und Interpretation eines Physiklehrmittels und der gendergerechten Sprache von Schülerinnen auf der Sekundarstufe 2 untersuchen. Schülerinnen und Schüler in der gesamten Deutschschweiz werden zu der Geschlechtergerechtigkeit in Physiklehrmitteln und im Unterricht mit Hilfe eines leitfadengestützten Interviews befragt, um ausführliche Informationen über die Wahrnehmung der Jugendlichen zu gewinnen sowie die Wirksamkeit der Lehrmittel zu erforschen. Die Untersuchung der Schülerinneninterviews geschieht basierend auf der qualitativen Inhaltsanalyse des Lehrmittels, wobei auf ein bereits erarbeitetes Kategoriensystem zurückgegriffen werden kann.
Das Ziel der Arbeit ist es, mithilfe von Berufswahltheorien, dem Forschungsstand zu den (fehlenden) Vorbildern und der Schulbuchforschung in den Naturwissenschaften aufzuzeigen, ob einerseits die Schülerinnen die Disparität in der Darstellung der Geschlechter wahrnehmen und inwiefern die (fehlenden) Vorbilder auf die Studien- und Berufswahl der Schülerinnen wirken. Die Aussagen der Schülerinnen zu den Aspekten der Vorbilder in Hinblick auf die Berufswahl werden qualitativ aufbereitet, die Befunde diskutiert und eventuelle Zusammenhänge erörtert. Folgenden Fragen sollen mit der Theorie ergründet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- Abstract
- Einleitung
- Theoretischer Rahmen
- Geschlechtergerechtigkeit in der Bildung
- Geschlechterrollen und Stereotype
- Berufswahltheorie
- Die Rolle von Vorbildern in der Berufswahl
- Methodik
- Das Projekt "Naturwissenschaft ist (auch) Frauensache!"
- Das Physik-Schulbuch "Physik für Mittelschulen"
- Leitfadeninterview
- Datenerhebung und -auswertung
- Ergebnisse
- Wahrnehmung der Geschlechterdisparität im Physiklehrmittel
- Die Rolle von Vorbildern in der Berufswahl
- Die Bedeutung von weiblichen Vorbildern in der Physik
- Diskussion
- Implikationen für die Bildungspraxis
- Grenzbereiche der Untersuchung
- Weiterführende Forschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die Wahrnehmung und Interpretation der Geschlechtergerechtigkeit im Physiklehrmittel aus der Perspektive von Schülerinnen der Sekundarstufe II. Das Ziel ist es, die Bedeutung von weiblichen Vorbildern für die Berufswahl in MINT-Fächern zu beleuchten und deren Einfluss auf die Disparität der Geschlechter in der Physik zu analysieren.
- Geschlechtergerechtigkeit in der Bildung
- Die Rolle von Vorbildern in der Berufswahl
- Die Bedeutung von weiblichen Vorbildern in MINT-Fächern
- Wahrnehmung und Interpretation von Schülerinnen
- Die Disparität der Geschlechter in der Physik
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt das Projekt "Naturwissenschaft ist (auch) Frauensache!" und das Ziel der Masterarbeit vor. Es wird die Problematik der Geschlechterdisparität in MINT-Fächern, besonders in der Physik, aufgezeigt.
- Im theoretischen Rahmen werden verschiedene Konzepte vorgestellt, die für die Untersuchung relevant sind. Dazu gehören die Geschlechtergerechtigkeit in der Bildung, Geschlechterrollen und Stereotype, die Berufswahltheorie und die Rolle von Vorbildern in der Berufswahl.
- Das Kapitel "Methodik" beschreibt die angewandten Methoden und das verwendete Material. Es werden das Projekt "Naturwissenschaft ist (auch) Frauensache!", das Physik-Schulbuch "Physik für Mittelschulen", das Leitfadeninterview und die Datenerhebung und -auswertung vorgestellt.
- Im Kapitel "Ergebnisse" werden die Erkenntnisse aus der Untersuchung präsentiert. Die Wahrnehmung der Geschlechterdisparität im Physiklehrmittel durch die Schülerinnen, die Rolle von Vorbildern in der Berufswahl und die Bedeutung von weiblichen Vorbildern in der Physik werden analysiert.
- Die Diskussion beleuchtet die Implikationen der Ergebnisse für die Bildungspraxis, die Grenzen der Untersuchung und Möglichkeiten für weiterführende Forschung.
Schlüsselwörter
Die Masterarbeit beschäftigt sich mit den Themen Geschlechtergerechtigkeit in der Bildung, Geschlechterrollen, Berufswahltheorie, Vorbilder in der Berufswahl, weiblichen Vorbildern in MINT-Fächern, Wahrnehmung von Schülerinnen, Geschlechterdisparität in der Physik und dem Physik-Schulbuch "Physik für Mittelschulen".
Häufig gestellte Fragen
Wie nehmen Schülerinnen die Geschlechtergerechtigkeit in Physikbüchern wahr?
Die Arbeit untersucht mittels Interviews, ob Schülerinnen die Disparität in der Darstellung von Männern und Frauen in Lehrmitteln bemerken.
Welche Rolle spielen weibliche Vorbilder für die Berufswahl?
Vorbilder sind entscheidend; ihr Fehlen in Physik-Schulbüchern kann die Studien- und Berufswahl von Mädchen in MINT-Fächern negativ beeinflussen.
Was ist das Projekt „Naturwissenschaft ist (auch) Frauensache!“?
Es ist der methodische Rahmen der Untersuchung, der die Wirksamkeit von Lehrmitteln und die Wahrnehmung von Jugendlichen in der Deutschschweiz erforscht.
Was wird an der Sprache in Physiklehrmitteln kritisiert?
Die Arbeit analysiert, inwiefern eine gendergerechte Sprache zur Identifikation der Schülerinnen mit dem Fach beitragen kann.
Welche Theorien werden zur Erklärung der Berufswahl genutzt?
Die Untersuchung stützt sich auf Berufswahltheorien und den aktuellen Forschungsstand zur Schulbuchforschung in den Naturwissenschaften.
- Quote paper
- Erna Bojt (Author), 2020, Geschlechtergerechtigkeit im Physikunterricht der Sekundarstufe 2. Wahrnehmung und Interpretation der Geschlechtergerechtigkeit aus Schülerinnenperspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/905573