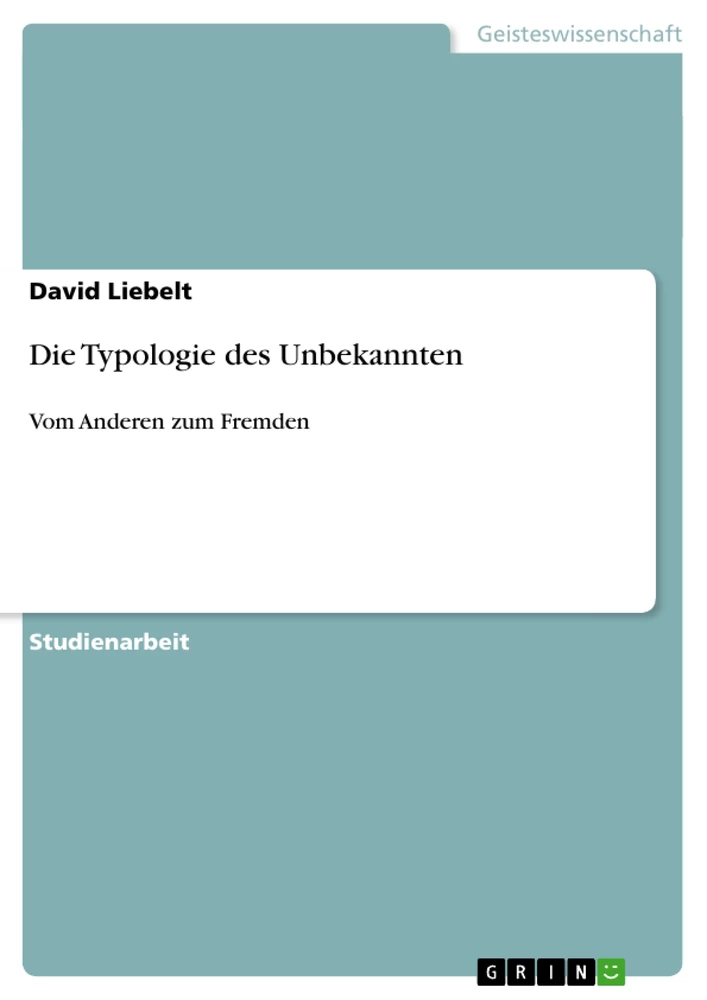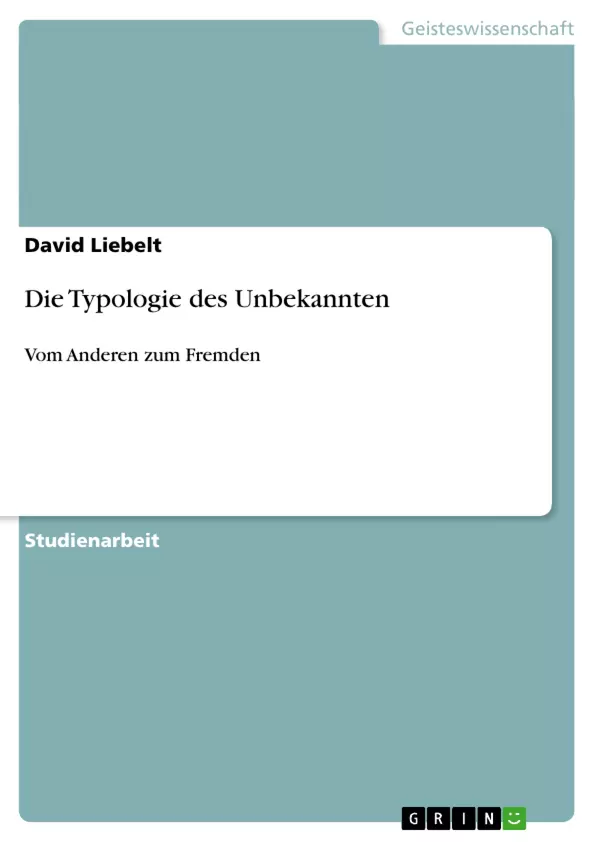Jede Gesellschaft, die ihren Teilnehmern als komplex, unübersichtlich und diffus erscheint, muss in ihren Fundamenten stets bedroht sein, da sie nicht verstanden, sondern in ihrer Struktur nur erahnt werden kann. Sicherlich, das Erahnen kann zur scheinbaren Sicherheit ‚aufgeplustert‘ und stetig verinnerlicht werden, - dies geschieht dann mittels Weltanschauungen, Ideologien oder Religionen, die mit ihrem normativen Absolutheitsanspruch nicht hinterfragbare Wahrheiten verkünden und damit eine ebenso nicht hinterfragte Gültigkeit aufweisen. Problematisch aber wird es, wenn Weltanschauungen wegfallen oder einfach nur kritische Fragen nach Wesensart und Gültigkeit scheinbar bekannter Sachverhalte gestellt werden – dann nämlich wird der Mangel an objektiver Klarheit einsichtig. Man frage etwa nach dem unbeschränkten Fundament einer zivilisatorischen Gesellschaft:
‚Warum darf ich nicht morden?‘
Pragmatisch kann diese Frage ohne weiteres geklärt werden – ein Pragmatismus, der jedoch nicht aus einer systematischen Grundlagen-Ethik resultiert, sondern eben nur aus einem Ethik-Konsens, der sich mit wandelnden Zeiten, Voraussetzungen und Mentalitäten schneller ändern könnte, als uns lieb ist. Und aus diesem latenten Gefühl schwammiger Ethik- und Zivilisationsfundamente resultiert ein ebenso latentes Gefühl ständiger Bedrohung. Darum auch versucht jede Gesellschaft aus der Abgrenzung zu anderen Gesellschaftsformen ihre eigene Identität zu gewinnen , und zwar derart, dass sie die ‚Anderen‘ offen oder verdeckt diskreditiert, um dadurch die eigene Lebens- und Organisationsform als gut und erfolgreich zu beschreiben. Interessant ist nun, dass die philosophische Perspektive eine Verschiebung von dem „Anderen“ zu dem „Fremden“ in Philosophie, Theologie, Sozialwissenschaften, Psychologie, außerdem Anthropologie und Ethnologie ebenso Sprachwissenschaft sowie in einer ganzen Reihe anderer wissenschaftlicher Disziplinen erfahren hat. Die Seminararbeit möchte nun anhand mehrerer Aufsätze den begriff- und philosophiegeschichtlichen Weg vom ‚Anderen‘ zum ‚Fremden‘ skizzieren. Die These soll dabei sein, dass es das ‚Fremde‘ vor Descartes nicht gab – wenn es auch bereits mancherlei Tendenzen zu ihm zu verzeichnen gibt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Das, Andere' in der Antike > Michael Krämer
- Israel
- Griechenland
- Rom
- III. Das, Andere' im Mittelalter > Franz Martin Wimmer
- Der Barbar
- Der Exote
- Der Heide
- Kurze Bilanz
- IV. Vom, Anderen' zum, Fremden'> Ralf Schlechtweg-Jahn
- authentischer Zugang > Objektivität
- systematisch-wissenschaftliche Teil > Methodik
- Kurze Bilanz
- V. Entdeckung der, Fremdheit > Descartes, Kant und Hegel
- VI. Vollendung der, Fremdheit > Waldenfels
- VII. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit setzt sich zum Ziel, den begriff- und philosophiegeschichtlichen Weg vom ‚Anderen' zum ‚Fremden' zu skizzieren. Dabei soll die These aufgestellt werden, dass es das ‚Fremde' vor Descartes nicht gab, wenn es auch bereits mancherlei Tendenzen dazu gab.
- Entwicklung des Begriffs ‚Fremder' in Philosophie, Theologie, Sozialwissenschaften und weiteren Disziplinen.
- Untersuchung der historischen Entwicklung des ‚Anderen' in der Antike und im Mittelalter.
- Analyse der Bedeutung des ‚Anderen' für die Konstruktion von Identität und Abgrenzung.
- Die Rolle des ‚Fremden' im Kontext der modernen Philosophie und Soziologie.
- Der Einfluss der ‚Fremdheit' auf gesellschaftliche und politische Prozesse.
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Die Einleitung stellt das Problem des ‚Fremden' als ein latentes Gefühl ständiger Bedrohung dar, das aus dem Mangel an objektiver Klarheit über die Fundamente einer zivilisatorischen Gesellschaft resultiert.
- II. Das ‚Andere' in der Antike > Michael Krämer: Dieses Kapitel argumentiert, dass das Problem des ‚Fremden' in der Antike und im Mittelalter nicht existierte, da die Welt des Einzelnen durch die begrenzten Erfahrungen des Dorflebens geprägt war. Das ‚Andere' wurde durch das Orientierungssystem ‚Mythos' oder ‚Religion' eingeordnet und als ‚Anderer' betrachtet, mit dem man sich arrangieren konnte.
- III. Das ‚Andere' im Mittelalter > Franz Martin Wimmer: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Erscheinungsformen des ‚Anderen' im Mittelalter, wie den ‚Barbar', den ‚Exoten' und den ‚Heiden'. Es wird die unterschiedliche Art der Begegnung mit dem ‚Anderen' in dieser Epoche beleuchtet.
- IV. Vom ‚Anderen' zum ‚Fremden' > Ralf Schlechtweg-Jahn: Dieses Kapitel behandelt den Übergang vom ‚Anderen' zum ‚Fremden' und die Entwicklung des ‚fremden' Blicks auf die Welt. Es werden die methodischen und epistemologischen Veränderungen dieser Transformation analysiert.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit den Begriffen ‚Anderer', ‚Fremder', ‚Identität', ‚Abgrenzung', ‚Kultur', ‚Religion', ‚Philosophie', ‚Geschichte', ‚Ethik' und ‚Soziologie'.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen dem "Anderen" und dem "Fremden"?
Die Arbeit skizziert den Weg vom "Anderen" (als Teil einer bekannten Ordnung) zum modernen Begriff des "Fremden", der erst mit der Subjektphilosophie an Bedeutung gewann.
Warum gab es das "Fremde" laut These erst nach Descartes?
Vor Descartes war die Welt durch Mythen und Religion geordnet; erst durch die methodische Trennung von Subjekt und Objekt entstand die philosophische Kategorie der Fremdheit.
Wie wurde das "Andere" in der Antike wahrgenommen?
In der Antike wurde das Andere oft durch religiöse oder mythische Systeme eingeordnet, mit denen man sich in einem begrenzten Erfahrungshorizont arrangierte.
Welche Rollen spielten "Barbaren" und "Heiden" im Mittelalter?
Diese Begriffe dienten als Kategorien des "Anderen", um die eigene christliche oder zivilisatorische Identität abzugrenzen.
Welchen Beitrag leistete Waldenfels zur Theorie der Fremdheit?
Bernhard Waldenfels gilt als Denker, der die Phänomenologie des Fremden vollendet hat, indem er die Unhintergehbarkeit der Fremderfahrung thematisierte.
- Quote paper
- David Liebelt (Author), 2007, Die Typologie des Unbekannten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90597