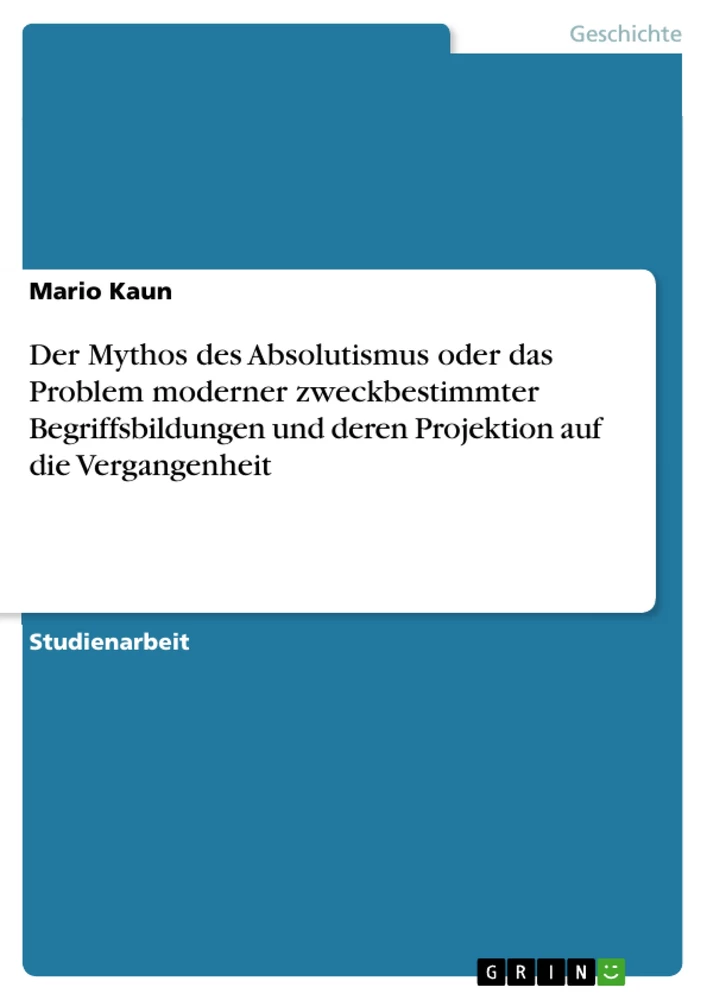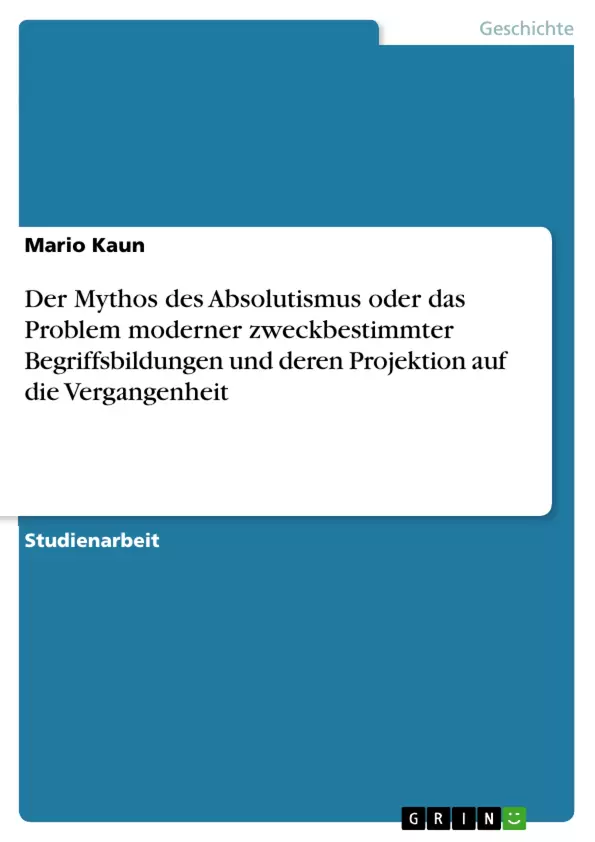Die Geschichtswissenschaft ringt seit ihrem Bestehen um Begriffe, die es ihr ermöglichen, die Vergangenheit (be)greifbarer zu machen. Die Forschung entwickelt(e) in einer peniblen Akribie Begriffe oder nutzt(e) bereits vorhandene, um einen Sachverhalt, um eine neue Erkenntnis oder auch um bereits Erforschtes zu kategorisieren. Dabei instrumentalisiert sie allzu oft moderne Begriffe und projiziert sie auf das jeweils zu erforschende Thema. Dies führt bisweilen zu problematischen Aussagen oder einem verklärten Geschichtsverständnis.
Das geschieht auch im Bezug auf die Frühe Neuzeit, die selbst ein Teil eines Periodisierungsversuches der Vergangenheit darstellt. So erstreckt sie sich etwa über einen Zeitraum von 1500 bis 1800 und wird von der Moderne abgelöst; doch wie werden die Menschen in 500 Jahren unsere jetzige Zeit kategorisieren, die wir als Moderne bezeichnen: Post-Moderne? Aber folgt auf die Post-Moderne, die Post-Post-Moderne? Oder kann ein Mensch behaupten, er würde in der Post-Moderne leben?
Gleichwohl tragen diese Probleme dazu bei, dass auch der Geschichtsunterricht, beginnend mit der ersten Stunde, oftmals ein verzerrtes Bild eines Sachverhaltes in die Köpfe der Schüler überträgt. Leider fanden und finden die neueren Forschungen, die sich kritisch mit teleologischen Begriffsbildungen auseinandersetzen, bisher in keiner Weise Einzug in den Rahmenlehrplan des Landes Brandenburg. Das ist eine Herausforderung, welche durch die Lehrerschaft gemeistert werden könnte - vielleicht angeregt durch diesen Artikel. Denn den Schülerinnen und Schülern kann somit die Möglichkeit geboten werden, einen neuen oder auch weiteren Ansatz kennenzulernen im kritischen Umgang mit den modernen Begrifflichkeiten zur Beschreibung der Vergangenheit.
Inhaltsverzeichnis
- Didaktisch-methodische Überlegungen
- Die Bedeutung des Themas - die Erkenntnisstruktur
- Lernziele
- Sachinformationen
- ,,Absolutismus“
- ,,Aufgeklärter Absolutismus“
- ,,Aufklärung“
- Periodisierungen
- Namenszusätze
- Länderbezeichnungen ….....
- Weitere Unschärfen
- Material
- Aufgaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert das Problem der zweckbestimmten Begriffsbildung in der Geschichtswissenschaft, insbesondere im Kontext des Absolutismus. Die Arbeit beleuchtet, wie moderne Konzepte und Begriffe auf die Vergangenheit projiziert werden, was zu einem verzerrten Geschichtsbild führen kann.
- Die Gefahren der Projektion moderner Begriffe auf historische Sachverhalte
- Die problematische Anwendung von Begriffen wie "Absolutismus" und "Aufklärung" auf die Frühe Neuzeit
- Die Bedeutung des kritischen Umgangs mit Begriffen im Geschichtsunterricht
- Die Förderung von Sensibilität bei Schülerinnen und Schülern im Umgang mit historischen Begriffen
- Alternative Vorschläge zur Beschreibung historischer Phänomene
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich didaktisch-methodischen Überlegungen zum Thema. Es beleuchtet die Bedeutung des Themas, die Erkenntnisstruktur und definiert die Lernziele für Schülerinnen und Schüler.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Erläuterung von Sachinformationen zu Begriffen wie "Absolutismus", "Aufgeklärter Absolutismus" und "Aufklärung". Es behandelt außerdem Periodisierungen, Namenszusätze, Länderbezeichnungen und weitere Unschärfen in der Begrifflichkeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der zweckbestimmten Begriffsbildung, des Absolutismus, der Aufklärung, der historischen Periodisierung und dem kritischen Umgang mit Begriffen im Geschichtsunterricht. Dabei werden insbesondere die Problematiken der Projektion moderner Begriffe auf die Vergangenheit und die Notwendigkeit eines sensiblen und reflektierten Geschichtsverständnisses hervorgehoben.
- Citar trabajo
- Mario Kaun (Autor), 2007, Der Mythos des Absolutismus oder das Problem moderner zweckbestimmter Begriffsbildungen und deren Projektion auf die Vergangenheit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90605