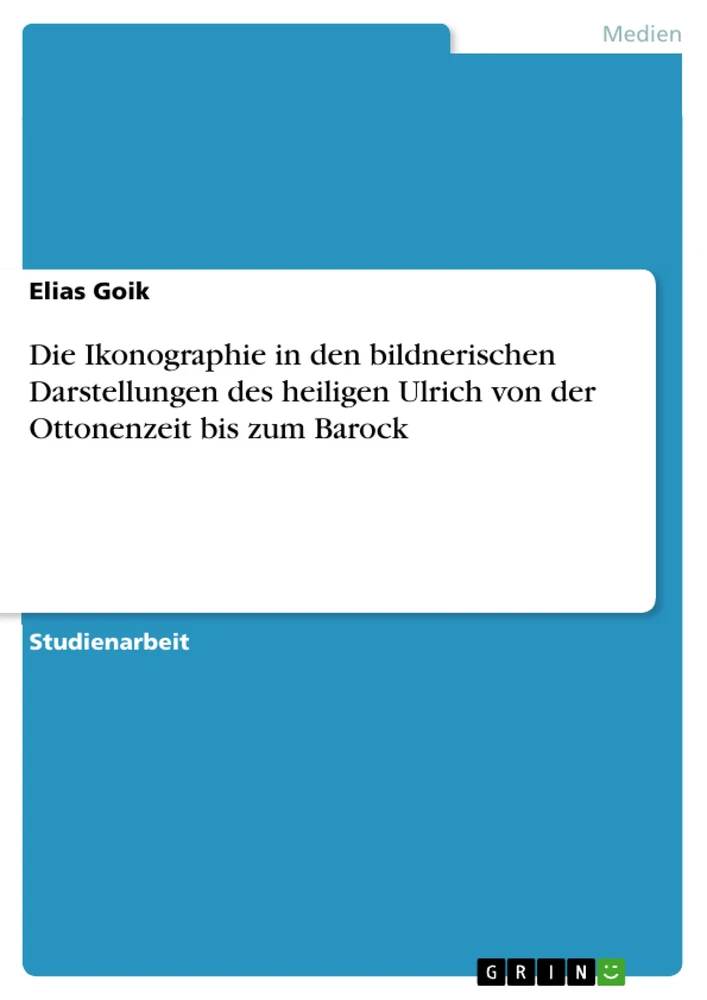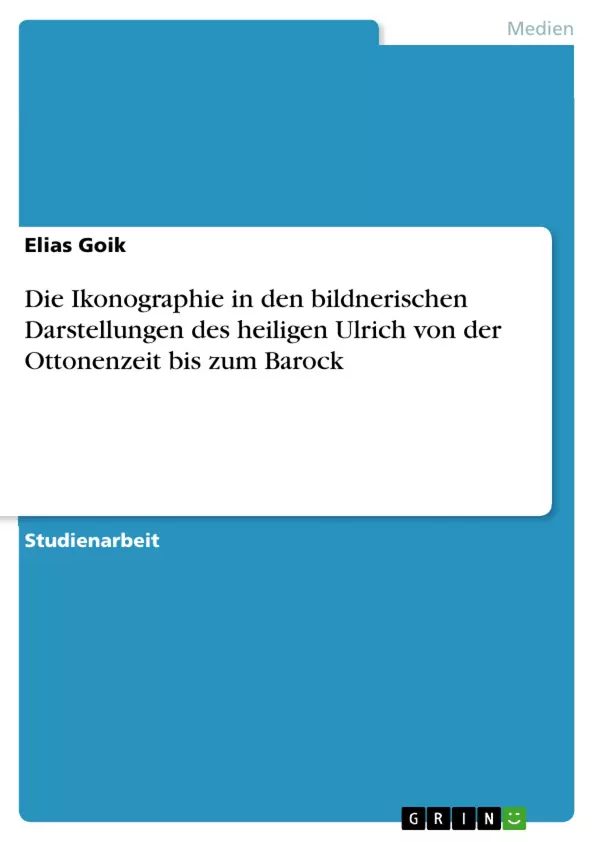Das Thema dieser Arbeit wird aufgebaut vor dem Hintergrund der Vielzahl der Ulrichsdarstellungen, die sich über das Augsburger Bistumsgebiet hinaus ab dem Mittelalter verbreiteten. Hierbei variierte das Bildnis des Heiligen über mehrere Epochen. Die zu bearbeitende Fragestellung soll daher lauten, ob und inwiefern sich die Ikonographie in den Abbildungen bzw. bildnerischen Darstellungen des Heiligen Ulrich von der Ottonenzeit bis zum Barock verändert hat. Dies gilt es im nachfolgenden Text zu untersuchen.
Als Hauptliteratur und ausschlaggebendes Werk dient die von Manfred Weitlauff herausgegebene Festschrift mit dem Titel "Bischof Ulrich von Augsburg 890–973". Auch der Vortrag von Norbert Lieb bei einer Tagung der Katholischen Akademie Augsburg am 12. Mai 1973 wird genauer in die Untersuchung einbezogen. Die Person des heiligen Ulrichs in der Kunst ist neben seinen geschichtlichen Hintergründen wie zum Beispiel seiner Rolle in der Lechfeldschlacht ein vielfacher Gegenstand der Forschungsliteratur.
Zudem wird die erste und ursprüngliche Quelle über das Leben und Wirken Bischof Ulrichs (die Ulrichsvita des Domprobstes Gerhard von Augsburg) an ausgewählter Stelle zitiert. Zuerst soll die geschichtliche Gestalt Ulrichs als Grundlage für die weitere Untersuchung kurz hervorgehoben werden, um darauf aufbauend anhand von drei Bildwerken des Augsburger Oberhirten die Entwicklung seiner Ikonographie zu verdeutlichen. Am Ende sollen in einer Schlussbemerkung noch einige zusammenfassende Worte gefunden werden, um mit dem Ergebnis der Arbeit abzuschließen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DER HISTORISCHE ULRICH UND SEINE HEILIGSPRECHUNG
- DAS ERSTE BILDNIS DES HEILIGEN ULRICH
- BILDBESCHREIBUNG
- IKONOGRAPHIE
- DER HEILIGE ULRICH IN DER SPÄTGOTISCHEN KUNST
- BILDBESCHREIBUNG
- IKONOGRAPHIE
- DES HEILIGE ULRICH AUF EINEM DECKENFRESKO DES BAROCK
- BILDBESCHREIBUNG
- IKONOGRAPHIE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Ikonographie in bildnerischen Darstellungen des heiligen Ulrich von Augsburg, beginnend mit der Ottonenzeit bis zum Barock. Sie analysiert, ob und wie sich die Ikonographie des Heiligen in verschiedenen Epochen verändert hat. Die Hauptliteratur ist die Festschrift "Bischof Ulrich von Augsburg 890-973" herausgegeben von Manfred Weitlauff. Die Untersuchung bezieht auch den Vortrag von Norbert Lieb bei einer Tagung der Katholischen Akademie Augsburg ein. Neben den geschichtlichen Hintergründen des Heiligen, wie z. B. seine Rolle in der Lechfeldschlacht, wird die Ulrichsvita des Domprobstes Gerhard von Augsburg an ausgewählten Stellen zitiert.
- Die Entwicklung der Ikonographie des heiligen Ulrich von der Ottonenzeit bis zum Barock
- Die Darstellung des Heiligen als geistiger Mitträger des Königtums
- Die Verklärung der historischen Gestalt des Heiligen in der Spätgotik
- Die Verbindung von historischer Gestalt und volkstümlicher Legende
- Die Transformation des Heiligen zum "miles christianus" im Barock
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt den historischen Ulrich von Augsburg vor, beleuchtet seine Rolle als Bischof und seine Heiligsprechung. Es beleuchtet die Ulrichsvita des Domprobstes Gerhard von Augsburg und die Bedeutung dieser Quelle für die Forschung. Im zweiten Kapitel wird das erste bekannte Bildnis des Heiligen im Sakramentar Heinrichs II. analysiert, die Krönung des Königs durch Christus. Die Ikonographie des Bildes spiegelt die politische Situation des Mittelalters wider und betont die göttliche Legitimität Heinrichs II. als Herrscher. Das dritte Kapitel widmet sich der Darstellung des Heiligen in der spätgotischen Kunst. Es analysiert die Ulrichstafel des Augsburger Malers Hans Burgkmair und beleuchtet den Wandel des Ulrichs-Bildes in der Kunst. Ulrichs Attribute, wie der Fisch, werden in ihrer Bedeutung im Kontext der zeitgenössischen Volksfrömmigkeit erklärt. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit dem Deckenfresko des Barock, das die Lechfeldschlacht als zentrales Motiv darstellt. Die Ikonographie des Freskos zeigt Ulrich als triumphierenden "miles christianus", der das Siegeskreuz von einem Engel überreicht bekommt. Es beleuchtet den Zusammenhang zwischen dem historischen Ereignis und der heilsgeschichtlichen Interpretation der Schlacht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Ikonographie, Heiligengestalt, Ulrich von Augsburg, Ottonenzeit, Spätgotik, Barock, Lechfeldschlacht, Ulrichsvita, Wasserpatron, "miles christianus", Kunstgeschichte, Kulturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Darstellung des heiligen Ulrich über die Zeit verändert?
Die Ikonographie wandelte sich von der Darstellung als geistiger Mitträger des Königtums in der Ottonenzeit über eine volkstümliche Verklärung in der Spätgotik bis hin zum triumphierenden „miles christianus“ im Barock.
Was ist das bekannteste Attribut des heiligen Ulrich?
Der Fisch ist das zentrale Attribut, das in der spätgotischen Kunst oft im Zusammenhang mit Legenden der Volksfrömmigkeit dargestellt wurde.
Welche historische Schlacht ist eng mit Ulrich verbunden?
Die Lechfeldschlacht (955 n. Chr.), in der Ulrich eine entscheidende Rolle bei der Verteidigung Augsburgs gegen die Ungarn spielte.
Was zeigt das barocke Deckenfresko in der Untersuchung?
Es stellt Ulrich als christlichen Ritter („miles christianus“) dar, der während der Lechfeldschlacht ein Siegeskreuz von einem Engel erhält.
Welche schriftliche Quelle ist grundlegend für das Bild Ulrichs?
Die Ulrichsvita des Domprobstes Gerhard von Augsburg ist die ursprüngliche Quelle über sein Leben und Wirken.
Warum wurde Ulrich als „Wasserpatron“ bezeichnet?
Aufgrund seiner Attribute und Legenden galt er im Volksglauben oft als Schutzpatron im Zusammenhang mit Wasser und Fischen.
- Citation du texte
- Elias Goik (Auteur), 2019, Die Ikonographie in den bildnerischen Darstellungen des heiligen Ulrich von der Ottonenzeit bis zum Barock, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/906227