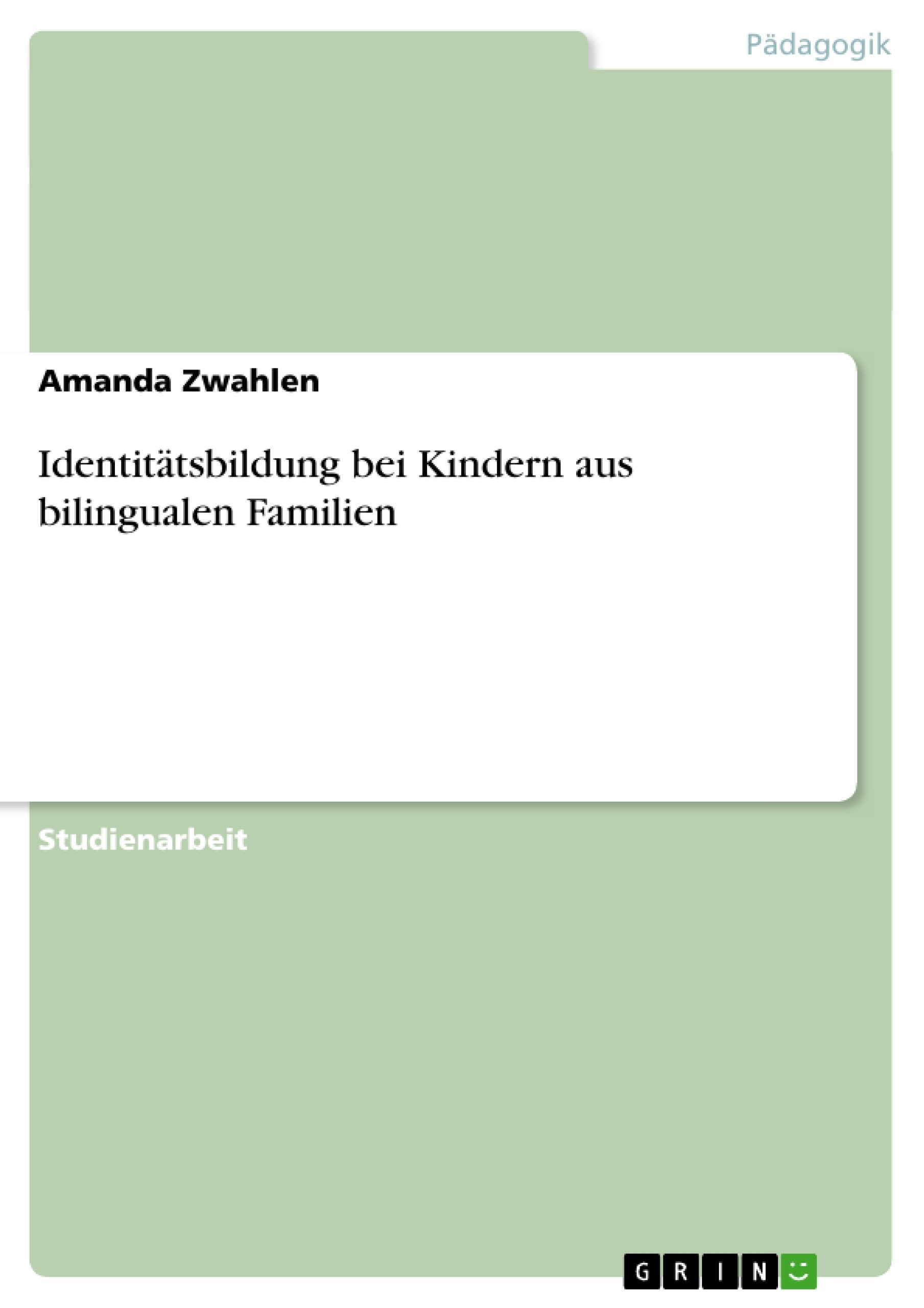Entlang von Sprachgrenzen hat es schon immer bilinguale Ehen gegeben, und somit auch zweisprachig aufwachsende Kinder. Im heutigen Zeitalter der zunehmenden Mobilität, der weltweiten Migrationsbewegungen und weltumspannenden Kommunikation steigt die Zahl der bilingualen, binationalen und bikulturellen Eheschliessungen. So leben gegenwärtigen Schätzungen zufolge in der Bundesrepublik sieben Millionen Familien, deren Mitglieder einen unterschiedlichen kulturellen, ethnischen und damit auch sprachlichen Hintergrund haben. Diese Zahl ist tendenziell immer noch steigend, und somit steigt auch die Anzahl der Kinder, die in einer zweisprachigen und bikulturellen Situation aufwachsen. In der vorliegenden Arbeit wird die Frage behandelt, inwiefern der bilinguale familiäre Hintergrund die Identitätsbildung von Kindern oder Jugendlichen beeinflusst, und zwar von Kindern und Jugendlichen, die von Geburt an zwei verschiedenen Sprachen ausgesetzt sind. Im Folgenden wird die Frage behandelt werden, inwiefern der bilinguale familiäre Hintergrund die Identitätsbildung von Kindern oder Jugendlichen beeinflusst, und zwar von Kindern und Jugendlichen, die von Geburt an zwei verschiedenen Sprachen ausgesetzt sind, deren Eltern also zwei verschiedene Muttersprachen besitzen. Dabei wird es unumgänglich sein, dem Begriff der Kultur und der kulturellen Zugehörigkeit ein grosses Gewicht beizumessen, heisst doch bilingual aufwachsen auch bikulturell aufwachsen. Es ist zwar möglich, in einer bikulturellen Situation monolingual aufzuwachsen, so beispielsweise wenn beide Elternteile Spanisch sprechen, die Mutter aber Spanierin und der Vater Chilene ist, aber es ist unter den obengenannter Voraussetzungen nicht möglich, dass ein Kind zweisprachig in einer monokulturellen familiären Umgebung aufwächst. Sprache ist Ausdrucksmittel und wichtiges Merkmal einer Kultur, und ich behaupte, dass sich „Kulturgrenzen“ eher an Sprach- als an politische Grenzen halten, man denke an das Beispiel der Kurden, aber auch an das Beispiel Schweiz: bei eidgenössischen Abstimmungen klaffen die Resultate oft in frappierender Weise entlang der Sprachgrenze zwischen französisch- und deutschsprechender Schweiz auseinander, und es ist sicherlich nicht an den Haaren herbeigezogen, dies als Ausdruck von zwei verschiedenen Kulturen zu werten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 FRAGESTELLUNG UND THEMENEINGRENZUNG
- 3 DEFINITIONEN WICHTIGER GRUNDBEGRIFFE
- 3.1 Identität
- 3.2 Soziale Identität
- 3.3 Kulturelle Identität
- 3.4 Ethnische Identität
- 3.5 Zweisprachigkeit, Bilingualität
- 3.6 Arbeitsdefinitionen
- 4 BILINGUALITÄT ALS BÜRDE
- 4.1 Die Sapir-Whorf-Hypothese
- 4.2 Frühe Zweisprachigkeit als pathologische Erscheinung
- 4.3 Politisierung kultureller Unterschiede
- 5 IDENTITÄT ZWISCHEN ZWEI KULTUREN – BÜRDE UND CHANCE
- 5.1 Identitätsbildung in modernen Gesellschaften
- 5.2 Bi-Identität
- 5.3 Schwierigkeiten bei der Bildung einer bikulturellen Identität
- 6 BILINGUALITÄT ALS CHANCE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern die bilinguale familiäre Umgebung die Identitätsbildung von Kindern und Jugendlichen beeinflusst. Dabei wird der Fokus auf Kinder gelegt, die von Geburt an zwei verschiedenen Sprachen ausgesetzt sind und deren Eltern zwei verschiedene Muttersprachen besitzen. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der zweisprachigen und bikulturellen Situation auf die Identitätsentwicklung und stellt die Frage, ob die Zugehörigkeit zu zwei Sprach- und Kulturgruppen zu „split personalities“ oder Identitätskonflikten führt.
- Identitätsentwicklung in bilingualen Familien
- Einfluss von Sprache und Kultur auf die Identitätsbildung
- Herausforderungen und Chancen der bikulturellen Identität
- Theorien zur Identitätsentwicklung in multikulturellen Kontexten
- Bilingualität als Chance oder Bürde?
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas bilinguale Identitätsbildung in der heutigen Zeit heraus und führt in die Fragestellung der Arbeit ein.
- Kapitel 2: Fragestellung und Themeneingrenzung: In diesem Kapitel wird die Forschungsfrage präzisiert und der Themenbereich der Arbeit abgegrenzt. Die Arbeit fokussiert auf die Identitätsbildung von Kindern, die von Geburt an zwei Sprachen lernen und deren Eltern aus unterschiedlichen Kulturen stammen.
- Kapitel 3: Definitionen wichtiger Grundbegriffe: Dieses Kapitel erläutert zentrale Begriffe wie Identität, soziale Identität, kulturelle Identität, ethnische Identität, Zweisprachigkeit und Bilingualität. Es werden verschiedene Definitionen und Perspektiven auf diese Begriffe vorgestellt.
- Kapitel 4: Bilingualität als Bürde: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Theorien, die die Bilingualität als einen negativen Faktor für die Identitätsentwicklung betrachten. Es werden die Sapir-Whorf-Hypothese, frühe Zweisprachigkeit als pathologische Erscheinung und die Politisierung kultureller Unterschiede diskutiert.
- Kapitel 5: Identität zwischen zwei Kulturen – Bürde und Chance: Dieses Kapitel betrachtet die Bilingualität und die bikulturelle Identität als sowohl Chance als auch Herausforderung. Es werden die Identitätsbildung in modernen Gesellschaften, das Konzept der Bi-Identität und Schwierigkeiten bei der Bildung einer bikulturellen Identität beleuchtet.
- Kapitel 6: Bilingualität als Chance: Dieses Kapitel präsentiert Argumente, die die Bilingualität als eine positive Kraft für die Identitätsentwicklung und die gesellschaftliche Integration sehen.
Schlüsselwörter
Identitätsbildung, Bilingualität, bikulturelle Identität, Sprachentwicklung, Kultur, Interkulturelle Kommunikation, Identitätskonflikt, „split personality“, Identitätsdiffusion, Zusammenstosstheorie, Weltoffenheit, Toleranz, Kulturunterschiede, Sozialisation, Familie, Schule, Gesellschaft, Empirische Forschung.
- Arbeit zitieren
- M.A. Amanda Zwahlen (Autor:in), 2001, Identitätsbildung bei Kindern aus bilingualen Familien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90662