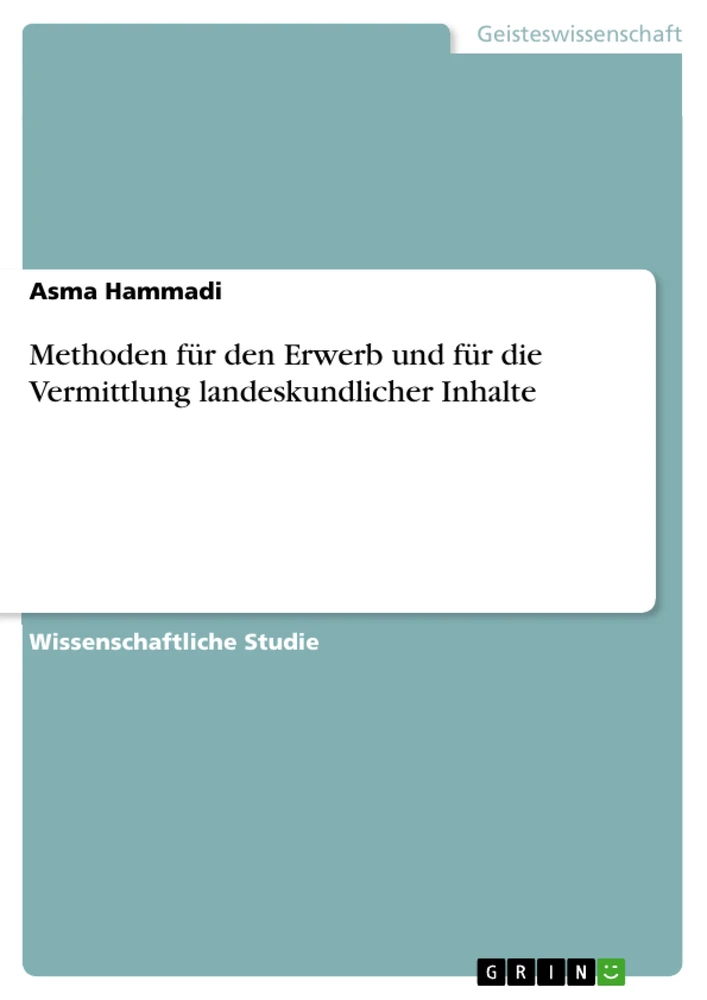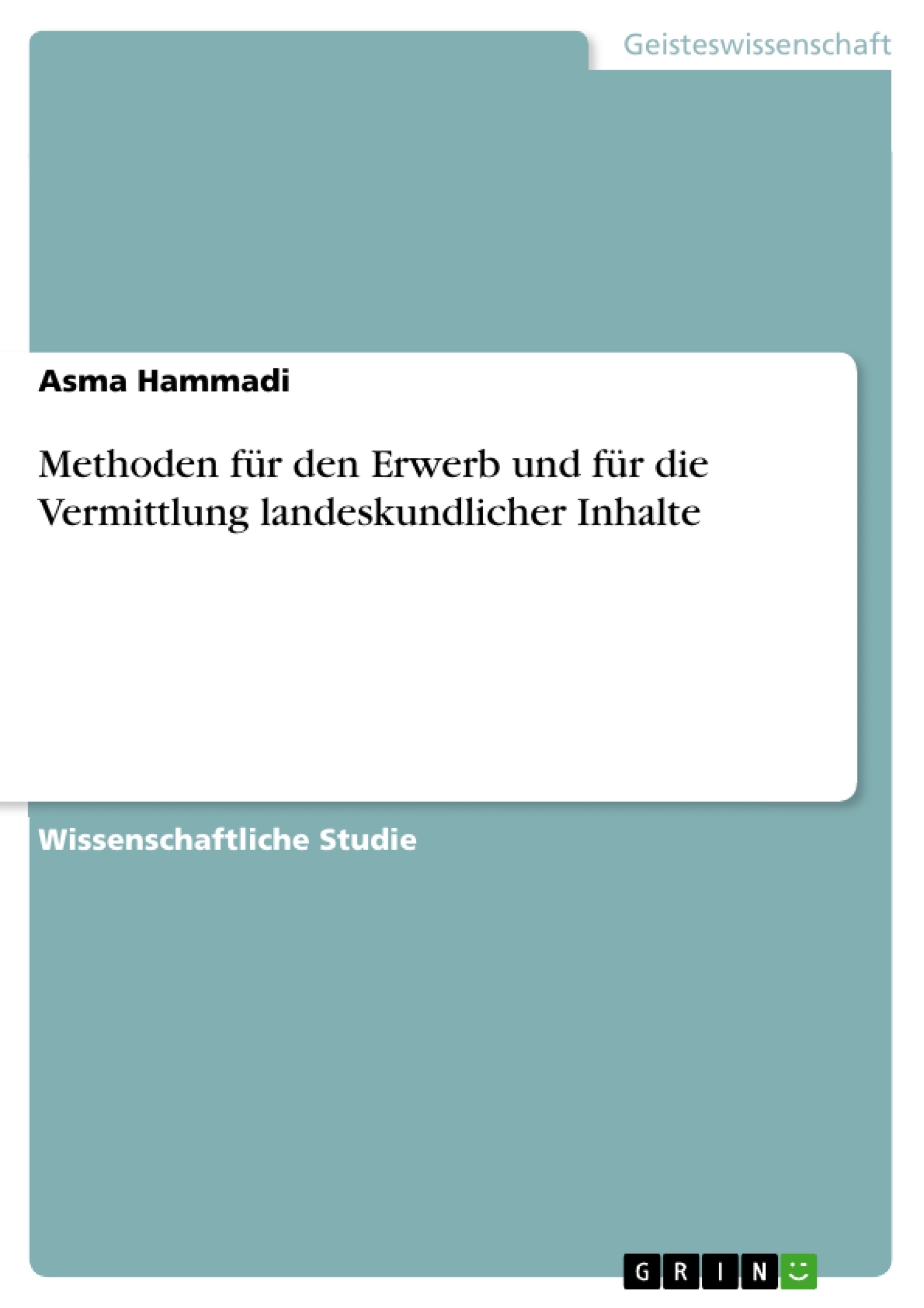Die Aufgabe dieser Arbeit war, zu bestimmen, welche Methoden für den Erwerb und für die Vermittlung landeskundlicher Inhalte benutzbar sind. Der landeskundliche Unterricht legt einen bedeutenden Wert auf den Vergleich, dadurch wird der Lernende die eigenen Erscheinungen mit der eigenen Lebenswelt gegenüberstellen. Die Projektarbeit ist eine wichtige Methode eines handlungsorientierten Unterrichts für interkulturelle Landeskunde neben anderen Methoden und Formen zu verstehen.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich also mit der Bedeutung der Vielfalt in der Vermittlung von Fremdsprachen und insbesondere mit den Methoden zur Erwerbung landeskundlicher Inhalte. Sie stützt sich auf die Erkenntnisse des Beirats "Deutsch als Fremdsprache" des Goethe-Instituts und betont die Notwendigkeit einer systematischen und reflektierten Herangehensweise bei der Anwendung unterschiedlicher Lehrmethoden. Es wird die Berücksichtigung der individuellen Lehr- und Lernvoraussetzungen sowie die Integration des heutigen Wissens über spezifische Vermittlungskontexte betont. Dabei wird auf Qualitäten wie Kreativität, Kognitivität, Interkulturalität und Autonomie der Lernenden hingewiesen, die in den Unterricht einbezogen werden sollten.
Ein zentraler Aspekt ist die Notwendigkeit eines kommunikativ ausgerichteten Fremdsprachenunterrichts, der diese Qualitäten der Lernenden berücksichtigt. Dieser Ansatz ermöglicht es den Lernenden, sich aktiv am Spracherwerb und am kulturellen Verständnis zu beteiligen.
Die landeskundliche Methodik im Sprachunterricht wird als wichtiger Ansatzpunkt betrachtet, um die genannten Qualitäten der Lernenden zu fördern. Dabei werden Prinzipien wie die Differenziertheit der Darbietung, die Vielseitigkeit des inhaltlichen Angebots, der Vergleich unterschiedlicher Sachverhalte und der gezielte Einsatz der Muttersprache hervorgehoben.
Insgesamt betont die Arbeit die Bedeutung der Vielfalt und des Vergleichs im Fremdsprachenunterricht, um die Lernenden in ihrer Entwicklung von Kreativität, Kognitivität, Interkulturalität und Autonomie zu unterstützen. Die Berücksichtigung dieser Prinzipien trägt zur umfassenden Vermittlung von Fremdsprachen und landeskundlichem Wissen bei.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Vergleich im Landeskundeunterricht
- Handlungs- und erfahrungsorientiertes Lernverfahren
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht geeignete Methoden zum Erwerb und zur Vermittlung landeskundlicher Inhalte im Sprachunterricht. Sie analysiert die Rolle des Vergleichs im Landeskundeunterricht und beleuchtet verschiedene methodische Prinzipien für die landeskundliche Arbeit.
- Methoden des Landeskundeunterrichts
- Der Vergleich als methodisches Prinzip
- Vielfalt im Informationsmaterial und in der Meinungsdarstellung
- Der gezielte Einsatz der Muttersprache
- Kulturvergleich und seine verschiedenen Typen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Ausgangspunkt der Arbeit: die Notwendigkeit einer eigenständigen landeskundlichen Methodik, die lernerspezifische Qualitäten wie Kreativität, Kognitivität, Interkulturalität und Autonomie berücksichtigt. Sie basiert auf der These, dass ein kommunikativ ausgelegter Fremdsprachenunterricht diese Faktoren nicht außer Acht lassen darf. Die Arbeit zielt darauf ab, geeignete Methoden für den Erwerb und die Vermittlung landeskundlicher Inhalte zu bestimmen und bezieht sich auf die methodischen Prinzipien von Erdmenger (Differenziertheit, Vielseitigkeit, Vergleich, gezielter Einsatz der Muttersprache).
Der Vergleich im Landeskundeunterricht: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Vergleich" und beschreibt seine Bedeutung im Landeskundeunterricht. Es werden verschiedene Ansätze zum Vergleich von Kulturen vorgestellt, inklusive der Arbeiten von Pauldrach (Identifizieren, Differenzieren, Komparation) und Müller-Jacquier (sechs Typen von Kulturvergleichen: Adordination, gegensätzliche Inhalte, graduelle Differenz, Negation, Existieren, Meta-Vergleich). Das Kapitel betont die Notwendigkeit eines bewussten Vergleichs, der Stereotypen vorbeugt und die Entwicklung des sprachlichen Wissens fördert. Die Bedeutung des Vergleichs wird sowohl im Kontext des Landeskundeunterrichts als auch in anderen Disziplinen wie der Politologie und Soziologie hervorgehoben. Es wird kritisch auf die Gefahr eines oberflächlichen Vergleichs hingewiesen, der zu stereotypen Vorstellungen führen kann.
Schlüsselwörter
Landeskundeunterricht, Methoden, Vergleich, Kulturvergleich, Interkulturalität, Fremdsprachenvermittlung, Methodische Prinzipien, Stereotypenvermeidung, Muttersprache, Lernerspezifische Qualitäten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Methoden des Landeskundeunterrichts"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht geeignete Methoden zum Erwerb und zur Vermittlung landeskundlicher Inhalte im Sprachunterricht. Ein Schwerpunkt liegt auf der Rolle des Vergleichs im Landeskundeunterricht und der Analyse verschiedener methodischer Prinzipien.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Methoden des Landeskundeunterrichts, den Vergleich als methodisches Prinzip, die Vielfalt im Informationsmaterial und in der Meinungsdarstellung, den gezielten Einsatz der Muttersprache und verschiedene Typen des Kulturvergleichs. Sie bezieht sich auf die methodischen Prinzipien von Erdmenger (Differenziertheit, Vielseitigkeit, Vergleich, gezielter Einsatz der Muttersprache).
Wie wird der Vergleich im Landeskundeunterricht definiert und eingesetzt?
Das Kapitel "Der Vergleich im Landeskundeunterricht" definiert den Begriff "Vergleich" und beschreibt seine Bedeutung. Es werden verschiedene Ansätze vorgestellt, inklusive der Arbeiten von Pauldrach (Identifizieren, Differenzieren, Komparation) und Müller-Jacquier (sechs Typen von Kulturvergleichen). Die Notwendigkeit eines bewussten Vergleichs zur Stereotypenvermeidung und Förderung des sprachlichen Wissens wird betont. Der Vergleich wird im Kontext des Landeskundeunterrichts und anderer Disziplinen (Politologie, Soziologie) betrachtet. Die Gefahr eines oberflächlichen Vergleichs wird kritisch beleuchtet.
Welche methodischen Prinzipien werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt die methodischen Prinzipien von Erdmenger: Differenziertheit, Vielseitigkeit, Vergleich und gezielter Einsatz der Muttersprache. Darüber hinaus werden lernerspezifische Qualitäten wie Kreativität, Kognitivität, Interkulturalität und Autonomie berücksichtigt.
Welche Lernziele werden angestrebt?
Die Arbeit zielt darauf ab, geeignete Methoden für den Erwerb und die Vermittlung landeskundlicher Inhalte zu bestimmen und einen kommunikativ ausgelegten Fremdsprachenunterricht zu fördern, der lernerspezifische Qualitäten berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Landeskundeunterricht, Methoden, Vergleich, Kulturvergleich, Interkulturalität, Fremdsprachenvermittlung, Methodische Prinzipien, Stereotypenvermeidung, Muttersprache, Lernerspezifische Qualitäten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zum Vergleich im Landeskundeunterricht, ein Kapitel zu handlungs- und erfahrungsorientierten Lernverfahren und einen Schluss.
Wie wird die Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beschreibt den Ausgangspunkt der Arbeit: die Notwendigkeit einer eigenständigen landeskundlichen Methodik, die lernerspezifische Qualitäten berücksichtigt. Sie basiert auf der These, dass ein kommunikativ ausgelegter Fremdsprachenunterricht diese Faktoren nicht außer Acht lassen darf.
- Quote paper
- Asma Hammadi (Author), 2018, Methoden für den Erwerb und für die Vermittlung landeskundlicher Inhalte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/906801