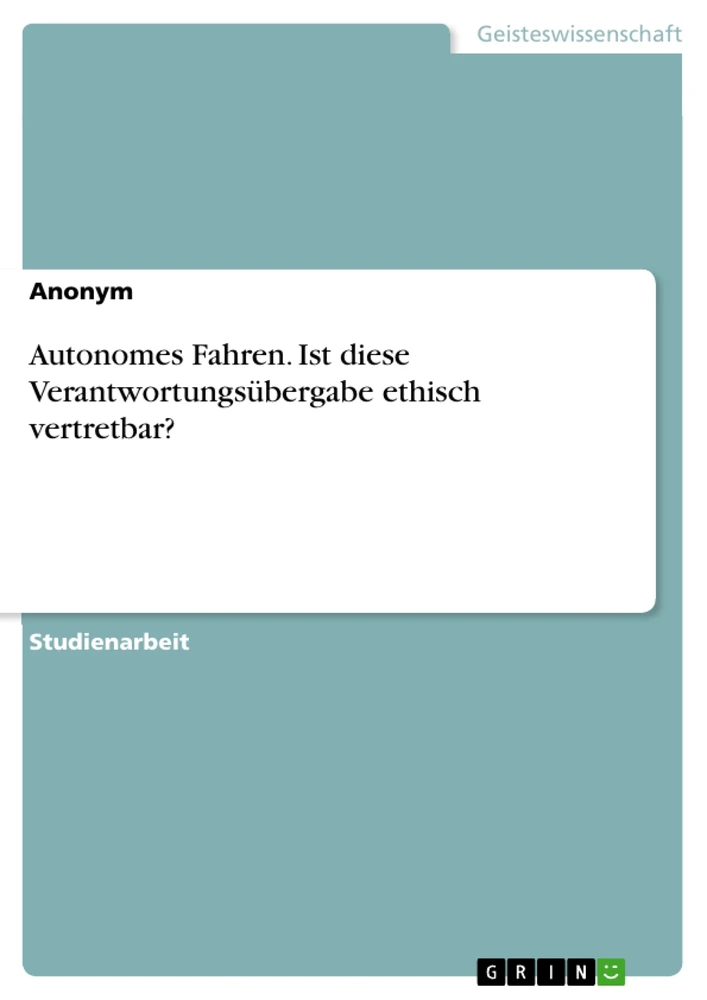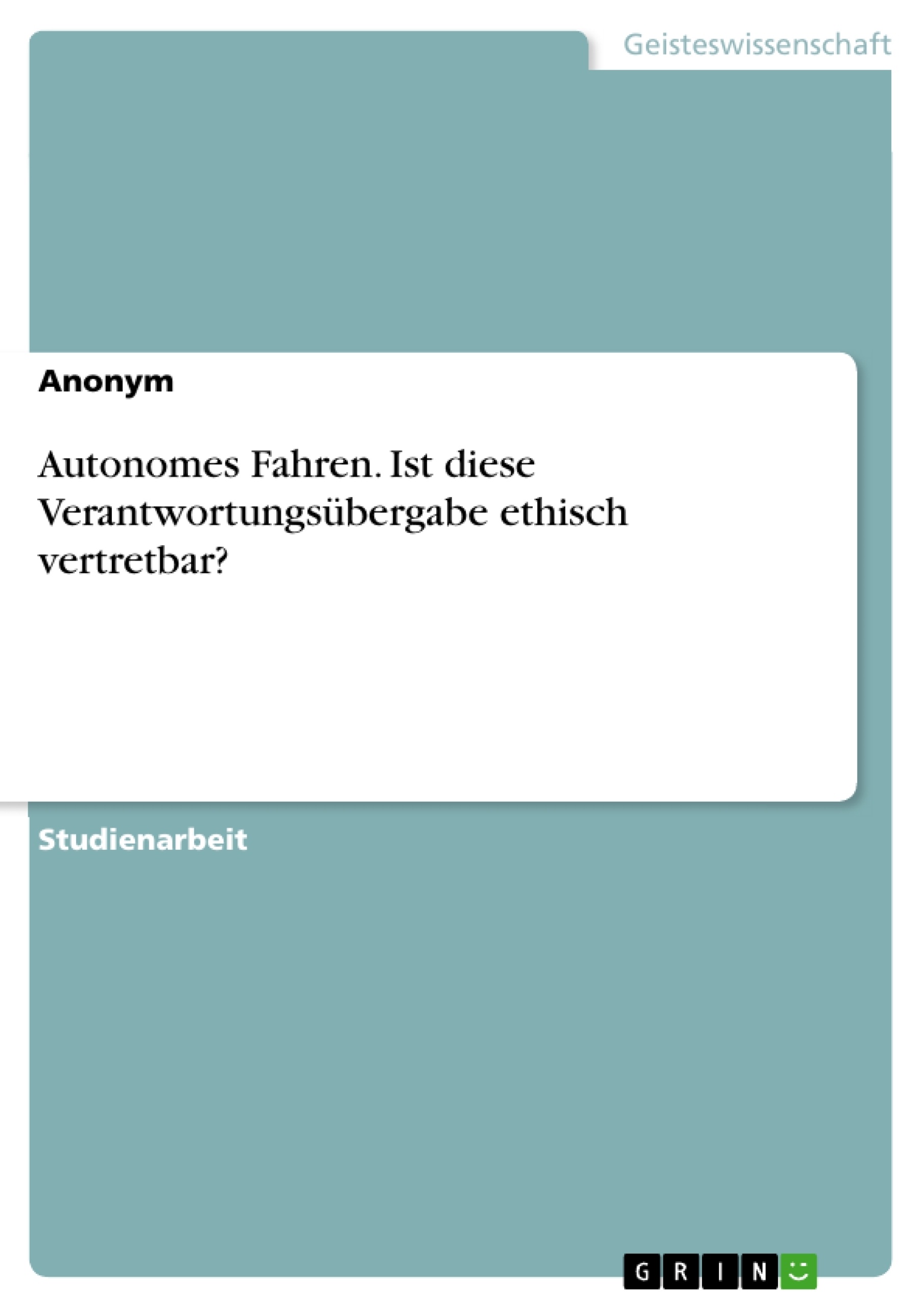Sowohl in Büchern als auch in Filmen wie „Blade Runner“ oder „Westworld“ scheint die Künstliche Intelligenz ein faszinierendes Thema zu sein. Einige dieser Ideen, die früher für absurd gehalten wurden, sind heute teilweise Realität. So konnte dank der neuen Entwicklungen künstlicher Intelligenz auch die Idee des autonomen Fahrens realisiert werden. Künstliche Intelligenz nimmt stetig mehr Raum in der Gesellschaft ein, weshalb es von großer Bedeutung ist sich mit diesen Themen auseinander zu setzen. So veröffentlichten die Fürther Nachrichten kürzlich eine Artikelserie über Künstliche Intelligenz, die unter anderem auch auf das autonome Fahren aufmerksam machte. Neben positiven Stimmen, wie die von Sabine Pfeiffer, einer Erlanger Soziologin, die viele Chancen in derartigen Entwicklungen sieht, ertönen auch kritische Stimmen, die sich unter anderem auf Testergebnisse stützen, in denen Forscher feststellten das autonome Autos bei Testfahrten Straßenschilder, die mit Grafitti oder Aufklebern verziert waren, nicht erkannten (Husarek, 2019). Die Thematik des Autonomen Fahrens brachte zahlreiche Debatten ins Rollen, die über Schuldfragen, rechtliche, als auch ethische Fragen diskutieren. Denn klar ist, dass im Zeitalter der Digitalisierung Verantwortungsfragen eine stetig größere Rolle einnehmen.
Im Rahmen dieser Hausarbeit soll versucht werden die Frage, ob die Übergabe von Verantwortung an autonome Fahrzeuge ethisch vertretbar ist, zu klären. Dafür wird zunächst der Begriff des autonomen Fahrens näher erläutert. Anschließend wird für ein allgemeines Grundverständnis die rechtliche Perspektive aufgezeigt. Danach wird die Frage nach der Verantwortungsübergabe ethisch diskutiert. Dabei wird sowohl auf die Frage der Programmierung ethischer Prinzipien als auch auf die Verantwortung der Menschenwürde eingegangen. Abschließend folgt ein Fazit, welches diese Arbeit abrunden soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Autonomes Fahren
- Juristische Perspektive
- Deutscher Rechtsrahmen
- Haftung
- Autonomes Fahren im Diskurs der Angewandten Ethik
- Programmierung ethischer Prinzipien
- Autonomes Fahren und Verantwortung der Menschenwürde
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der ethischen Vertretbarkeit der Übergabe von Verantwortung an autonome Fahrzeuge. Dabei soll zunächst das Konzept des autonomen Fahrens erläutert und die rechtliche Perspektive beleuchtet werden. Im Anschluss wird die ethische Dimension der Verantwortungsübergabe im Kontext der Programmierung ethischer Prinzipien und der Verantwortung der Menschenwürde diskutiert.
- Autonomes Fahren: Definition und technische Entwicklung
- Juristische Aspekte: Deutscher Rechtsrahmen und Haftungsfragen
- Ethische Aspekte: Programmierung ethischer Prinzipien
- Verantwortung der Menschenwürde im Kontext des autonomen Fahrens
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema des autonomen Fahrens in den Kontext der Entwicklung Künstlicher Intelligenz und thematisiert die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen. Sie führt in die Problemstellung der Verantwortungsübergabe an autonome Fahrzeuge ein und skizziert den Aufbau der Hausarbeit.
Autonomes Fahren
Dieses Kapitel erläutert den Begriff des autonomen Fahrens und differenziert zwischen verschiedenen Automatisierungsgraden. Es beleuchtet die technischen Grundlagen und die Entwicklung von autonomen Fahrzeugen sowie deren Integration in den Straßenverkehr.
Juristische Perspektive
Der Abschnitt "Juristische Perspektive" befasst sich mit dem deutschen Rechtsrahmen im Bereich des autonomen Fahrens. Besondere Aufmerksamkeit wird der Frage der Haftung im Falle von Unfällen mit autonomen Fahrzeugen gewidmet.
Schlüsselwörter
Autonomes Fahren, Künstliche Intelligenz, Ethik, Verantwortung, Menschenwürde, Rechtsrahmen, Haftung, Programmierung ethischer Prinzipien, Fahrerassistenzsysteme, Digitalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Ist die Verantwortungsübergabe an autonome Fahrzeuge ethisch vertretbar?
Diese Frage steht im Zentrum der Arbeit. Es wird diskutiert, ob Maschinen ethische Entscheidungen treffen können und wie dies mit der menschlichen Würde vereinbar ist.
Wer haftet bei Unfällen mit autonomen Autos?
Die Arbeit beleuchtet die juristische Perspektive im deutschen Rechtsrahmen und untersucht, wie Haftungsfragen zwischen Hersteller, Softwareentwickler und Halter geklärt werden können.
Können ethische Prinzipien programmiert werden?
Es wird untersucht, wie moralische Dilemmata (z.B. Unfallsituationen) algorithmisch abgebildet werden können und welche ethischen Theorien dabei als Grundlage dienen könnten.
Welche Rolle spielt die Menschenwürde beim autonomen Fahren?
Die Arbeit diskutiert, inwieweit die Abgabe von Kontrolle an eine KI die menschliche Autonomie und Würde berührt, insbesondere wenn über Leben und Tod entschieden wird.
Was sind die technischen Grenzen autonomer Fahrzeuge?
Kritische Stimmen weisen darauf hin, dass KI-Systeme Schwierigkeiten haben können, Straßenschilder mit Graffiti oder Aufklebern korrekt zu interpretieren, was Sicherheitsrisiken birgt.
Welche Automatisierungsgrade werden unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen verschiedenen Stufen, von einfachen Fahrerassistenzsystemen bis hin zum vollautonomen Fahren ohne menschliches Eingreifen.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2019, Autonomes Fahren. Ist diese Verantwortungsübergabe ethisch vertretbar?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/907865