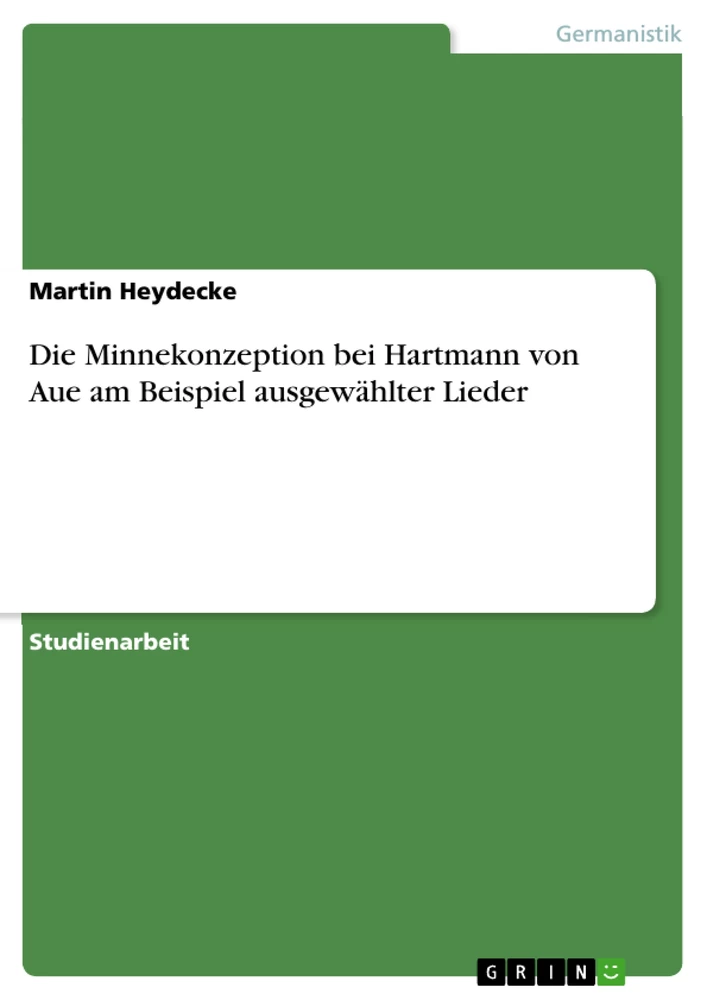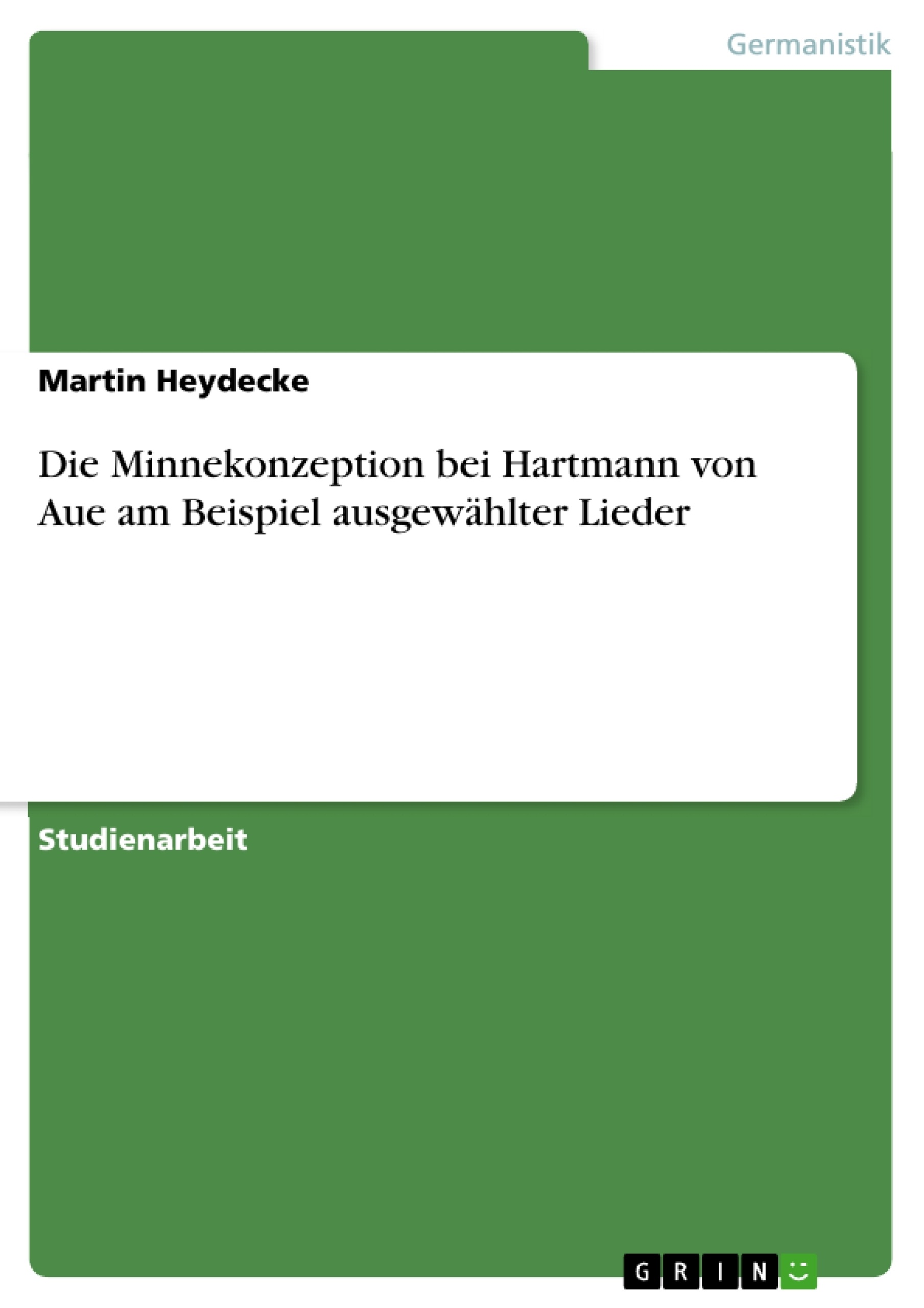Der Minnesang scheint für den Laien eines der charakteristischsten Merkmale des Mittelalters darzustellen. Das Bild von Sängern die eine unnahbare Burgdame anbeten, stellt unsere gängige Ansicht des Minnesangs und des Mittelalters dar, so wie es auch auf den heute weit verbreiteten und beliebten Mittelalterfesten gern präsentiert wird. Dass das Bild des Minnesangs aber ein durchaus diffizileres ist, wird in der vorliegenden Arbeit deutlich. Am Beispiel der Minnekonzeption Hartmanns von Aue wird gezeigt, wie vielschichtig und schwierig die Analyse von Minneliedern im Allgemeinen ist. Die Minnekonzeption Hartmanns von Aue war keine statische Konstruktion, sondern entwickelte sich im Laufe des Schaffens des Autors.
Daher wird nach einem einleitenden Kapitel über den Minnesang selbst, zunächst die Phase der hohen Minne in ihren Besonderheiten erklärt und im zweiten Kapitel auf die Biographie Hartmanns von Aue eingegangen. Im dritten Kapitel folgen die Analyse und Erörterung dreier Lieder des Autors, welche als besonders exemplarisch für seine seelische und künstlerische Entwicklung angesehen werden können. Als beispielhafte Lieder wurden ausgewählt: Ich muoz von réhte den tac iemer minnen [MF 215,14], Maniger grüezet mich alsô, [MF 216,29] und Ich var mit iuwern hulden [MF 218,5]. Abschließend erfolgen im Kapitel 3.2 eine weitere Problematisierung zu den jeweiligen Minneliedern und ein näheres Eingehen bzw. eine Erörterung der Minnekonzeption bei Hartmann von Aue.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Minnesang
- Allgemeines zum Minnesang
- Zur Hohen Minne
- Zur Biographie Hartmanns von Aue
- Zur Minnekonzeption Hartmanns von Aue
- Analyse ausgewählter Lieder
- Ich muoz von réhte den tac iemer minnen [MF 215,14]
- Maniger grüezet mich alsô, [MF 216,29]
- Ich var mit iuwern hulden [MF 218,5]
- Zusammenfassende Darstellung der Minnekonzeption
- Analyse ausgewählter Lieder
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widmet sich der Minnekonzeption Hartmanns von Aue anhand ausgewählter Lieder. Sie analysiert die Vielschichtigkeit und Dynamik der Minnekonzeption und beleuchtet, wie sie sich im Schaffen des Autors entwickelt. Dabei wird der Minnesang als ein zentrales Merkmal des Mittelalters betrachtet, mit Fokus auf die Hohe Minne.
- Entwicklung der Minnekonzeption bei Hartmann von Aue
- Analyse ausgewählter Lieder
- Bedeutung des Minnesangs im Kontext des Mittelalters
- Rolle der Minne in der höfischen Gesellschaft
- Unterscheidung zwischen Rollenlyrik und Erlebnislyrik im Minnesang
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Minnesang als ein wichtiges Merkmal des Mittelalters vor und führt in die Thematik der Minnekonzeption bei Hartmann von Aue ein. Das erste Kapitel behandelt allgemeine Aspekte des Minnesangs und beleuchtet insbesondere die Phase der Hohen Minne. Das zweite Kapitel widmet sich der Biographie Hartmanns von Aue. Das dritte Kapitel beinhaltet die Analyse dreier Lieder des Autors, die als besonders exemplarisch für seine Entwicklung angesehen werden: „Ich muoz von réhte den tac iemer minnen“, „Maniger grüezet mich alsô“ und „Ich var mit iuwern hulden“. Das Kapitel schließt mit einer zusammenfassenden Darstellung der Minnekonzeption Hartmanns von Aue.
Schlüsselwörter
Minnesang, Hohe Minne, Hartmann von Aue, Minnekonzeption, Liederanalyse, Rollenlyrik, höfische Gesellschaft, mittelalterliche Literatur, Kreuzzugslyrik, Fiktionalität, Minnethematik.
- Citar trabajo
- Martin Heydecke (Autor), 2008, Die Minnekonzeption bei Hartmann von Aue am Beispiel ausgewählter Lieder, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90852