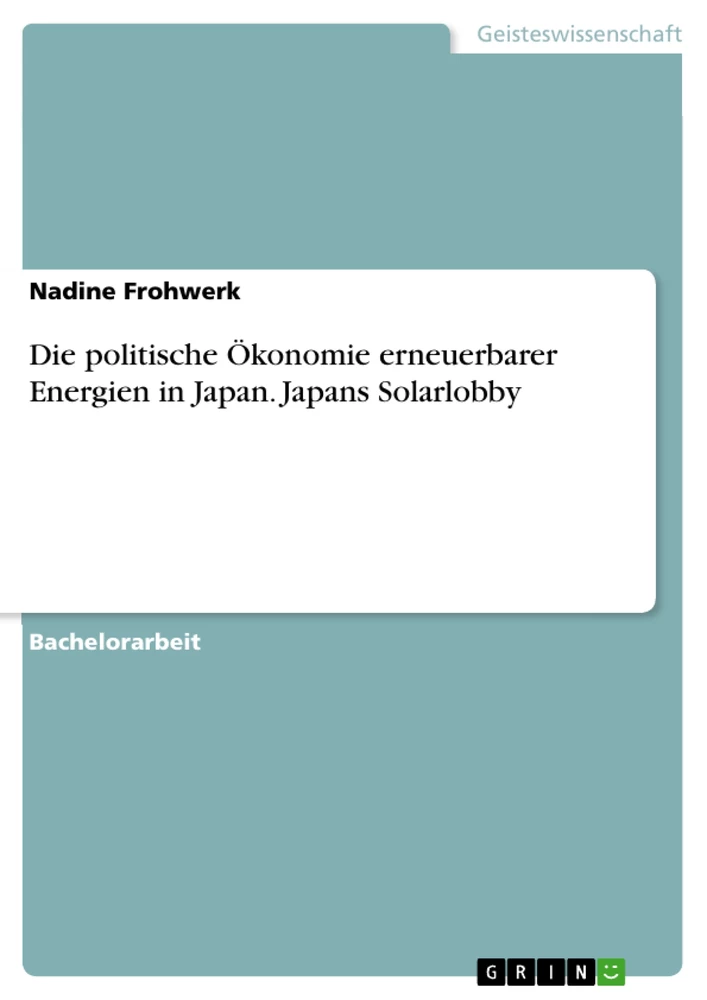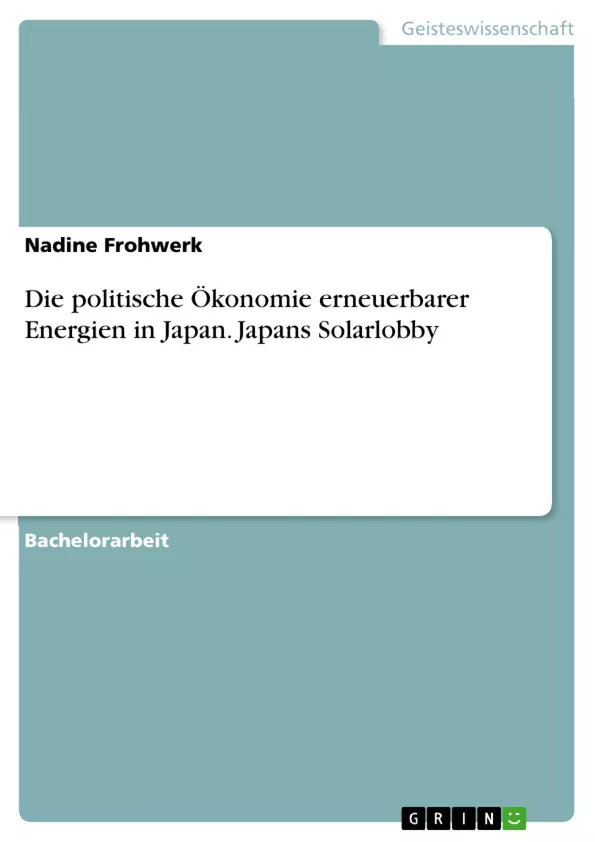In dieser Arbeit wird der Fokus auf die Analyse des sozio-technischen Regimes hinter der Erzeugung von Strom aus Photovoltaikanlagen in Japan gelegt, im Folgenden als Solarenergie bezeichnet. Eine weitere Einschränkung besteht in der Auswahl der zu betrachtenden Akteure: Die japanische Zentralregierung, die Solarindustrie und Investoren für Photovoltaikanlagen. Es wird sich im Verlauf dieser Arbeit zeigen, dass diese drei Akteure ein gemeinsames Interesse daran hatten Solarenergie zu fördern.
Die Anwendung einer Kombination aus verschiedenen Institutionstheorien kann als Interpretationsrahmen dienen, um die Faktoren zu verstehen, die den Wandel im Energiesektor vorantreiben oder einschränken und um zu untersuchen, wie sich verschiedene politische Maßnahmen auf das Energiesystem auswirken können, wenn Akteure und Institutionen auf politische Maßnahmen reagieren. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit die Stromerzeugung aus Photovoltaikanlagen als sozio- technisches System angesehen und mittels der Multi-Level-Perspektive (MLP) analysiert. Erweitert wird diese Transformationstheorie mit der "Rational Choice"- Theorie und dem historischen Institutionalismus, um ein umfassendes Verständnis für die Entwicklung der Solarlobby und ihrer Akteure zu erhalten.
Diese Arbeit wird als definierende Forschung mit folgender Forschungsfrage durchgeführt: Wie gelang es der Solarlobby in Japan, trotz eines Nischendaseins der Solarindustrie und weiteren widrigen Umständen, weiter fortzubestehen und sich zusammen mit der Solarindustrie zu einer einflussreichen Institution zu entwickeln? Im theoretischen Teil werden die Grundlagen für den empirischen Teil dargelegt. Zu Beginn wird ein umfassender theoretischer Rahmen erläutert und anschließend im methodischen Teil auf den betrachteten Gegenstand dieser Arbeit angepasst. Der darauffolgende Hauptteil ist chronologisch in vier Kapitel unterteilt: Zunächst wird der Beginn der Solarindustrie in Japan erörtert. Daraufhin wird untersucht, wie sich die entstandene Solarlobby in Zeiten wachsender, globaler Konkurrenz entwickelt hat. Das nächste Kapitel untersucht welche Auswirkungen die Nuklearkatastrophe von Fukushima auf die Solarlobby hatte und welche energiepolitischen Maßnahmen eingeführt wurden. Zuletzt werden ein paar ausgewählte Deklarationen im fünften strategischen Energieplan (SEP) betrachtet und mit den zuvor festgestellten institutionellen Entwicklungen innerhalb der Solarlobby in Zusammenhang gebracht.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Rahmen: Das sozio-technische Regime in Energiesystemen und institutioneller Wandel
- 3.1 Untersuchung der Umwelt als Makro Ebene
- 3.2 Untersuchung des sozio-technischen Regimes als Meso Ebene
- 3.3 Untersuchung der Nische als Mikro Ebene
- 4 Die Solarlobby aus Sicht von institutionellem Wandel innerhalb eines sozio-technischen Regimes
- 4.1 Beginn der Solarlobby
- 4.1.1 Der erste exogene Schock: die Ölkrise 1973
- 4.1.2 Der erste Energiewandel: Das Sunshine Programm 1974 und seine Nachfolger
- 4.1.3 Entstehung eines heimischen Markts für Solarenergie
- 4.1.4 Erstes Zwischenergebnis
- 4.2 Die Solarlobby in einer wachsenden, globalen Konkurrenz
- 4.2.1 Verlust der Marktführerschaft ab 2004
- 4.2.2 Einführung des ersten FIT für Solarenergie im Jahr 2009
- 4.2.3 Zweites Zwischenergebnis
- 4.3 Die Solarlobby nach Fukushima
- 4.3.1 Der zweite exogene Schock: die Nuklearkatastrophe von Fukushima
- 4.3.2 Der zweite Energiewandel: Einführung eines neuen FIT im Juli 2012
- 4.3.3 Die Bedeutung der Liberalisierung des Energiemarktes für Investoren und die Solarlobby
- 4.3.4 Kommunen und Solarenergie
- 5 Die Einführung des fünften strategischen Energieplans
- 6 Fazit
- 7 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der Solarlobby in Japan und untersucht, wie es dieser Lobby trotz eines Nischendaseins der Solarindustrie und weiterer Widrigkeiten gelang, zu einer einflussreichen Institution heranzuwachsen. Dabei wird die Stromerzeugung aus Photovoltaikanlagen als sozio-technisches System betrachtet und mithilfe der Multi-Level-Perspektive (MLP) analysiert. Die Arbeit untersucht die Einflüsse der Ölkrise 1973 und der Nuklearkatastrophe von Fukushima auf die Entwicklung der Solarlobby und die Rolle der japanischen Zentralregierung, der Solarindustrie und Investoren für Photovoltaikanlagen.
- Die Entstehung und Entwicklung der Solarlobby in Japan
- Die Auswirkungen der Ölkrise 1973 und der Nuklearkatastrophe von Fukushima auf die Solarlobby
- Die Rolle der japanischen Zentralregierung, der Solarindustrie und Investoren für Photovoltaikanlagen
- Die Bedeutung der Liberalisierung des Energiemarktes für Investoren und die Solarlobby
- Das sozio-technische Regime der Solarindustrie und institutioneller Wandel
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den energiepolitischen Kontext in Japan nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima beleuchtet und die Bedeutung der Solarenergie als Alternative zu Kernkraft und Importen hervorhebt. Anschließend wird der theoretische Rahmen vorgestellt, der die Stromerzeugung aus Photovoltaikanlagen als sozio-technisches System und die Anwendung der Multi-Level-Perspektive (MLP) für die Analyse des institutionellen Wandels erläutert.
Kapitel 4 befasst sich mit der Entwicklung der Solarlobby in Japan, beginnend mit dem ersten exogenen Schock der Ölkrise 1973 und der Einführung des Sunshine Programms 1974. Es wird die Entstehung eines heimischen Markts für Solarenergie und die Herausforderungen in Zeiten wachsender, globaler Konkurrenz untersucht.
Das Kapitel 4.3 befasst sich mit den Auswirkungen der Nuklearkatastrophe von Fukushima auf die Solarlobby und die Einführung des zweiten Energiewandels mit einem neuen FIT im Juli 2012.
Das Kapitel 5 beleuchtet die Deklarationen im fünften strategischen Energieplan (SEP) und setzt sie in Beziehung zu den zuvor festgestellten institutionellen Entwicklungen innerhalb der Solarlobby.
Schlüsselwörter
Solarenergie, Photovoltaik, Solarlobby, Japan, Energiewandel, sozio-technisches Regime, institutioneller Wandel, Multi-Level-Perspektive (MLP), Ölkrise 1973, Nuklearkatastrophe von Fukushima, FIT (Feed-in Tariff), strategischer Energieplan (SEP), japanische Zentralregierung, Solarindustrie, Investoren.
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickelte sich die Solarlobby in Japan?
Die Solarlobby entstand nach der Ölkrise 1973 durch staatliche Programme wie das "Sunshine Program". Trotz zwischenzeitlicher Konkurrenz aus dem Ausland wuchs sie nach Fukushima zu einer einflussreichen Institution heran.
Welchen Einfluss hatte die Nuklearkatastrophe von Fukushima auf die Solarenergie?
Fukushima war ein exogener Schock, der zu einem radikalen Energiewandel führte. Japan führte daraufhin 2012 einen neuen Einspeisetarif (FIT) ein, der den Ausbau der Photovoltaik massiv beschleunigte.
Was ist das "Sunshine Program"?
Es war das erste große Energiewandel-Programm Japans von 1974, das als Reaktion auf die Ölkrise die Entwicklung alternativer Energiequellen, insbesondere der Solarenergie, forcierte.
Was bedeutet FIT im Kontext der japanischen Energiepolitik?
FIT steht für Feed-in Tariff (Einspeisevergütung). Es ist ein politisches Instrument, das Produzenten von Solarstrom feste Vergütungen garantiert, um Investitionen in erneuerbare Energien attraktiv zu machen.
Welche Akteure bilden die Solarlobby in Japan?
Die Solarlobby besteht primär aus der japanischen Zentralregierung, der Solarindustrie selbst sowie privaten und institutionellen Investoren, die ein gemeinsames Interesse an der Förderung der Photovoltaik haben.
- Citar trabajo
- Nadine Frohwerk (Autor), 2020, Die politische Ökonomie erneuerbarer Energien in Japan. Japans Solarlobby, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/908624