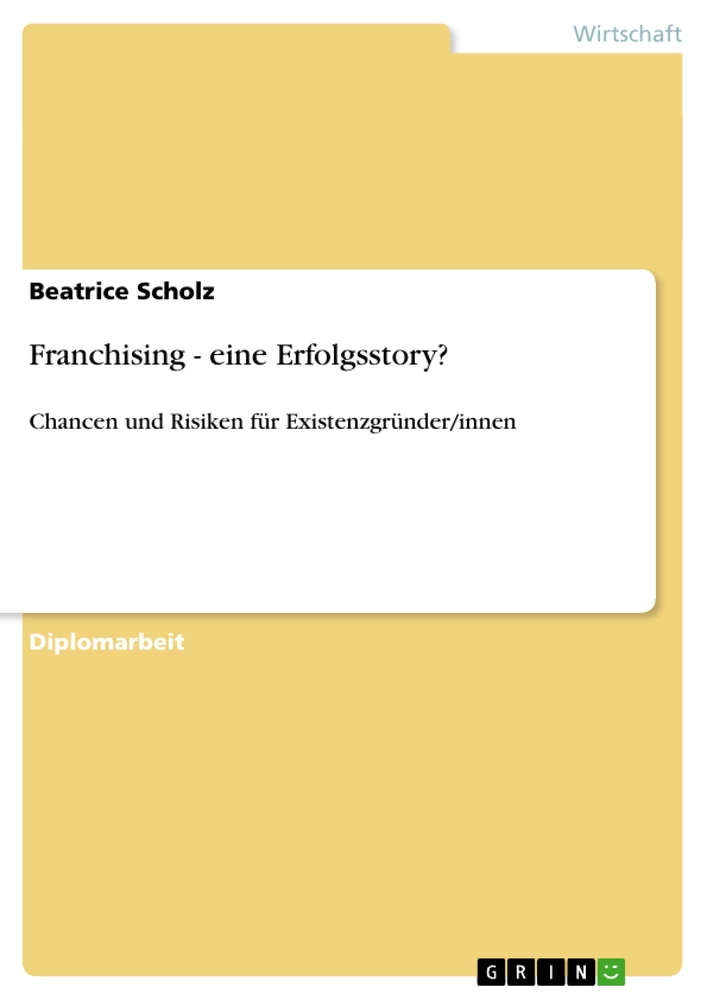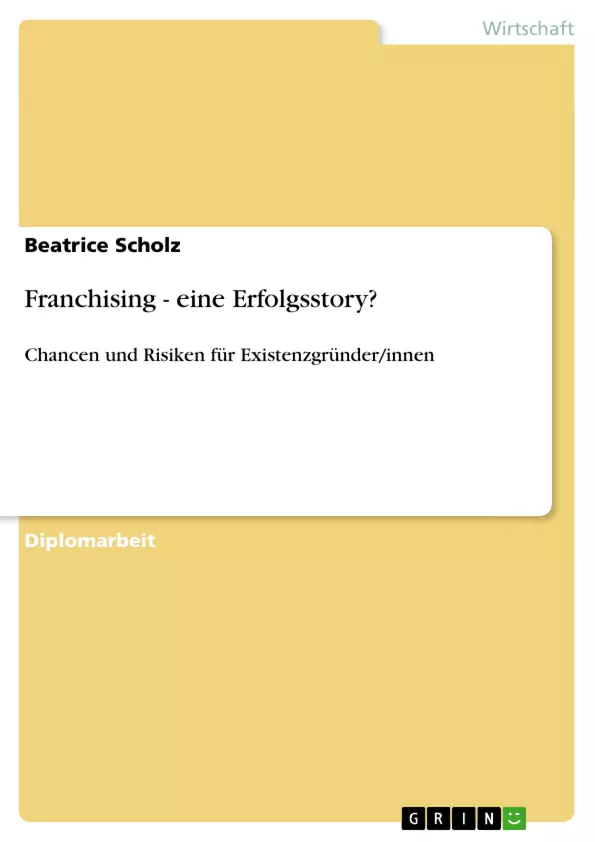In Deutschland steigen die Zahlen der Existenzgründungen kontinuierlich an. Gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen haben einen besonders wichtigen Anteil an der gesamten Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik. Jede Neugründung schafft im Schnitt vier zusätzliche Arbeitsplätze. Doch jede Existenzgründung erfordert zunächst einmal Mut. Viele tausend Jungunternehmer ersparen sich jährlich die Fülle an Problemen und Risiken, die die Gründung eines Betriebes im Alleingang mit sich bringt, und kaufen sich ein fertiges Konzept. Dieses Prinzip nennt man Franchising, es wird mittlerweile in vielen Branchen praktiziert.
Doch klar ist auch: Franchising ist kein System ohne Risiken; weder für Franchise-Geber noch für Franchise-Nehmer. Die Motive zur „Partnerschaft mit System“ sind bei beiden Parteien unterschiedlich: Der Franchise-Geber möchte hoch motivierte Mitunternehmer und zusätzliches Kapital für die Expansion gewinnen. Der Franchise-Nehmer übernimmt im Idealfall das Know-how und die Erfahrung des System-Gebers und arbeitet mit dessen erprobten, erfolgreichen Produkten und Dienstleistungen. Je besser diese Kooperation funktioniert, desto größer ist erfahrungsgemäß der Erfolg des gesamten Systems.
Innerhalb von wenigen Jahren hat sich die volkswirtschaftliche Bedeutung des Franchisings deutlich erhöht. Diese Form der Existenzgründung gilt zudem als besonders sichere Variante der Gründung und wird von Seiten der Politik und von Wirtschaftsverbänden als ein möglicher Ausweg aus der Beschäftigungskrise gesehen.
In der Praxisliteratur wie auch in wissenschaftlichen Beiträgen ist die Annahme, dass Franchise-Geber und Franchise-Nehmer ein geringeres Risiko des Scheiterns aufweisen als „herkömmliche“ - d.h. unabhängige - Existenzgründer, weit verbreitet und trägt schon fast dogmatische Züge. Im Folgenden sind zwei Aussagen für diese weit verbreitete Auffassung aufgeführt:
„(...) Franchising ist eine Existenzgründung innerhalb eines markterprobten Unternemens-Netzwerkes und damit nach offiziellen Zahlen des DIHK sechsmal erfolgreicher als die Selbständigkeit 'auf eigene Faust'. (...)“
Und:
„(...) Grundsätzlich ist die Quote der Geschäftsaufgaben bei Franchise-Nehmern sehr niedrig (sie liegt im ersten Jahr bei rund 8 %, sinkt danach nahezu auf Null). Im Gegensatz dazu, geben von traditionellen Existenzgründern fast 70 % in den ersten fünf Jahren auf. (...)“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Grundlagen und Entwicklung des Franchisings
- Der Ursprung des Franchisings
- Entwicklung des „modernen“ Franchisings
- Der Begriff des Franchisings und seine Zielsetzung heute
- Die zu erbringenden Leistungen der Vertragspartner
- Ausgangssituation der Existenzgründer
- Existenzgründung: eine Begriffsbestimmung
- Herausforderungen im Verlauf einer Existenzgründung
- Chancen und Risiken in der Systempartnerschaft
- Chancen für den Franchise-Geber
- Risiken für den Franchise-Geber
- Chancen für den Franchise-Nehmer
- Unterstützung bei der Standortfrage
- Unterstützung durch Schulungsmaßnahmen
- Unterstützung durch betriebswirtschaftliche Begleitung
- Kommunikations- und Austauschmöglichkeiten im System
- Risiken für Franchise-Nehmer-Gründungen
- Risiken durch eine mangelnde vorvertragliche Aufklärung
- Risiken, die durch die Anmietung eines Ladenlokals entstehen können
- Risiken im Zusammenhang mit Schulungsmaßnahmen
- Risiken im Zusammenhang mit den Kommunikations- und Austauschmöglichkeiten im System
- Risiken bei schnellem Franchise-Nehmer-Wachstum im System
- Risiko der Scheinselbständigkeit
- Risiken in Zusammenhang mit der Bezugsbindung
- Risiken im Zusammenhang mit der Vertragsbeendigung
- Mögliche Synergieeffekte in der Systempartnerschaft
- Zufriedenheit der Franchise-Nehmer
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Chancen und Risiken des Franchisings für Existenzgründer. Sie analysiert die Entwicklung des Franchisings, die spezifischen Herausforderungen der Existenzgründung und die besonderen Bedingungen, die durch die Systempartnerschaft entstehen.
- Die Entwicklung des Franchisings von seinen Ursprüngen bis zum heutigen Modell
- Die Herausforderungen und Chancen der Existenzgründung im Allgemeinen
- Die spezifischen Chancen und Risiken, die mit der Franchise-Partnerschaft verbunden sind
- Die Bedeutung der vorvertraglichen Aufklärung und der Transparenz im Franchise-Vertrag
- Die Bedeutung der Unterstützung und der Zusammenarbeit zwischen Franchise-Geber und Franchise-Nehmer
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Diplomarbeit dar und definiert die Forschungsfrage. Das zweite Kapitel befasst sich mit den historischen Wurzeln des Franchisings und beschreibt die Entwicklung des „modernen“ Franchisings. Es erläutert die Funktionsweise des Franchise-Systems und die Leistungen, die von den Vertragspartnern erbracht werden. Das dritte Kapitel befasst sich mit der allgemeinen Situation von Existenzgründern, insbesondere mit den Herausforderungen, die mit einer Existenzgründung verbunden sind. Das vierte Kapitel widmet sich den Chancen und Risiken, die sich für Franchise-Geber und Franchise-Nehmer aus der Systempartnerschaft ergeben. Dabei werden die spezifischen Vorteile und Nachteile für beide Seiten betrachtet.
Schlüsselwörter
Franchising, Existenzgründung, Chancen, Risiken, Systempartnerschaft, Franchise-Geber, Franchise-Nehmer, vorvertragliche Aufklärung, Vertragsgestaltung, Unterstützung, Zusammenarbeit, Erfolgsfaktoren, Geschäftsmodell.
Häufig gestellte Fragen
Ist Franchising sicherer als eine Einzelgründung?
Statistiken deuten darauf hin, dass die Erfolgsquote im Franchising höher ist, da Gründer ein bereits markterprobtes Geschäftskonzept übernehmen.
Welche Pflichten hat der Franchise-Geber?
Er muss das Know-how bereitstellen, Schulungen durchführen, bei der Standortwahl helfen und die Marke sowie das System kontinuierlich weiterentwickeln.
Welche Risiken trägt der Franchise-Nehmer?
Risiken bestehen in mangelnder Aufklärung vor Vertragsschluss, hohen laufenden Gebühren, der Bindung an bestimmte Lieferanten und dem Risiko der Scheinselbständigkeit.
Was bedeutet „vorvertragliche Aufklärung“?
Der Franchise-Geber ist verpflichtet, den Interessenten umfassend über die Rentabilität und die Risiken des Systems zu informieren, bevor der Vertrag unterzeichnet wird.
Welche Vorteile bietet Franchising dem Franchise-Geber?
Er kann schneller expandieren, da die Franchise-Nehmer Eigenkapital einbringen und als hochmotivierte Mitunternehmer vor Ort agieren.
Was sind Synergieeffekte in einer Systempartnerschaft?
Dazu gehören gemeinsamer Einkauf, überregionale Marketingmaßnahmen und der Erfahrungsaustausch zwischen den Partnern, die Kosten senken und die Marktmacht erhöhen.
- Citation du texte
- Diplom Kauffrau Beatrice Scholz (Auteur), 2007, Franchising - eine Erfolgsstory?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90878