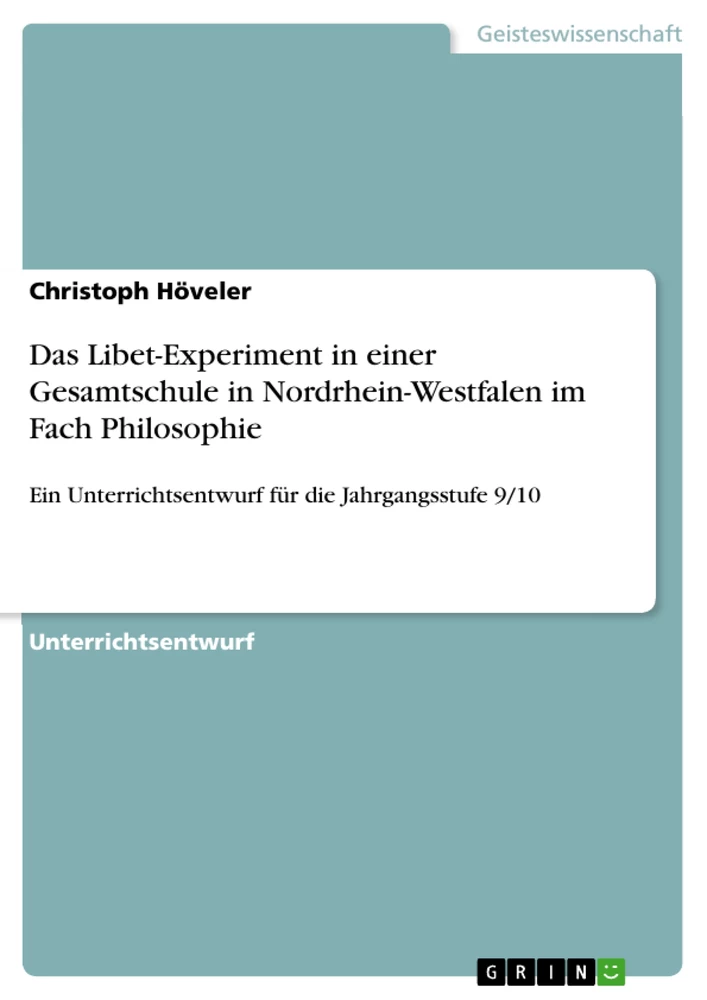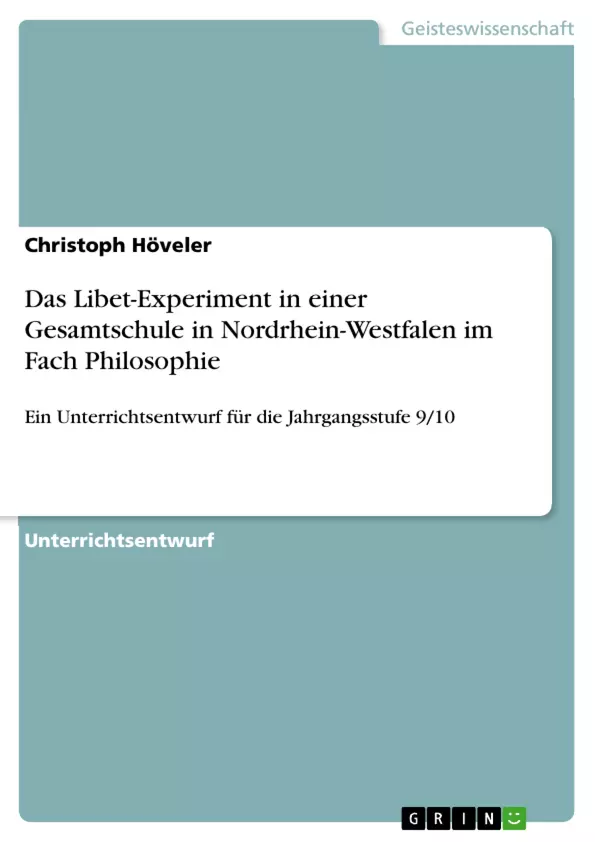Die Arbeit stellt einen Unterrichtsentwurf dar, der in der Jahrgangsstufe 9 oder 10, in einer nordrheinwestfälischen Gesamtschule entworfen wurde. Das Fach, welches hier exemplarisch dargestellt wird, ist die praktische Philosophie. Der Unterrichtsentwurf setzt sich mit der Frage nach dem Selbst auseinander.
Schülerinnen und Schüler erläutern im Schwerpunkt die Kernaspekte der deterministischen Position für das Strafgesetz anhand der Folgen des Libet-Experiments für die Willensfreiheit.
Inhaltsverzeichnis
- Curriculare Legitimation des geplanten Unterrichts
- Einbettung der Unterrichtsstunde in die Unterrichtsreihe
- Lernziele
- Kernanliegen
- Teilziele
- Lehr- und Lernausgangslage
- Didaktische und methodische Überlegungen
- Didaktische Überlegungen
- Methodische Überlegungen
- Verlaufsplan
- Quellenangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterrichtsstunde zielt darauf ab, den Schülerinnen und Schülern ein tiefes Verständnis der willentlich freien Entscheidung und ihrer vielschichtigen Einflüsse zu vermitteln. Sie sollen in der Lage sein, die komplexen Zusammenhänge zwischen deterministischen und indeterministischen Perspektiven auf die Willensfreiheit zu reflektieren und kritisch zu hinterfragen.
- Der Begriff der Willensfreiheit
- Determinismus und Indeterminismus
- Das Libet-Experiment und seine Folgen für die Willensfreiheit
- Die Rolle des Determinismus im Strafrecht
- Ethische und philosophische Implikationen der Willensfreiheit
Zusammenfassung der Kapitel
Das Kapitel „Curriculare Legitimation des geplanten Unterrichts“ legt die theoretischen Grundlagen für die Unterrichtsstunde fest. Es zeigt auf, wie die Unterrichtsstunde in den Rahmen des Kernlehrplans und des schulinternen Curriculums für praktische Philosophie eingebettet ist. Außerdem werden die zentralen Kompetenzerwartungen für die Jahrgangsstufe 9/10 im Fach praktische Philosophie erläutert.
Das Kapitel „Einbettung der Unterrichtsstunde in die Unterrichtsreihe“ präsentiert die konkrete Einordnung der Unterrichtsstunde in die Gesamtstruktur der Unterrichtsreihe. Es stellt die thematischen Schwerpunkte der vorangegangenen und nachfolgenden Stunden dar und verdeutlicht die kontinuierliche Entwicklung der Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler.
Das Kapitel „Lernziele“ definiert die angestrebten Lernergebnisse der Unterrichtsstunde. Es beschreibt sowohl das Kernanliegen als auch die spezifischen Teilziele, die die Schülerinnen und Schüler am Ende der Stunde erreicht haben sollen. Die Lernziele dienen als Orientierungsrahmen für den Unterricht und ermöglichen eine zielgerichtete Planung und Durchführung der Stunde.
Das Kapitel „Lehr- und Lernausgangslage“ analysiert die Bedingungen und Rahmenbedingungen für den Unterricht. Es beleuchtet die Lerngruppe und ihre individuellen Bedürfnisse, das vorhandene Wissen der Schülerinnen und Schüler sowie die aktuelle Lehr- und Lernkultur im Unterricht.
Das Kapitel „Didaktische und methodische Überlegungen“ erläutert die didaktischen und methodischen Entscheidungen, die für die Gestaltung der Unterrichtsstunde getroffen wurden. Es befasst sich mit der didaktischen Relevanz des Themas, den gewählten Unterrichtsmethoden und deren Begründung, sowie den Einsatz von Medien und Materialien.
Der „Verlaufsplan“ beschreibt den geplanten Ablauf der Unterrichtsstunde im Detail. Er enthält eine chronologische Auflistung der einzelnen Unterrichtsphasen, die eingesetzten Methoden und Materialien sowie die zeitliche Planung.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Unterrichtsstunde sind: Willensfreiheit, Determinismus, Indeterminismus, Libet-Experiment, Strafrecht, ethische Philosophie, philosophische Argumentation, freie Entscheidung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Libet-Experiment?
Ein berühmtes neurowissenschaftliches Experiment, das zeigt, dass das Gehirn eine Handlung einleitet (Bereitschaftspotenzial), bevor die Person die bewusste Entscheidung dazu trifft.
Welche philosophische Frage steht im Zentrum des Unterrichtsentwurfs?
Die Frage nach der Existenz der menschlichen Willensfreiheit und dem Gegensatz zwischen Determinismus (Vorherbestimmung) und Indeterminismus.
Was bedeutet das Libet-Experiment für das Strafrecht?
Wenn Handlungen rein deterministisch wären, stellt sich die ethische Frage, ob ein Mensch für seine Taten moralisch und rechtlich verantwortlich gemacht werden kann.
Für welche Klassenstufe ist dieser Philosophie-Unterricht gedacht?
Der Entwurf ist für die Jahrgangsstufe 9 oder 10 an einer Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen im Fach Praktische Philosophie konzipiert.
Was sind die Lernziele dieser Unterrichtsstunde?
Schüler sollen Kernaspekte der deterministischen Position erläutern und die Folgen für das Konzept von Schuld und Strafe kritisch reflektieren.
- Quote paper
- Christoph Höveler (Author), 2019, Das Libet-Experiment in einer Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen im Fach Philosophie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/909623