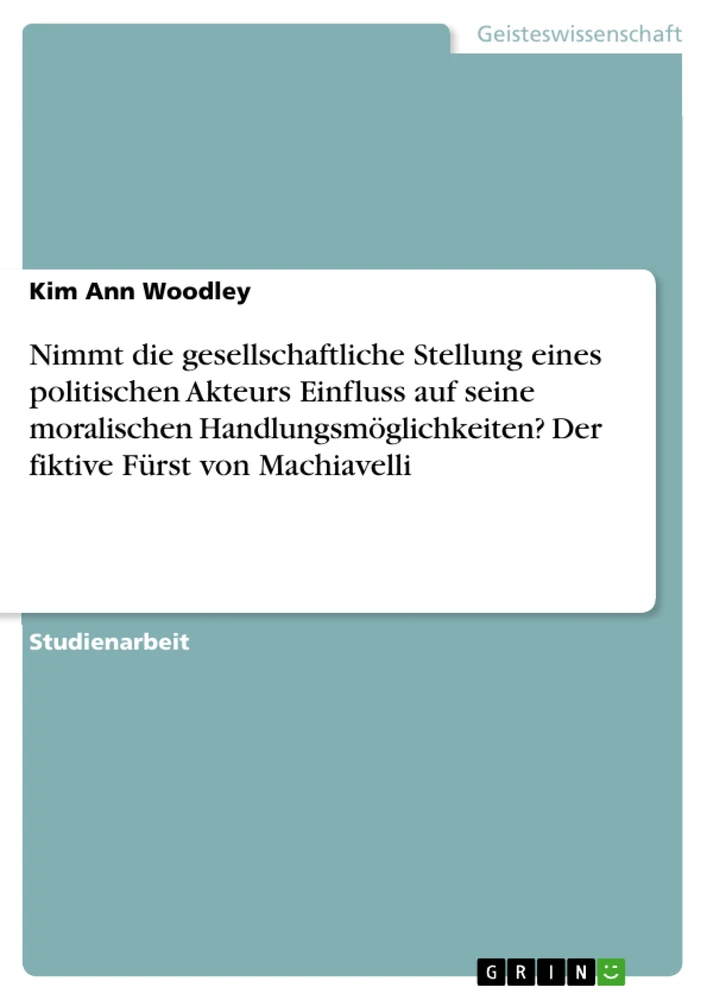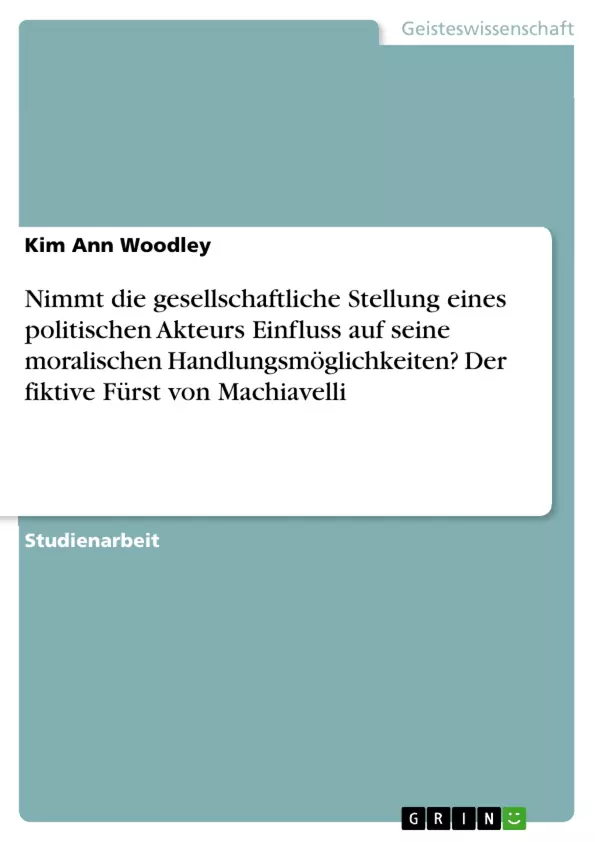Mein Ziel ist, zu zeigen, dass es sich bei dem fiktiven Fürsten von Machiavelli um einen (ein Staatsoberhaupt widerspiegelnden) Sonderfall handelt, weil dessen gesellschaftliche Stellung seine moralischen Handlungsmöglichkeiten beeinflusst, sowie, dass Machiavellis Ratschläge moralisch nicht verwerflich sind, sondern legitim sein können.
In den Kapiteln XV-XVIII seines Werkes "Der Fürst" rät Machiavelli einer Person mit einer staatsführenden gesellschaftlichen Rolle zu Handlungsoptionen in einem politischen Rahmen, die auf den ersten Blick den Eindruck erwecken, sich an einem unmoralischen Verhalten zu orientieren. Zu Beginn stellt er dazu die These auf, dass aus erwünschten Handlungen unerwünschte und aus unerwünschten Handlungen erwünschte Ergebnisse für den Akteur resultieren können.
Deswegen sei es für ein Staatsoberhaupt ratsam, wider dem Löblichen (dem Moralischen) zu handeln, um seine gesellschaftliche Position zu sichern. Hierbei bleibt allerdings unklar, ob Machiavelli die Moral als solche, nur in bestimmten Teilaspekten oder einen gänzlich anderen Aspekt kritisieren möchte.
Außerdem analysiert Machiavelli die Verhältnisse von menschlichen Charaktereigenschaften in Bezug zu damit einhergehenden, moralisch bewertbaren Verhaltensweisen stark gebunden an einen Akteur von besonderer gesellschaftlicher Stellung. Daher stellt sich mir zudem die Hauptfrage, ob die moralischen Handlungsmöglichkeiten eines Akteurs durch seine gesellschaftliche Stellung beeinflusst werden.
Aufgrund dieser Überlegungen möchte ich mich zunächst mit den allgemeinen Aussagen der besagten Kapitel befassen und dabei Machiavellis Verständnis von einem Herrscher und das von ihm skizzierte Menschenbild untersuchen, um herauszuarbeiten, in welcher Beziehung diese Begriffe zueinander stehen, sowie woran sich Machiavellis Kritik tatsächlich richtet.
Daraufhin möchte ich andere Verstehensansätze einführen und mit der bei Machiavelli thematisierten Problematik in Verbindung setzen, um zu erarbeiten, ob die gesellschaftliche Rolle eines Akteurs Einfluss auf dessen Handlungsoptionen in Bezug zu moralischen Richtlinien nimmt, sowie ob dies sich anhand eines moraltheoretischen Ansatzes rechtfertigen lässt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die allgemeinen Aussagen der Kapitel XV-XVIII aus „Der Fürst“
- 2.1 Machiavellis Verständnis des Fürsten
- 2.1.1 Der „ideale“ Fürst
- 2.1.2 Der „reale“ Fürst
- 2.1.3 Das Ziel des Fürsten
- 2.2 Machiavellis Menschenbild
- 2.1 Machiavellis Verständnis des Fürsten
- 3. Das Abhängigkeitsverhältnis bei Machiavelli
- 4. Verschiedene Verstehensansätze der Problematik
- 4.1 Der Humanismus und der Fürstenspiegel
- 4.2 Ethik und Hypokrisie in der Politik
- 4.3 Common Morality und der Begriff der Rechtfertigung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Machiavellis „Der Fürst“, insbesondere die Kapitel XV-XVIII, um die Frage zu beantworten, inwiefern die gesellschaftliche Stellung eines politischen Akteurs seine moralischen Handlungsmöglichkeiten beeinflusst. Die Analyse fokussiert auf Machiavellis Verständnis des Fürsten, sein Menschenbild und die Beziehung zwischen beidem. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Interpretationsansätze und prüft die Rechtfertigungsmöglichkeit von Machiavellis Position.
- Machiavellis Verständnis des idealen und realen Fürsten
- Machiavellis Menschenbild und dessen Einfluss auf politische Handlung
- Das Verhältnis von Moral und Politik bei Machiavelli
- Verschiedene ethische und moralphilosophische Perspektiven auf Machiavellis Argumentation
- Die Rechtfertigungsmöglichkeit von Machiavellis Ratschlägen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Problematik des scheinbar unmoralischen Handelns von politischen Akteuren nach Machiavelli. Sie formuliert die Forschungsfrage nach dem Einfluss der gesellschaftlichen Stellung auf moralische Handlungsmöglichkeiten und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, welcher die Analyse von Machiavellis Verständnis des Fürsten und seines Menschenbildes umfasst, um dessen Kritik an moralischen Vorstellungen zu beleuchten und verschiedene Interpretationsansätze einzubeziehen.
2. Die allgemeinen Aussagen der Kapitel XV-XVIII aus „Der Fürst“: Dieses Kapitel analysiert Machiavellis Verständnis des Fürsten und sein Menschenbild. Machiavelli beschreibt zwei Typen von Fürsten: den idealen und den realen. Der ideale Fürst verkörpert wünschenswerte Eigenschaften, jedoch sieht Machiavelli dessen Realisierbarkeit als unrealistisch an, da auch positive Eigenschaften unerwünschte Folgen haben können und andere Akteure sich nicht an moralische Richtlinien halten. Der reale Fürst muss sich pragmatisch verhalten und darf zum Erhalt der Macht auf moralische Prinzipien verzichten, jedoch nicht ohne Bedacht handeln. Machiavellis Menschenbild nimmt an, dass jeder Mensch sowohl positive als auch negative Eigenschaften besitzt, und der Fürst geschickt mit diesen umgehen muss.
Schlüsselwörter
Machiavelli, Der Fürst, Moral, Politik, Herrscher, Menschenbild, Handlungsmöglichkeiten, gesellschaftliche Stellung, Ethik, Realpolitik, Idealbild, pragmatischer Ansatz.
Häufig gestellte Fragen zu Machiavellis "Der Fürst" - Kapitel XV-XVIII
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Machiavellis "Der Fürst", speziell die Kapitel XV-XVIII. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die gesellschaftliche Stellung eines Politikers seine moralischen Handlungsmöglichkeiten beeinflusst. Die Analyse umfasst Machiavellis Verständnis des Fürsten, sein Menschenbild und das Verhältnis zwischen beidem. Die Arbeit untersucht verschiedene Interpretationsansätze und die Rechtfertigung von Machiavellis Position.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Machiavellis Verständnis des idealen und realen Fürsten, Machiavellis Menschenbild und dessen Einfluss auf politisches Handeln, das Verhältnis von Moral und Politik bei Machiavelli, verschiedene ethische und moralphilosophische Perspektiven auf Machiavellis Argumentation und die Rechtfertigungsmöglichkeit seiner Ratschläge.
Wie beschreibt Machiavelli den idealen und den realen Fürsten?
Machiavelli unterscheidet zwischen dem idealen und dem realen Fürsten. Der ideale Fürst verkörpert wünschenswerte Eigenschaften, seine Existenz hält Machiavelli jedoch für unrealistisch. Der reale Fürst hingegen muss pragmatisch handeln und kann zum Machterhalt auf moralische Prinzipien verzichten, sollte dies jedoch mit Bedacht tun.
Welches Menschenbild vertritt Machiavelli?
Machiavellis Menschenbild geht davon aus, dass jeder Mensch sowohl positive als auch negative Eigenschaften besitzt. Der Fürst muss geschickt mit diesen Eigenschaften umgehen können.
Welche Kapitel werden im Detail untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Kapitel XV-XVIII von Machiavellis "Der Fürst".
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern beeinflusst die gesellschaftliche Stellung eines politischen Akteurs seine moralischen Handlungsmöglichkeiten nach Machiavelli?
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit analysiert Machiavellis Verständnis des Fürsten und seines Menschenbildes, um dessen Kritik an moralischen Vorstellungen zu beleuchten und verschiedene Interpretationsansätze einzubeziehen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Machiavelli, Der Fürst, Moral, Politik, Herrscher, Menschenbild, Handlungsmöglichkeiten, gesellschaftliche Stellung, Ethik, Realpolitik, Idealbild, pragmatischer Ansatz.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit beinhaltet eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, beginnend mit einer Einleitung, die die Thematik und den methodischen Ansatz beschreibt, gefolgt von einer detaillierten Analyse der Kapitel XV-XVIII und einem abschließenden Fazit.
- Quote paper
- Kim Ann Woodley (Author), 2018, Nimmt die gesellschaftliche Stellung eines politischen Akteurs Einfluss auf seine moralischen Handlungsmöglichkeiten? Der fiktive Fürst von Machiavelli, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/911115