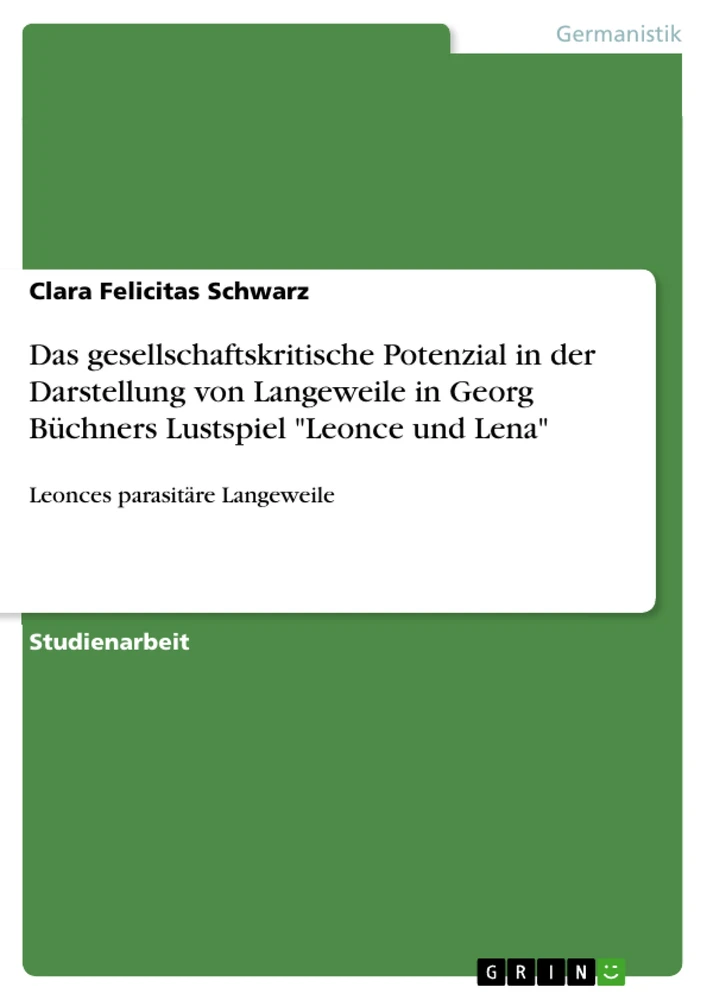Ziel dieser Arbeit ist es, die potenzielle Kritik an einem, zum Zeitpunkt der Abfassung des Lustspiels real existierenden feudalen Gesellschaftssystem durch die Darstellung von Langeweile in einer Komödie mit adligem Personal herauszuarbeiten und darzustellen. Dafür soll im Folgenden zunächst knapp in das Konzept der Langeweile eingeführt werden, um im Folgenden dessen Darstellung in Büchners Lustspiel zu analysieren und schließlich die damit einhergehende Kritik, zum einen am bürgerlichen Leistungsgedanken, zum anderen an der parasitären Langeweile einer "wohlhabende[n] Minorität" zu erfassen und zu deuten.
Mit der Abfassung des Lustspiels Leonce und Lena im Jahre 1836, in welchem das Leiden an der Langeweile des Prinzen Leonce zum komödiantischem Stoff wird, schuf Georg Büchner im Kontext eines spätabsolutistischen Regimes und der brodelnden Unruhe des Vormärz ein Drama von enormer politischer Sprengkraft. In drei Akten findet die literarische Verarbeitung einer Langeweile-Erfahrung zu Hofe des Königreiches Popo statt und die scheinbar immer gleichen Abläufe des höfischen Geschehens werden satirisch zur Schau gestellt. Zum einen werden existenzielle Fragen der Sinnhaftigkeit menschlichen Handelns aufgeworfen und somit das Ideal eines tüchtigen Bürgers infrage gestellt. Zum anderen findet die Entlarvung der Langeweile als Privileg des Adels statt, welcher sich auf Kosten der unteren Gesellschaftsschichten dem Müßiggang hingibt. Das dargestellte Langeweile-Konzept in Leonce und Lena erweist sich also als relativ ambivalent, wird es doch zum einen als Flucht vor der Ökonomisierung aller Lebensbereiche recht positiv dargestellt und zum anderen als Ausdruck adligen Schmarotzertums problematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konzept der Langeweile und historische Einordnung
- Darstellung der Langeweile in Leonce und Lena
- Das gesellschaftskritische Potenzial in der Darstellung von Langeweile
- Klassenbezogene Formen des Leidens an der Langeweile
- Kritik am vom Leistungsgedanken dominierten Bürgertum
- Die parasitäre Langeweile und arrogante Erkenntnis des Adels
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das gesellschaftskritische Potenzial der Darstellung von Langeweile in Georg Büchners Lustspiel „Leonce und Lena“. Sie beleuchtet, wie Büchner die Langeweile als Ausdruck gesellschaftlicher Missstände, insbesondere im Kontext des Vormärz, nutzt. Die Analyse konzentriert sich auf die Ambivalenz des Langeweile-Konzepts im Stück, welches sowohl als positive Flucht vor der Ökonomisierung des Lebens als auch als Ausdruck adligen Schmarotzertums dargestellt wird.
- Das Konzept der Langeweile in historischer Perspektive
- Darstellung der Langeweile in „Leonce und Lena“ als satirische Kritik
- Klassenbezogene Ausprägungen der Langeweile (Adel vs. Bürgertum)
- Die „parasitäre Langeweile“ des Adels und deren gesellschaftliche Implikationen
- Büchners politische Kritik im Kontext des Vormärz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt Georg Büchners Lustspiel „Leonce und Lena“ als Drama mit enormer politischer Sprengkraft, in dem die Langeweile des Prinzen Leonce zum komödiantischen Stoff wird. Das Stück wirft existenzielle Fragen nach der Sinnhaftigkeit menschlichen Handelns auf und kritisiert das Ideal des tüchtigen Bürgers sowie die Langeweile des Adels als ein Privileg auf Kosten der unteren Gesellschaftsschichten. Die Arbeit zielt darauf ab, die Kritik an der feudalen Gesellschaft durch die Darstellung der Langeweile herauszuarbeiten.
2. Konzept der Langeweile und historische Einordnung: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der Langeweile historisch und semantisch. Es zeigt die Entwicklung des Begriffs von einem neutralen Ausdruck für einen langen Zeitraum hin zu einem negativ konnotierten Gefühl des Nicht-Ausgefüllt-Seins, besonders im Kontext des aufkommenden Bürgertums und dessen Ideal des „tätigen Bürgers“. Immanuel Kants Relativierung des negativ besetzten Begriffs wird vorgestellt, der die Langeweile als „Stimulanz zur Überwindung eines widrigen Zustandes“ interpretiert.
3. Darstellung der Langeweile in Leonce und Lena: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung der Langeweile in Büchners Lustspiel. Es charakterisiert das Stück als Vorreiter des politischen Lustspiels und betont die unmissverständliche Ausstellung von Langeweile als „Leerlauf [aller] Sinnbildung“. Die Figuren werden als „Spielbälle tragischer Substanzen des Seins“ präsentiert, was die Identifikation des Publikums verhindert und zum Hinterfragen anregt. Die Mechanisierung des Lebens und die Unausweichlichkeit der Geschehnisse im Königreich Popo werden als konstitutiv für das Langeweile-Konzept des Stücks beschrieben. Prinz Leonce fungiert als Allegorie des unglücklichen Bewusstseins, dessen Leiden am Sein in der Zeit zu einer allumfassenden Langeweile führt.
Schlüsselwörter
Georg Büchner, Leonce und Lena, Langeweile, Gesellschaftskritik, Vormärz, Adel, Bürgertum, Leistungsgedanke, Satire, politisches Lustspiel, Mechanisierung des Lebens, Existenzialismus.
Häufig gestellte Fragen zu "Leonce und Lena": Gesellschaftskritik durch Langeweile
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das gesellschaftskritische Potenzial der Darstellung von Langeweile in Georg Büchners Lustspiel „Leonce und Lena“. Sie analysiert, wie Büchner Langeweile als Ausdruck gesellschaftlicher Missstände, insbesondere im Kontext des Vormärz, einsetzt. Der Fokus liegt auf der Ambivalenz des Langeweile-Konzepts: es wird sowohl als positive Flucht vor der Ökonomisierung des Lebens als auch als Ausdruck adligen Schmarotzertums dargestellt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: das Konzept der Langeweile in historischer Perspektive, die Darstellung der Langeweile in „Leonce und Lena“ als satirische Kritik, klassenbezogene Ausprägungen der Langeweile (Adel vs. Bürgertum), die „parasitäre Langeweile“ des Adels und deren gesellschaftliche Implikationen sowie Büchners politische Kritik im Kontext des Vormärz.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur historischen Einordnung des Langeweile-Konzepts, eine Analyse der Darstellung von Langeweile in "Leonce und Lena", und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt das Stück als politisches Drama, in dem die Langeweile des Prinzen Leonce zum komödiantischen Stoff wird. Das zweite Kapitel beleuchtet die semantische Entwicklung des Begriffs "Langeweile". Das dritte Kapitel analysiert die Darstellung der Langeweile im Stück, betont die Langeweile als "Leerlauf [aller] Sinnbildung" und die Figuren als "Spielbälle tragischer Substanzen des Seins".
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Georg Büchner, Leonce und Lena, Langeweile, Gesellschaftskritik, Vormärz, Adel, Bürgertum, Leistungsgedanke, Satire, politisches Lustspiel, Mechanisierung des Lebens, Existenzialismus.
Welche Interpretation der Langeweile wird vorgestellt?
Die Arbeit untersucht die Ambivalenz des Langeweile-Konzepts. Langeweile wird sowohl als Ausdruck der Kritik am leistungsorientierten Bürgertum dargestellt, als auch als Ausdruck der „parasitären Langeweile“ des Adels, der sein Privileg auf Kosten der unteren Gesellschaftsschichten genießt. Immanuel Kants Interpretation der Langeweile als „Stimulanz zur Überwindung eines widrigen Zustandes“ wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
(Der HTML-Ausschnitt enthält keine explizite Zusammenfassung der Schlussfolgerung. Die Arbeit zielt darauf ab, die Kritik an der feudalen Gesellschaft durch die Darstellung der Langeweile herauszuarbeiten. Es ist anzunehmen, dass das Fazit diese These zusammenfasst und vertieft.)
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich für Georg Büchner, "Leonce und Lena", Gesellschaftskritik des Vormärz, oder die literarische Darstellung von Langeweile interessieren. Sie richtet sich insbesondere an ein akademisches Publikum.
- Quote paper
- Clara Felicitas Schwarz (Author), 2020, Das gesellschaftskritische Potenzial in der Darstellung von Langeweile in Georg Büchners Lustspiel "Leonce und Lena", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/911761