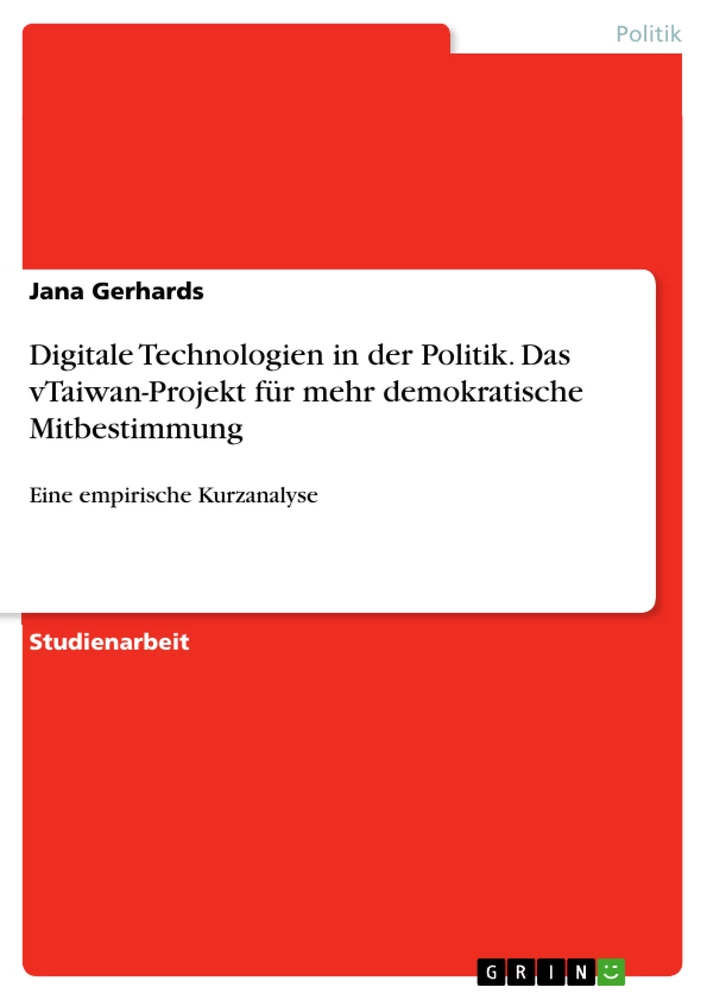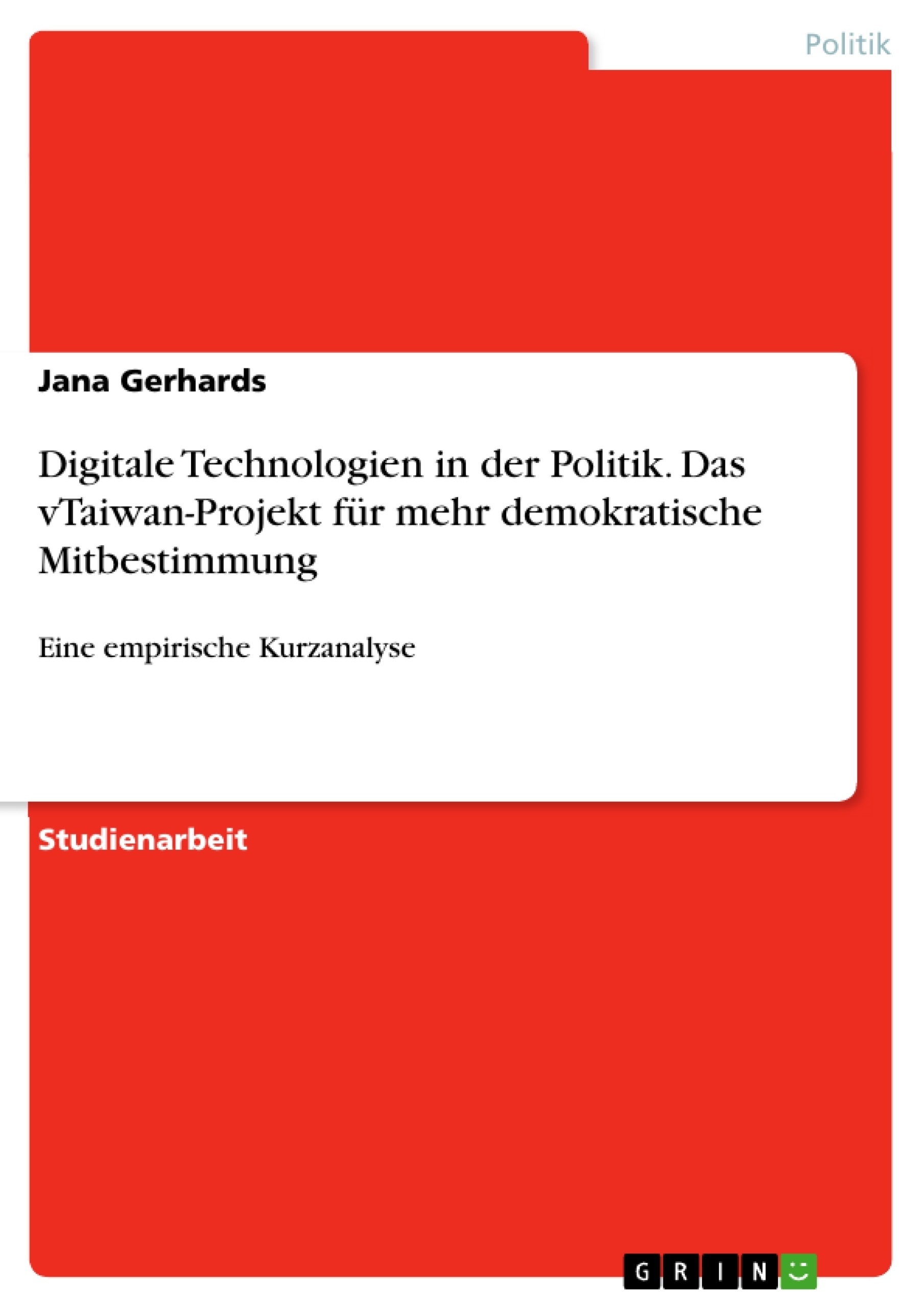Diese Arbeit widmet sich der Frage, inwiefern digitale Technologien in Taiwan zu neuen Formen der demokratischen Mitbestimmung führen. Es wird die Hypothese verfolgt, dass digitale Technologien politische Partizipation am politischen Diskurs fördern und damit insgesamt die taiwanesische Demokratie stärken.
Zunächst werden in Kapitel 2 die grundlegenden Begriffe Digitale Demokratie und E-Partizipation in ihren Grundzügen erläutert. In Kapitel 3 wird sich den demokratischen Potenzialen des Internets auf theoretischer Ebene angenähert. Dazu wird das demokratietheoretische Konzept der starken Demokratie (strong democracy) von Benjamin Barbers herangezogen, die der Partizipationstheorie zugeordnet werden kann. Kapitel 4 widmet sich der empirischen Analyse von vTaiwan, indem zunächst die Entstehung und die Prozessstrukturen des Experiments erläutert werden.
Anschließend wird die UberX-Fallstudie untersucht, die zu den am häufigsten diskutierten Erfolgen von vTaiwan gehört und die Eigenschaften des vTaiwan-Prozesses noch mal hervorhebt. Abschließend werden die Ergebnisse im Fazit zusammengefasst und ein Bogen zu den ursprünglichen theoretischen Überlegungen gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsklärung
- 2.1 Digitale Demokratie
- 2.2 E-Partizipation
- 3. Partizipatorische Demokratietheorie
- 3.1 Theorie der starken Demokratie (,,strong democracy") nach Benjamin Barber
- 3.2 Kritik an der partizipatorischen Demokratietheorie
- 4. vTaiwan-Projekt
- 4.1 Hintergrund
- 4.2 Prozess
- 4.3 UberX-Fallstudie
- 5. Fazit
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss digitaler Technologien auf die politische Partizipation in Taiwan. Die Studie befasst sich mit der Hypothese, dass digitale Technologien die politische Partizipation am Diskurs fördern und damit insgesamt die taiwanesische Demokratie stärken.
- Begriffsklärung von digitaler Demokratie und E-Partizipation
- Theoretische Analyse der starken Demokratie nach Benjamin Barber
- Empirische Analyse des vTaiwan-Projekts
- Bedeutung digitaler Technologien für die Demokratie
- Aktuelle Entwicklungen der politischen Partizipation in Taiwan
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein und beleuchtet die Relevanz digitaler Technologien für die Demokratie in Taiwan. Kapitel 2 erläutert die Begriffe Digitale Demokratie und E-Partizipation. Kapitel 3 widmet sich der partizipatorischen Demokratietheorie, insbesondere der Theorie der starken Demokratie nach Benjamin Barber. Kapitel 4 analysiert das vTaiwan-Projekt als empirisches Beispiel für digitale Partizipation in Taiwan.
Schlüsselwörter
Digitale Demokratie, E-Partizipation, starke Demokratie, Benjamin Barber, vTaiwan-Projekt, Taiwan, politische Partizipation, Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), Bürgerbeteiligung, Online-Plattformen, Crowdsourcing.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des vTaiwan-Projekts?
Das Projekt nutzt digitale Technologien, um neue Formen der demokratischen Mitbestimmung in Taiwan zu schaffen und die politische Partizipation am Diskurs zu fördern.
Was bedeutet "E-Partizipation" in diesem Kontext?
E-Partizipation bezeichnet die Einbindung von Bürgern in politische Entscheidungsprozesse über Online-Plattformen und digitale Kommunikationskanäle.
Was besagt Benjamin Barbers Theorie der "starken Demokratie"?
Barbers Konzept der "strong democracy" betont die aktive Teilnahme der Bürger am politischen Leben als wesentliche Voraussetzung für eine lebendige Demokratie.
Was zeigt die UberX-Fallstudie bei vTaiwan?
Die Fallstudie illustriert, wie vTaiwan erfolgreich einen gesellschaftlichen Konsens über die Regulierung von Fahrdiensten herbeigeführt hat, indem verschiedene Interessengruppen digital eingebunden wurden.
Stärken digitale Technologien die Demokratie in Taiwan?
Die Arbeit verfolgt die Hypothese, dass durch Crowdsourcing und Online-Diskurs die demokratischen Strukturen gestärkt und die Bürgerbeteiligung nachhaltig erhöht werden.
- Quote paper
- Jana Gerhards (Author), 2020, Digitale Technologien in der Politik. Das vTaiwan-Projekt für mehr demokratische Mitbestimmung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/912280