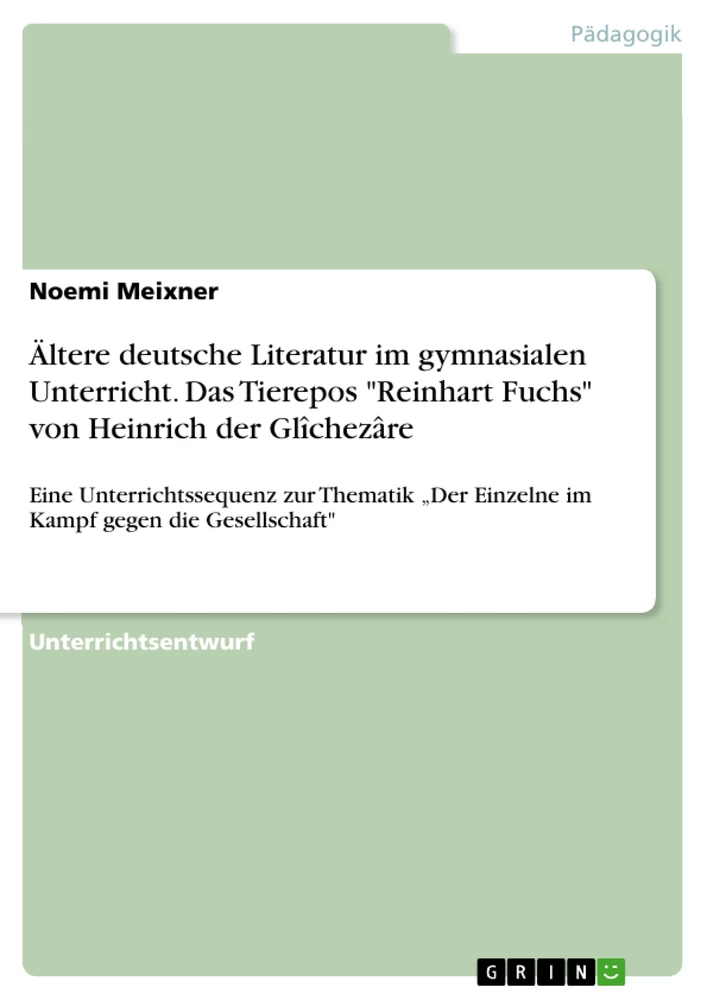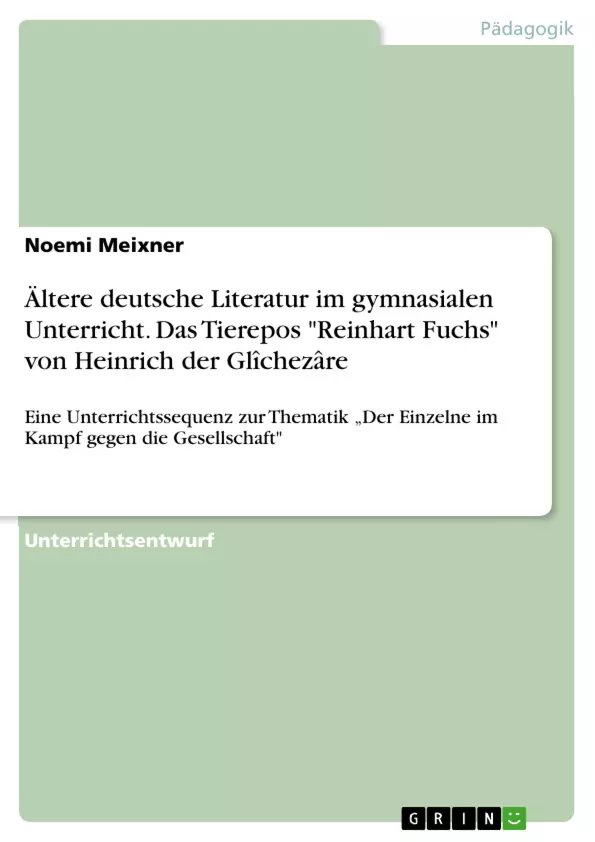In dieser Arbeit wird ein kurzer Überblick der Unterrichtssequenz vorgestellt und anschließend acht doppelstündige Unterrichtseinheiten detailliert didaktisch analysiert. Abschließend werden Chancen und Grenzen älterer deutschen Literatur im schulischen Kontext diskutiert.
Die Vernachlässigung mittelalterlicher Literatur spiegelt sich in der Betrachtung des bayerischen Lehrplans für das Gymnasium wieder. Dort wird im Unterrichtsfach Deutsch lediglich in der Jahrgangsstufe 7 der Kompetenzerwerb mithilfe älterer deutscher Literatur aufgelistet. Dieser Unterrichtsgegenstand scheint einem Randdasein der schulischen Realität verpflichtet, welcher einen Dissens zwischen Befürwortern und Kritikern der Legitimation der Behandlung mittelalterlichen Sujets im Schulalltag sowie den daraus resultierenden didaktischen Stellenwert schürt. Im Rahmen wissenschaftspropädeutischer Seminare haben Lehrkräfte nun speziell an der gymnasialen Oberstufe die Möglichkeit dem Verlust kultureller Identität entgegenzuwirken.
Diesem Interesse folgend entstand im Rahmen einer universitären Veranstaltung eine Unterrichtssequenz, welche epochenübergreifend die Thematik eines Individuums im Kampf gegen die Gesellschaft aufgreift und dabei den Fokus auf den mittelhochdeutschen Tierepos Reinhart Fuchs von Heinrich der Glîchezâre legt. Zentral ist hier der Kampf des einzelnen Bösen gegen die verrottete Gesellschaft und nicht wie so oft umgesetzt, der gute Einzelne gegen das böse Gesellschaftssystem.
Inhaltsverzeichnis
- Motivation und Zielsetzung...
- Eine Unterrichtssequenz zur Thematik „Der Einzelne im Kampf gegen die Gesellschaft. Wie es dem klugen Fuchs Reinhart gelingt, die verrottete Feudalgesellschaft des König Vrevel zu sprengen.“.
- Erste Unterrichtseinheit: Ein Schritt zurück - Eine Zeitreise in die Vergangenheit.....
- Reaktivierung des Vorwissens durch (audio-) visuelle Reize.....
- Vermittlung von Sach- und Sprachkompetenz durch die Erarbeitung sprachlicher und geschichtlicher Aspekte des Mittelalters
- Festigung des Lernzuwachses durch die Erstellung einer Mindmap
- Zweite Unterrichtseinheit: Das erste deutsche Tierepos Reinhart Fuchs.
- Die Überlieferungsgeschichte als Basis für das Unterrichtsgeschehen..
- Schaffung eines Rahmengerüsts...
- Erarbeitung und Klärung zentraler Begrifflichkeiten mithilfe wissenschaftlicher Texte ....
- Dritte Unterrichtseinheit: Die Bedeutung der sprechenden Namen im Tierepos.........
- Definition sprechender Namen: Prinzip des spielerischen Lernens …....
- Nomen est omen: Sprechende Namen und deren Umsetzung im Reinhart Fuchs.
- Präsentation als Mittel der Schüleraktivierung
- Vierte Unterrichtseinheit: Die Bedeutung der sprechenden Namen im Tierepos..........
- Rollenspiel zur Reaktivierung des Vorwissens.....
- Die Ermittlung innerer und äußerer Eigenschaften zentraler Figuren des Tierepos
- Abschlussdiskussion..........\li>
- Fünfte Unterrichtseinheit: Die Rolle der Gewalt im Reinhart Fuchs
- Die Differenzierung zwischen Groß- und Kleintieren in Bezug zu den vorherrschenden Machtverhältnissen des 12. Jahrhunderts als Einstimmung
- Die Rolle der Gewalt und das Verhältnis der Figuren zueinander..
- Die Rechtfertigung von Gewalt...\li>
- Sechste Unterrichtseinheit: Machtverhältnisse als Legitimation für die Bestrafung der Tiere....
- Die Entstehung von nôt aus untriuwe als Rechtfertigung des Fuchses.
- Vorbereitung für die szenische Darstellung des Gerichtsverfahrens
- Ausblick.....
- Chancen und Grenzen des Umgangs mit dem Mittelalter im schulischen Kontext.....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der didaktischen Relevanz des mittelalterlichen Tierepos "Reinhart Fuchs" im schulischen Kontext. Der Fokus liegt darauf, wie der Text Schülern und Schülerinnen die Thematik des "Einzelnen im Kampf gegen die Gesellschaft" näher bringen kann, insbesondere anhand des Konflikts zwischen dem intelligenten und intriganten Fuchs Reinhart und der verrotteten Feudalgesellschaft des Königs Vrevel. Dabei sollen wichtige Aspekte des Mittelalters, wie die politische Ordnung, gesellschaftliche Machtstrukturen und die Rolle der Gewalt, erarbeitet und kritisch reflektiert werden.
- Die Bedeutung von Fabeln und Tiergestalten als Spiegelbild der Gesellschaft
- Die Rolle der Gewalt und die Rechtfertigung von Gewalt im Mittelalter
- Machtverhältnisse und Herrschaftsstrukturen im Mittelalter
- Die Sprache und die Überlieferungsgeschichte des Reinhart Fuchs
- Die didaktische Gestaltung von Unterrichtseinheiten zum Reinhart Fuchs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Motivation und Zielsetzung, die die Bedeutung des Mittelalters im Deutschunterricht beleuchtet. Die Vernachlässigung mittelalterlicher Literatur wird kritisiert und die Notwendigkeit, Schülern und Schülerinnen den Zugang zu dieser Epoche zu ermöglichen, betont. Der Reinhart Fuchs wird als Beispiel für einen interessanten und relevanten Text vorgestellt, der verschiedene Themen wie Macht, Gewalt und gesellschaftliche Konflikte aufgreift.
Im zweiten Kapitel wird eine Unterrichtssequenz zum Reinhart Fuchs vorgestellt, die in sechs Unterrichtseinheiten gegliedert ist. Die einzelnen Einheiten befassen sich mit verschiedenen Aspekten des Textes, wie die historische und sprachliche Einordnung, die Analyse von sprechenden Namen, die Rolle der Gewalt und die Erarbeitung von Figurencharakteren.
Die Arbeit schließt mit einer Betrachtung der Chancen und Grenzen des Umgangs mit dem Mittelalter im schulischen Kontext.
Schlüsselwörter
Reinhart Fuchs, Tierepos, Mittelalter, Feudalgesellschaft, Machtverhältnisse, Gewalt, Literaturdidaktik, Unterrichtssequenz, Sprachbewusstsein, historische Einordnung, didaktische Gestaltung
- Quote paper
- Noemi Meixner (Author), 2019, Ältere deutsche Literatur im gymnasialen Unterricht. Das Tierepos "Reinhart Fuchs" von Heinrich der Glîchezâre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/912344