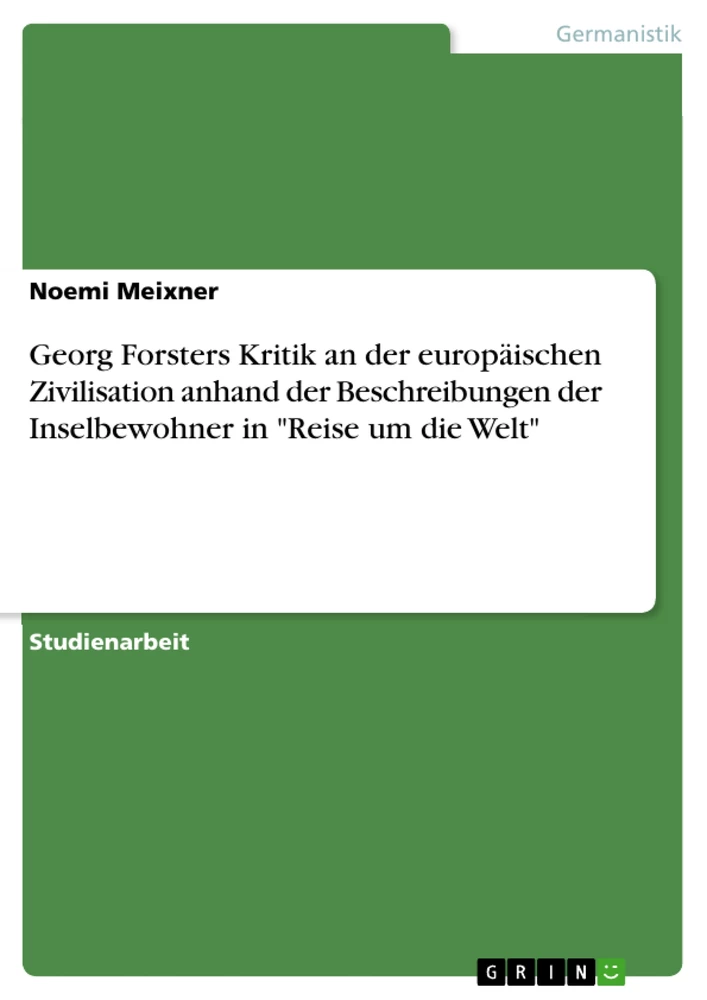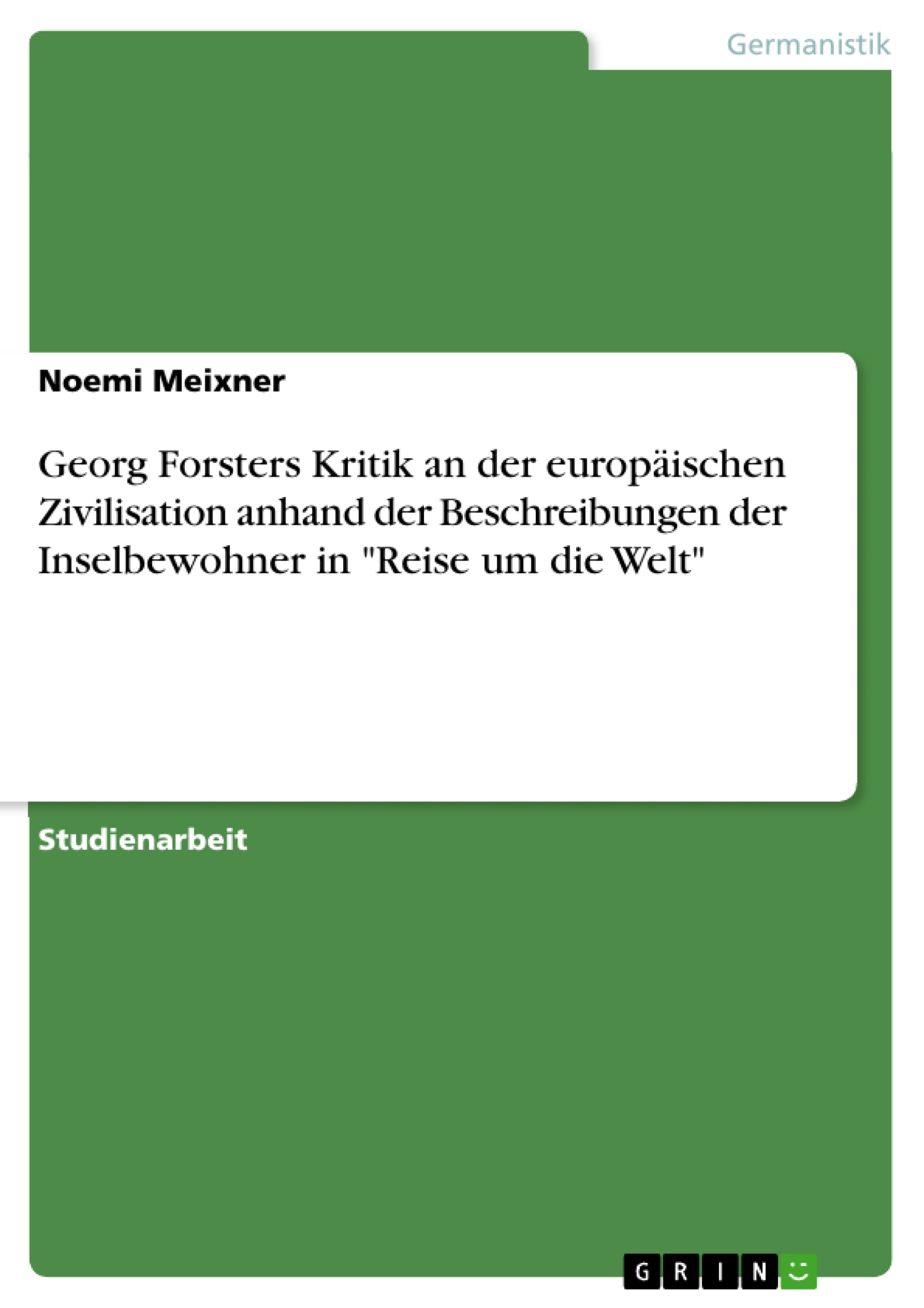In dieser Arbeit wird zunächst wird erläutert, wie der Topos des „edlen Wilden“ entstand und inwieweit Georg Forster sich tatsächlich von dem Klischee beeinflussen ließ. Anhand der Analyse der Aufenthalte auf Tahiti und der Tierra del Fuego wird diesem Topos nachgegangen und erforscht, wie Forster zu den Einwohnern steht und ob das zeitgenössische Bild des „edlen Wilden“ sich hier wiederfinden lässt.
Zentral ist hierbei die Frage, wie Forster den Begriff des „edlen Wilden“ verwendet und welche Bedeutung ihm zusteht. Auffallen wird, dass sein Vorhaben eine nüchterne und sachliche Reisebeschreibung anzufertigen, nicht zu jeder Zeit umsetzbar ist. In welcher Weise die Beschreibungen der Inselbewohner zu einer Beurteilung der eigenen Kultur führen, wird abschließend erklärt.
Georg Forsters Reisebericht „Reise um die Welt“, welcher erstmals 1777 in englischer Sprache unter dem Titel „A voyage round the world“ veröffentlicht wurde, beschreibt die Weltumsegelung von 1772 unter der Führung des britischen Kapitäns James Cook, die zur Erweiterung der Naturkenntnis mit dem Naturforscher J. R. Forster und seinem Sohn Georg Forster unternommen wurde. Ihre Reise führte über den indischen Ozean, Südpazifik und Südatlantik, wobei zahlreiche Inseln wie Tahiti, Tanna, die Freundschaftsinseln und Osterinseln entdeckt wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärung - „edler Wilder\" versus „böser Wilder\"
- Der „,edle“ und „böse Wilde“ bei Georg Forster
- Analyse der Tahiti Aufenthalte
- Erster Aufenthalt
- Zweiter Aufenthalt
- Analyse des Aufenthalts auf Tierra del Fuego
- Forsters Gebrauch dieser Topoi
- Analyse der Tahiti Aufenthalte
- Forsters Zivilisationskritik
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Georg Forsters Reisebericht „Reise um die Welt“ und untersucht, wie er die Begegnung mit fremden Kulturen und Naturvölkern in seine Zivilisationskritik einbezieht. Dabei steht die Frage im Vordergrund, inwieweit Forsters Beschreibungen von „edlen Wilden“ und „bösen Wilden“ von den gängigen Klischees seiner Zeit beeinflusst sind und ob er tatsächlich eine objektive Sicht auf fremde Kulturen anstrebt.
- Die Entstehung des Topos vom „edlen Wilden“ im 18. Jahrhundert
- Forsters Begegnungen mit den Bewohnern von Tahiti und Tierra del Fuego
- Die Rolle von Natur und Kultur in Forsters Reisebeschreibung
- Forsters Kritik an der europäischen Zivilisation
- Die Auswirkungen von Forsters Reisebericht auf die Wahrnehmung fremder Kulturen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt den Reisebericht von Georg Forster in den Kontext der damaligen Zeit. Sie beleuchtet die Besonderheit von Forsters Beschreibungen und seine Ambition, eine objektive und philosophische Reisebeschreibung zu verfassen. Kapitel 2 widmet sich der Begriffserklärung des „edlen Wilden“ und stellt die unterschiedlichen Interpretationen des Begriffs im 18. Jahrhundert dar.
Kapitel 3 analysiert Forsters Begegnungen mit den Bewohnern von Tahiti und Tierra del Fuego und untersucht, inwiefern er in seinen Beschreibungen von den zeitgenössischen Bildern des „edlen Wilden“ und „bösen Wilden“ beeinflusst ist. Die Frage nach der Objektivität seiner Beobachtungen steht dabei im Mittelpunkt.
Schlüsselwörter
Georg Forster, „Reise um die Welt“, „edler Wilder“, „böser Wilder“, Zivilisationskritik, Aufklärung, Exotismus, Naturvölker, Tahiti, Tierra del Fuego, Objektivität, Reisebeschreibung.
- Quote paper
- Noemi Meixner (Author), 2018, Georg Forsters Kritik an der europäischen Zivilisation anhand der Beschreibungen der Inselbewohner in "Reise um die Welt", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/912354