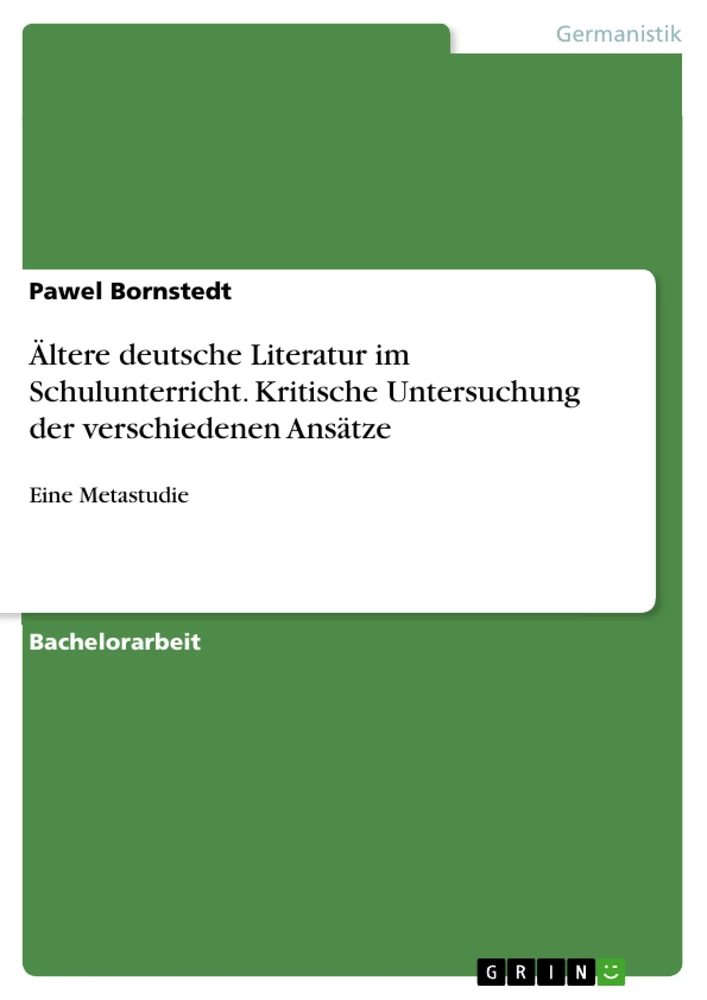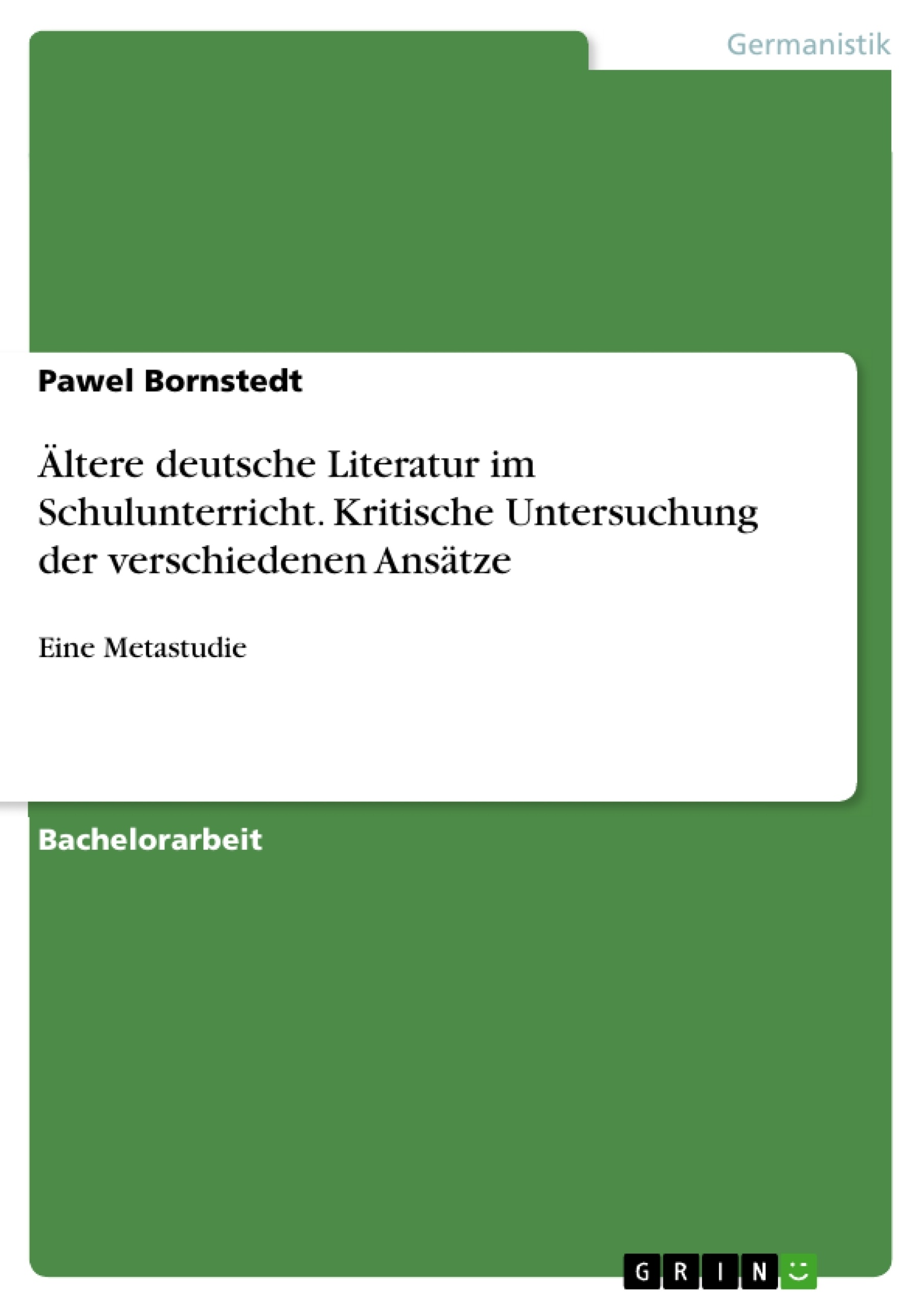Ziel dieser Arbeit ist es nicht Argumente für den Einsatz älterer Literatur in der Schule aufzuzeigen, sondern vor allem die verschiedenen Ansätze zu diesem Thema im Unterricht kritisch zu untersuchen. Die Frage ist somit nicht nur, ob ältere deutsche Literatur zu alt für den modernen Unterricht sei, sondern wie sie dort am besten eingesetzt werden kann.
Um dies zu erreichen wird zuerst der Begriff „ältere deutsche Literatur“ genauer erläutert. Im darauffolgenden Kapitel wird die Ausgangslage analysiert, indem (zukünftige) LK, die SuS und die Fachanforderungen auf die Thematik bezogen untersucht werden. Abschließend für das Kapitel wird die Relevanz für den kompetenzorientierten Unterricht erklärt. All dies gilt für die SEK I und SEK II.
Da damit die ersten Fragen geklärt sind, wird sich der zweite Teil mit den Ansätzen beschäftigen, indem sich exemplarisch mit den Ansätzen der Sprachgeschichte, der Literaturdidaktik, des Gender und der Regionalität kritisch auseinandergesetzt wird. Auch wenn andere Ansätze möglich sind, so sind die genannten diejenigen, die in der Forschungsliteratur auffallend häufig erwähnt werden und für die größtenteils auch Unterrichtsmaterial vorhanden ist. Damit wird sich jedoch erst in den jeweiligen Unterkapiteln genauer auseinandergesetzt. Abschließend folgt ein Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Begriffsklärung
- 1. ,,ältere“
- 2.,,deutsche“
- 3.,,Literatur“
- III. Ausgangslage
- 1. (Zukünftige) Lehrer
- 2. SuS
- 3. Fachanforderungen
- 4. Relevanz für den kompetenzorientierten Unterricht
- IV. Ansätze
- 1. Sprachgeschichtlicher Ansatz
- 2. Literaturdidaktischer Ansatz - Exemplarisch: Thema des Helden
- 3. Genderansatz
- 4. Regionalitätsansatz
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht kritisch verschiedene Ansätze für den Einsatz älterer deutscher Literatur im Unterricht. Die zentrale Frage lautet: Wie kann ältere deutsche Literatur sinnvoll und effektiv im modernen Unterricht eingesetzt werden?
- Definition des Begriffs „ältere deutsche Literatur“
- Analyse der Ausgangslage in Bezug auf Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Fachanforderungen
- Relevanz für den kompetenzorientierten Unterricht
- Kritische Auseinandersetzung mit Ansätzen aus Sprachgeschichte, Literaturdidaktik, Gender und Regionalität
- Zusammenfassung der Erkenntnisse und möglicher Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz der mittelalterlichen Literatur im Kontext der heutigen Zeit heraus. Sie beleuchtet die Beliebtheit des Mittelalters in der Gesellschaft und diskutiert die Gründe für den Rückgang des Einsatzes mittelalterlicher Literatur im Unterricht.
II. Begriffsklärung
Dieses Kapitel widmet sich der Klärung des Begriffs „ältere deutsche Literatur“. Es untersucht die zeitliche Einteilung des Mittelalters und die Schwierigkeiten, die sich bei einer klaren Abgrenzung ergeben.
III. Ausgangslage
Die Ausgangslage analysiert die aktuelle Situation bezüglich des Einsatzes älterer deutscher Literatur im Unterricht. Es beleuchtet die Perspektive der Lehrkräfte, der Schülerinnen und Schüler sowie die aktuellen Fachanforderungen.
IV. Ansätze
Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Ansätze für den Einsatz älterer deutscher Literatur im Unterricht.
1. Sprachgeschichtlicher Ansatz
Dieser Abschnitt untersucht den Einsatz der Sprachgeschichte als didaktisches Konzept.
2. Literaturdidaktischer Ansatz - Exemplarisch: Thema des Helden
Dieser Abschnitt beleuchtet die Nutzung der Literaturdidaktik, am Beispiel des Themas „Held“.
3. Genderansatz
Dieser Abschnitt widmet sich dem Einsatz des Genderansatzes im Unterricht.
4. Regionalitätsansatz
Dieser Abschnitt behandelt die Bedeutung des Regionalitätsansatzes.
Schlüsselwörter
Ältere deutsche Literatur, Mittelalter, Literaturdidaktik, Sprachgeschichte, Genderansatz, Regionalitätsansatz, kompetenzorientierter Unterricht, Unterrichtsmaterial, Fachanforderungen, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte
Häufig gestellte Fragen
Warum wird ältere deutsche Literatur im Unterricht seltener gelesen?
Gründe sind oft die Sprachbarriere (Mittelhochdeutsch) und die Annahme, die Themen seien zu weit von der Lebenswelt moderner Schüler entfernt.
Welche didaktischen Ansätze gibt es für mittelalterliche Literatur?
Die Arbeit untersucht den sprachgeschichtlichen Ansatz, den literaturdidaktischen Fokus (z.B. Helden-Thematik), den Genderansatz sowie den Regionalitätsansatz.
Was ist der "Helden-Ansatz" im Unterricht?
Hierbei werden mittelalterliche Heldenfiguren (wie Siegfried) mit modernen Heldenvorstellungen verglichen, um die Relevanz für Schüler greifbar zu machen.
Wie hilft Sprachgeschichte beim Verständnis?
Der sprachgeschichtliche Ansatz zeigt die Entwicklung der deutschen Sprache auf und fördert das Bewusstsein für Sprachwandel und Etymologie.
Gibt es Relevanz für den kompetenzorientierten Unterricht?
Ja, die Auseinandersetzung mit "fremden" Texten schult die Analysefähigkeit, das historische Bewusstsein und die interkulturelle Kompetenz der Lernenden.
- Arbeit zitieren
- Pawel Bornstedt (Autor:in), 2020, Ältere deutsche Literatur im Schulunterricht. Kritische Untersuchung der verschiedenen Ansätze, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/912398