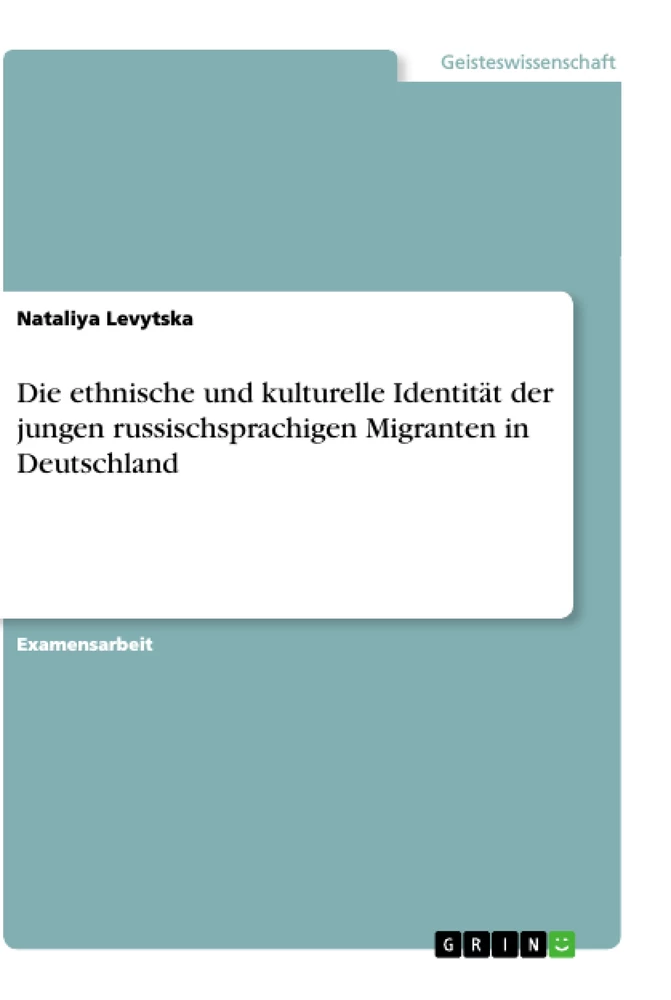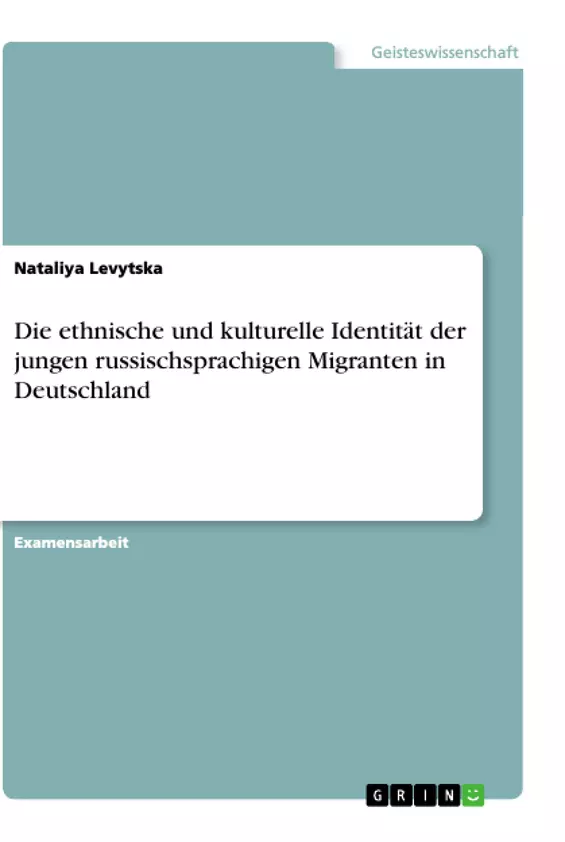Wie definieren die jungen Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, die in der Öffentlichkeit unter dem pauschalisierenden Begriff "Russen" wahrgenommen werden, ihre ethnische und kulturelle Identität und inwiefern wird ihre Identität durch den Aufenthalt in Deutschland beeinflusst? Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist, anhand einer empirischen Studie den Einfluss soziokultureller Hintergründe und persönlicher Einstellungen auf die kulturelle und ethnische Identität der russischsprachigen Jugendlichen in Deutschland zu untersuchen. Von Interesse ist obendrein, welche Gemeinsamkeiten die verschiedenen Migrantengruppen, vor allem die Kontingentflüchtlinge und Aussiedler, die oftmals von den Medien und der Bevölkerung als „Russen“ gesehen werden, bei der Anpassung an die Einwanderungsgesellschaft aufweisen. Allerdings liegt der Schwerpunkt dieser Untersuchung nicht auf der ausführlichen Integrationsanalyse der jungen russischsprachigen Zuwanderer, sondern auf der Darstellung der Identitätsentwürfe der jungen russischsprachigen Migranten.
Besonders interessant für die Forschung erscheint die Gruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die während der Pubertät oder Adoleszenz, einer wichtigen Phase der Identitäts- und Persönlichkeitsbildung, nach Deutschland gekommen ist. Diese wurden nach Ende des kommunistischen totalitären Regimes plötzlich mit der „fremden“ westlichen demokratischen Lebenswelt konfrontiert. Welche Werte, Einstellungen und Selbstbilder haben nun diese Jugendlichen nach einem längeren Aufenthalt in Deutschland? Bestehen die Kontakte mit Freunden und Verwandten im Heimatsland und wie setzt sich der Freundeskreis nach der Einreise zusammen? Hat sich diese Generation, die mit einem offiziell privilegierten Status eingewandert ist, erfolgreich integriert?
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- PARADOX DER „RUSSISCHEN“ IDENTITÄT IN DEUTSCHLAND
- MEDIALES BILD DER RUSSISCHSPRACHIGEN MIGRANTEN IN DEN 1990ER
- EINREISEBESTIMMUNGEN UND MOTIVE
- AUSSIEDLER
- KONTINGENTFLÜCHTLINGE
- HEIRATSMIGRANTEN, ASYLBEWERBER UND ARBEITS-MIGRANTEN
- FORSCHUNGEN ÜBER RUSSISCHSPRACHIGE MIGRANTEN-GRUPPEN
- MODERNE PROBLEMATIK DER IDENTITÄTSBILDUNG UND DEFINITION DES KLASSISCHEN IDENTITÄTSBEGRIFFS
- DEFINITION DES IDENTITÄTSBEGRIFFS NACH E.H.ERIKSON
- IDENTITÄTSDEFINITION NACH K. HURRELMANN
- IDENTITÄTSTHEORIE VON G.H. MEAD
- ZUSAMMENFASSUNG
- VERGLEICH DER KONTINGENTFLÜCHTLINGE UND AUSSIEDLER IN BEZUG AUF DIE BESONDERHEITEN DER HERAUS-BILDUNG DER ETHNISCHEN UND KULTURELLEN IDENTITÄT SOWIE INTEGRATIONSPROBLEME
- ENTSTEHUNG PERSONALER IDENTITÄT: BIOLOGISCHE UND PSYCHOLOGISCHE AUSSTATTUNG
- GESCHLECHT
- TEMPERAMENT UND GEFÜHLE
- ENTSTEHUNG SOZIALER IDENTITÄT
- ABSTAMMUNGSFAMILIE UND HERKUNFT
- Familiensituation der Aussiedler
- Familiensituation der Kontingentflüchtlinge
- ETHNISCHE, NATIONALE UND KULTURELLE ZUGEHÖRIGKEIT
- Handlungsorientierungen und Akkulturationsstrategien
- Ethnisches und kulturelles Empfinden der Aussiedler
- Ethnisches und kulturelles Empfinden der Kontingentflüchtlinge
- BILDUNGS- UND BERUFSEINRICHTUNGEN
- Beruflicher Status der Aussiedler
- Beruflicher Status der Kontingentflüchtlinge
- FREUNDESKREIS
- Mentalitätsunterschiede
- Sprachgebrauch
- CHANCEN SOZIALER TEILHABE UND POLITISCHER PARTIZIPATION
- EMPIRISCHE STUDIE
- FRAGESTELLUNG UND ARBEITSHYPOTHESEN
- UNTERSUCHUNGSMETHODE UND DURCHFÜHRUNG
- BESCHREIBUNG DER STICHPROBE
- GESCHLECHT
- STATUS
- GEBURTSJAHR
- EINREISEJAHR
- HERKUNFTSLAND UND MOMENTANE STAATSANGEHÖRIGKEIT
- AUSWERTUNG
- WOHNORT VOR UND NACH DER EINREISE
- FAMILIENSTATUS UND -FAMILIENWERTE
- RELIGIONSZUGEHÖRIGKEIT UND WERTE
- BILDUNG UND BERUFSSTATUS
- SELBSTWIRKSAMKEITS- UND SELBSTWERTGEFÜHL SOWIE PERSONENBEZOGENE ZUKUNFTSPERSPEKTIVE
- ISOLIERUNG UND DISKRIMINIERUNG
- FREUNDSCHAFTSBEZIEHUNGEN IN DEUTSCHLAND UND HERKUNFTSLAND
- SPRACHGEBRAUCH UND MEDIENNUTZUNG
- NATIONALE UND ETHNISCHE ZUGEHÖRIGKEIT
- POLITISCHES INTERESSE
- SOZIALE TEILHABE (GESELLSCHAFTLICHE PARTIZIPATION)
- DELINQUENZ
- ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der ethnischen und kulturellen Identität junger russischsprachiger Migranten in der Bundesrepublik Deutschland. Sie untersucht die Herausforderungen und Besonderheiten der Identitätsbildung dieser Gruppe, insbesondere im Kontext von Aussiedlern und Kontingentflüchtlingen. Die Arbeit analysiert die Einflüsse von Einwanderungsmotiven, kulturellen Hintergrund, familiären Beziehungen, Bildung und Integrationsprozessen auf die Entwicklung der Identität.
- Herausforderungen der Identitätsbildung junger russischsprachiger Migranten in Deutschland
- Vergleich der Integrationserfahrungen von Aussiedlern und Kontingentflüchtlingen
- Einfluss von kulturellem Hintergrund und familiären Beziehungen auf die Identität
- Rolle von Bildung und Beruf im Integrationsprozess
- Soziale Teilhabe und politische Partizipation russischsprachiger Migranten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Forschungsgegenstand und die Forschungsfragen einführt. Kapitel 2 beleuchtet das mediale Bild der russischsprachigen Migranten in den 1990er Jahren und die unterschiedlichen Einreisebestimmungen und Motive. Es werden Aussiedler, Kontingentflüchtlinge, Heiratsmigranten, Asylbewerber und Arbeitsmigranten genauer betrachtet. Kapitel 3 analysiert die moderne Problematik der Identitätsbildung und definiert den klassischen Identitätsbegriff anhand der Theorien von E.H. Erikson, K. Hurrelmann und G.H. Mead.
Kapitel 4 vergleicht die Herausforderungen der Identitätsbildung von Aussiedlern und Kontingentflüchtlingen. Es werden die Entstehung der persönlichen und sozialen Identität, die Einflüsse von Familie und kulturellem Hintergrund sowie die Rolle von Bildung und Beruf betrachtet. Kapitel 5 stellt eine empirische Studie vor, die die Lebensrealitäten und Erfahrungen junger russischsprachiger Migranten in Deutschland untersucht. Die Ergebnisse der Studie geben Einblicke in die Herausforderungen und Chancen der Integration dieser Gruppe.
Schlüsselwörter
Russischsprachige Migranten, ethnische und kulturelle Identität, Identitätsbildung, Integration, Aussiedler, Kontingentflüchtlinge, Familienstruktur, Bildung, Beruf, soziale Teilhabe, politische Partizipation, empirische Studie, Deutschland.
- Citation du texte
- Nataliya Levytska (Auteur), 2009, Die ethnische und kulturelle Identität der jungen russischsprachigen Migranten in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/912688