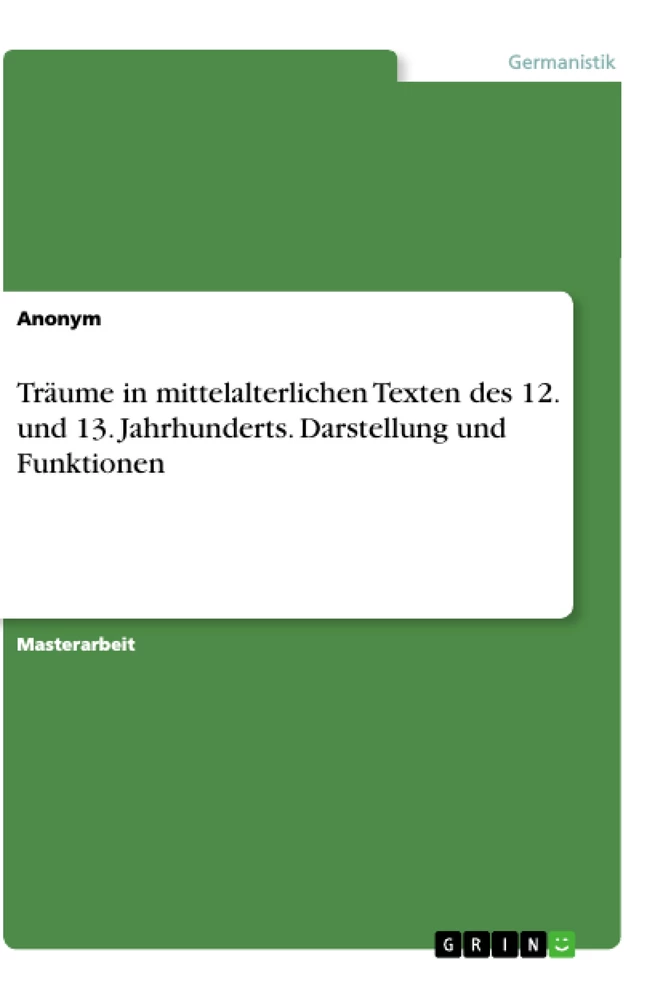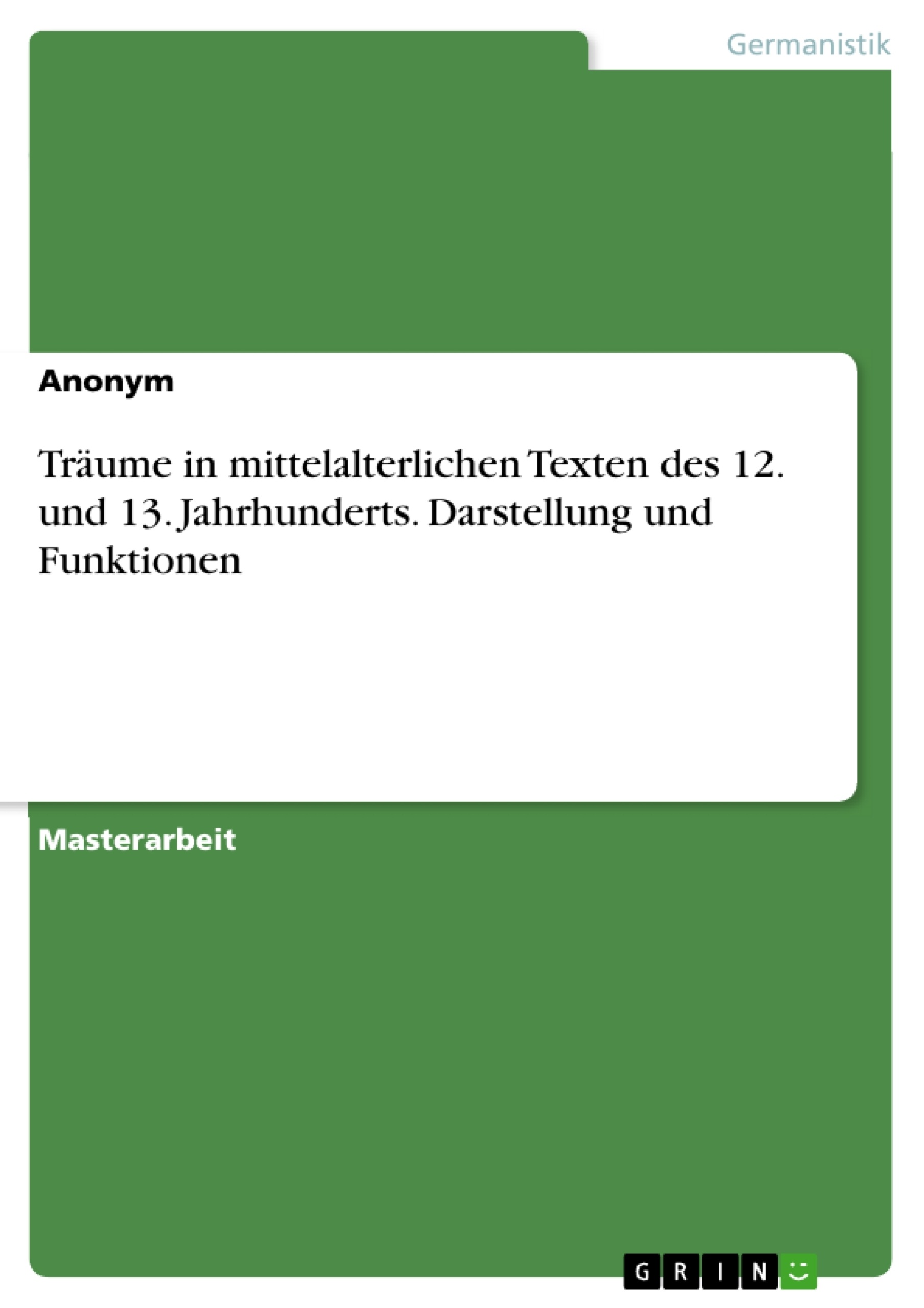Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung von Träumen in mittelalterlichen Texten. Dabei steht im Zentrum des Interesses zum einen die Darstellung der in den jeweiligen Werken aufgeführten Träume, zum anderen sollen ihre Funktionen vor dem Hintergrund des entsprechenden Handlungsgeschehens beleuchtet werden. Die Begrenzung auf ausgewählte Träume aus dem "Nibelungenlied", der "Nibelungenklage" sowie dem "Parzival" und dem "Prosa-Lancelot" begründet sich einerseits aus ihrer Zugehörigkeit zur epischen Dichtung und der einheitlichen Entstehungszeit im 12. und 13. Jahrhundert.
Andererseits soll die Tatsache, dass die thematisierten Träume Werken entstammen, welche unterschiedlichen Gattungen angehören, die Präsenz der fiktiven Träume in verschiedenen Textformen des Mittelalters betonen. Deren eminente Relevanz für die gesamte mittelalterliche Literatur soll schließlich anhand einer zusammenfassenden Darstellung der wesentlichen Ergebnisse deutlich werden, mit denen die vorliegende Arbeit abschließt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kontexte mittelalterlicher Träume
- 2.1 Die Relevanz der antiken Traumauffassung für das abendländische Mittelalter
- 2.2 Die Ursprünge der Traumdeutung und ihre Relevanz für das abendländische Mittelalter
- 2.3 Träume im kirchlichen Kontext
- 2.4 Zum Traum und zur Traumdeutung im Mittelalter
- 3. Literarische Träume im abendländischen Mittelalter
- 3.1 Die Träume im „Nibelungenlied“
- 3.1.1 Kriemhilds Falkentraum
- 3.1.2 Kriemhilds Eber- und Bergtraum
- 3.1.3 Kriemhilds Traum von ihrem Bruder
- 3.1.4 Uotes Vogeltraum
- 3.1.5 Zusammenfassung zu den Träumen im „Nibelungenlied“
- 3.2 Die Träume in der „Nibelungenklage“
- 3.2.1 Die Träume Gotelinds und Dietlinds
- 3.2.2 Zusammenfassung zu den Träumen in der „Nibelungenklage“
- 3.3 Die Träume im „Parzival“
- 3.3.1 Der Traum Herzeloydes
- 3.3.2 Der Traum Parzivals auf der Gralsburg
- 3.3.3 Parzivals Tagtraum - Die Blutstropfenszene
- 3.3.4 Zusammenfassung zu den Träumen im „Parzival“
- 3.4 Die Träume im „Prosa-Lancelot“
- 3.4.1 Hectors Traum von der schwarzen Wolke
- 3.4.2 Galahots Todesträume
- 3.4.3 Zusammenfassung zu den Träumen im „Prosa-Lancelot“
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung und Funktion von Träumen in mittelalterlichen Texten des 12./13. Jahrhunderts. Ziel ist es, die verschiedenen Arten der Traumdarstellung zu analysieren und deren Bedeutung innerhalb der jeweiligen Handlungskontexte zu beleuchten. Die Arbeit betrachtet dabei sowohl die historischen und theoretischen Kontexte der Traumdeutung als auch die konkrete Umsetzung des Traumbildes in ausgewählten literarischen Werken.
- Die Rezeption antiker Traumtheorien im Mittelalter
- Die Funktion von Träumen als Vorhersage zukünftiger Ereignisse
- Die unterschiedlichen Arten der Traumdarstellung in der mittelalterlichen Epik
- Die Rolle von Träumen in der Charakterisierung literarischer Figuren
- Die Bedeutung von Träumen für die Handlungsentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Träume im Mittelalter ein und beschreibt die Faszination und Bedeutung von Träumen über die Jahrhunderte hinweg. Sie skizziert den Fokus der Arbeit auf die literarische Darstellung und Funktion von Träumen in ausgewählten epischen Texten des 12. und 13. Jahrhunderts. Die Arbeit kündigt eine Analyse der Traumbilder und ihrer Funktionen innerhalb der jeweiligen Handlungskontexte an und begründet die Auswahl der untersuchten Texte.
2. Kontexte mittelalterlicher Träume: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Kontexte, die die Interpretation und Verwendung von Träumen im Mittelalter beeinflussten. Es untersucht die Relevanz der antiken Traumauffassungen (Platon, Aristoteles) für das Mittelalter und zeigt auf, wie deren Ansätze in die mittelalterliche Traumdeutung einflossen. Es werden die Ursprünge der Traumdeutung, der Einfluss des kirchlichen Kontextes und die allgemeine Bedeutung von Träumen und Traumdeutung im Mittelalter behandelt. Der Abschnitt legt das Fundament für die anschließende literarische Analyse.
3. Literarische Träume im abendländischen Mittelalter: Das zentrale Kapitel analysiert die Darstellung und Funktion von Träumen in ausgewählten epischen Texten des Hochmittelalters: „Nibelungenlied“, „Nibelungenklage“, „Parzival“ und „Prosa-Lancelot“. Es untersucht die jeweiligen Träume im Detail, beleuchtet ihre Rolle innerhalb der Handlung und erörtert ihre Bedeutung für die Figuren und die narrative Entwicklung der einzelnen Werke. Die Kapitel 3.1 bis 3.4 untersuchen jeweils einzelne Werke und deren Träume umfassend.
Schlüsselwörter
Mittelalterliche Literatur, Träume, Traumdeutung, Epik, Nibelungenlied, Nibelungenklage, Parzival, Prosa-Lancelot, antike Traumauffassung, literarische Funktion, Handlungsgeschehen, Figurencharakterisierung.
Häufig gestellte Fragen zu: Mittelalterliche Träume in Literatur des 12./13. Jahrhunderts
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung und Funktion von Träumen in ausgewählten literarischen Werken des 12. und 13. Jahrhunderts. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der verschiedenen Arten der Traumdarstellung und deren Bedeutung innerhalb der jeweiligen Handlungskontexte.
Welche Texte werden untersucht?
Die Arbeit analysiert Träume im „Nibelungenlied“, der „Nibelungenklage“, „Parzival“ und dem „Prosa-Lancelot“. Die Analyse umfasst eine detaillierte Betrachtung der einzelnen Träume, ihrer Rolle in der Handlung und ihrer Bedeutung für die Figuren und die narrative Entwicklung der jeweiligen Werke.
Welche Aspekte der Träume werden untersucht?
Die Analyse betrachtet die Rezeption antiker Traumtheorien im Mittelalter, die Funktion von Träumen als Vorhersage zukünftiger Ereignisse, die unterschiedlichen Arten der Traumdarstellung in der mittelalterlichen Epik, die Rolle von Träumen in der Charakterisierung literarischer Figuren und die Bedeutung von Träumen für die Handlungsentwicklung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zu den Kontexten mittelalterlicher Träume (einschließlich antiker Einflüsse und des kirchlichen Kontextes), ein zentrales Kapitel zur Analyse der Träume in den ausgewählten literarischen Werken und ein abschließendes Fazit. Das Kapitel zu den literarischen Träumen ist weiter untergliedert nach den einzelnen Werken (Nibelungenlied, Nibelungenklage, Parzival, Prosa-Lancelot) und den jeweiligen Träumen in diesen Werken.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die verschiedenen Arten der Traumdarstellung in mittelalterlichen Texten zu analysieren und deren Bedeutung innerhalb der jeweiligen Handlungskontexte zu beleuchten. Sie untersucht den Zusammenhang zwischen historischen und theoretischen Kontexten der Traumdeutung und der konkreten Umsetzung des Traumbildes in den ausgewählten literarischen Werken.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mittelalterliche Literatur, Träume, Traumdeutung, Epik, Nibelungenlied, Nibelungenklage, Parzival, Prosa-Lancelot, antike Traumauffassung, literarische Funktion, Handlungsgeschehen, Figurencharakterisierung.
Welche historischen und theoretischen Kontexte werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt die Relevanz der antiken Traumauffassung (Platon, Aristoteles) für das abendländische Mittelalter, die Ursprünge der Traumdeutung und deren Relevanz für das abendländische Mittelalter, sowie den Einfluss des kirchlichen Kontextes auf die Traumdeutung im Mittelalter.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2018, Träume in mittelalterlichen Texten des 12. und 13. Jahrhunderts. Darstellung und Funktionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/912929