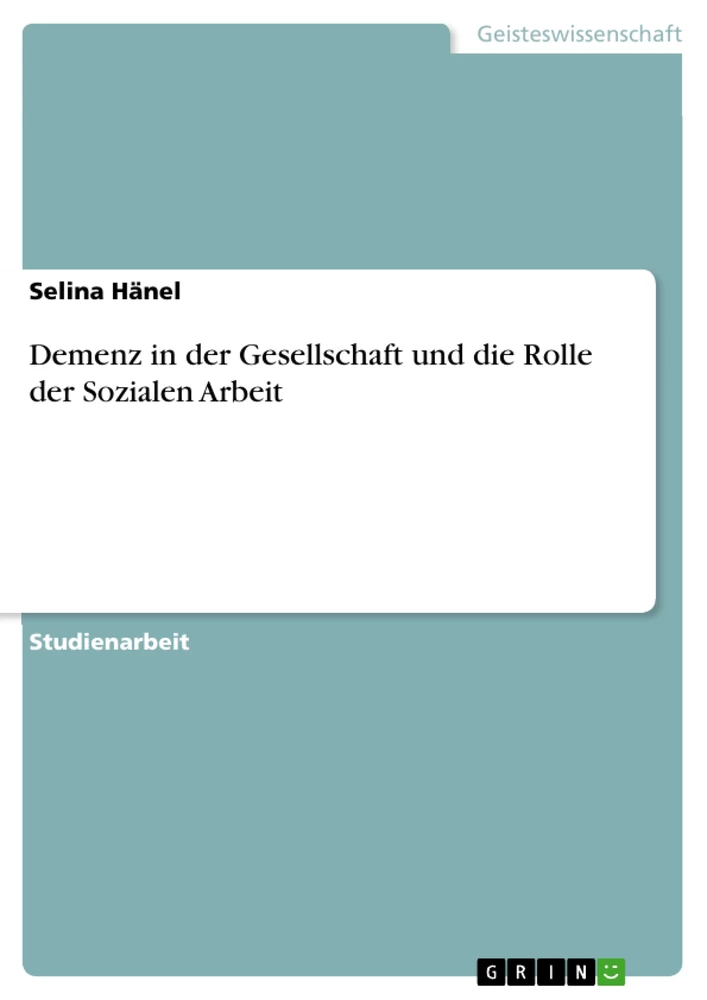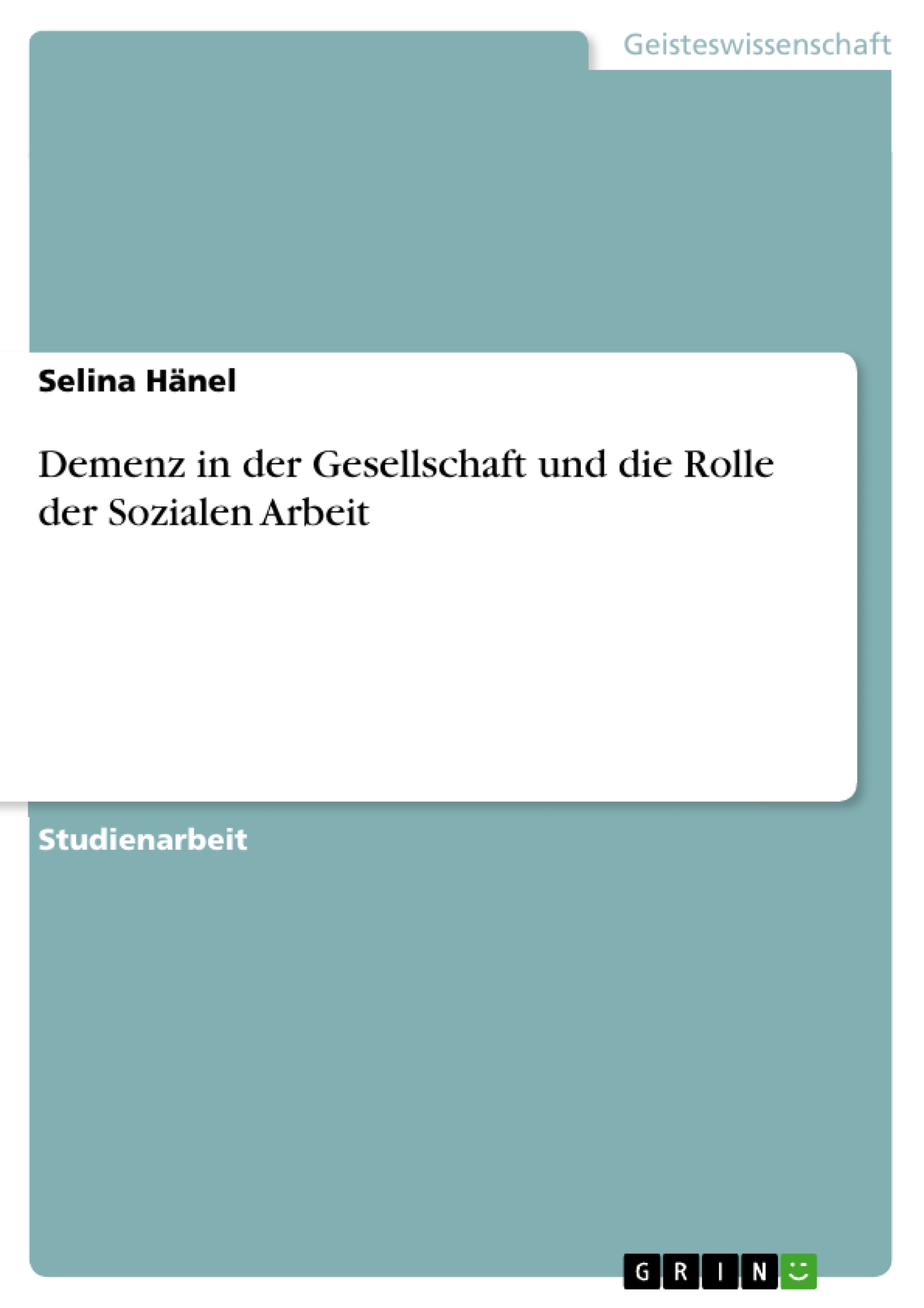Die Arbeit behandelt die Brisanz des Themas Demenz in der Gesellschaft und die Rolle der Sozialen Arbeit. Hierfür wird zuerst auf das Krankheitsbild der Demenz mit verschiedenen Erscheinungsformen eingegangen. Es folgt ein Einordnungsversuch, der Krankheit in die aktuelle Gesellschaft. Das systemische Verständnis und die Verbindung mit der Sozialen Arbeit sind ebenfalls Teil dieser Arbeit. Abschließend folgt ein Rückblick über die Thematik und ein persönlicher Kommentar.
In unserer Gesellschaft sind Betroffene von Demenzerkrankungen eine Zielgruppe des Gesundheitswesens, welche zunehmend in den Fokus rückt. Dadurch, dass die Bevölkerung Deutschlands immer älter wird, steigt auch mit zunehmendem Alter das Risiko an Demenz zu erkranken. Die Schätzung von Demenzkranken in Deutschland für das Jahr 2020 liegen aktuell bei 1,8 Millionen.
Vor allem die Finanzierung der Versorgung spielt gegenwärtig eine große Rolle. Zwar haben sich durch die Pflegereform einige Neuerungen ergeben, welche sich positiv auf Betroffene auswirken, doch da die Pflege Demenzkranker kosten- und zeitintensiv ist, reicht die neue Einordnung in die Pflegegrade bei weitem noch nicht aus. Oftmals stehen Menschen mit Demenz und ihre Versorgung im öffentlichen Diskurs. Daher sind Sozialarbeitende gefragt, in ihrer Arbeitspraxis Stellung zu Diskursthemen, wie der Lebensqualität oder dem Umgang mit Erkrankten, zu beziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsannäherung Demenz
- Ursachen und Symptomatik
- Demenz und Gesellschaft
- Demenz und systemisches Verständnis
- Demenz und soziale Arbeit
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Demenz und untersucht die Brisanz des Themas in der Gesellschaft sowie die Rolle der Sozialen Arbeit im Umgang mit Demenzkranken. Der Fokus liegt auf der Analyse des Krankheitsbildes, der gesellschaftlichen Auswirkungen, der Bedeutung eines systemischen Verständnisses sowie der Aufgaben und Möglichkeiten der Sozialen Arbeit im Kontext von Demenz.
- Das Krankheitsbild der Demenz und seine verschiedenen Erscheinungsformen
- Die gesellschaftlichen Auswirkungen von Demenz und die Herausforderungen für das Gesundheitssystem
- Die Bedeutung eines systemischen Verständnisses für den Umgang mit Demenzkranken und ihren Angehörigen
- Die Rolle der Sozialen Arbeit in der Begleitung von Demenzkranken und ihren Familien
- Der Einfluss von Demenz auf die Lebensqualität von Betroffenen und die Bedeutung von Unterstützung und Hilfestellungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Demenz ein und unterstreicht die zunehmende Bedeutung des Themas in unserer alternden Gesellschaft. Sie verdeutlicht die wachsende Zahl von Demenzkranken in Deutschland und die Herausforderungen, die sich daraus für das Gesundheitssystem und die Sozialarbeit ergeben.
Begriffsannäherung Demenz
Dieses Kapitel liefert eine umfassende Definition des Krankheitsbildes Demenz, unterstreicht die Komplexität der Symptome und die Bedeutung der individuellen Betrachtung der Erkrankung. Es werden die Ursachen und Symptome verschiedener Demenzformen sowie die Klassifizierung der Erkrankung in verschiedene Stadien erläutert. Dabei wird auch auf die Auswirkungen von Demenz auf das Gedächtnis, Verhalten und emotionale Reaktionen eingegangen.
Demenz und Gesellschaft
In diesem Kapitel werden die Auswirkungen von Demenz auf die Gesellschaft und das Gesundheitssystem beleuchtet. Die wachsende Zahl von Demenzkranken stellt die Gesellschaft vor große Herausforderungen, sowohl hinsichtlich der finanziellen Aspekte der Versorgung als auch der Bewältigung der emotionalen und sozialen Folgen der Erkrankung. Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen und Chancen im Umgang mit Demenz im gesellschaftlichen Kontext.
Demenz und systemisches Verständnis
Dieses Kapitel setzt sich mit dem systemischen Verständnis von Demenz auseinander. Es wird betont, dass Demenz nicht nur eine individuelle Erkrankung darstellt, sondern auch die Familien und das soziale Umfeld der Betroffenen beeinflusst. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Interaktion und Beziehungsdynamiken im Umgang mit Demenzkranken und die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Unterstützung von Familien und Angehörigen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Konzepte dieser Hausarbeit sind Demenz, Demenzformen, Gedächtnisstörungen, Verhalten, emotionale Reaktionen, Gesellschaft, Gesundheitssystem, systemisches Verständnis, Soziale Arbeit, Lebensqualität, Unterstützung, Angehörige, Familien und Interaktion.
- Quote paper
- Selina Hänel (Author), 2019, Demenz in der Gesellschaft und die Rolle der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/912978