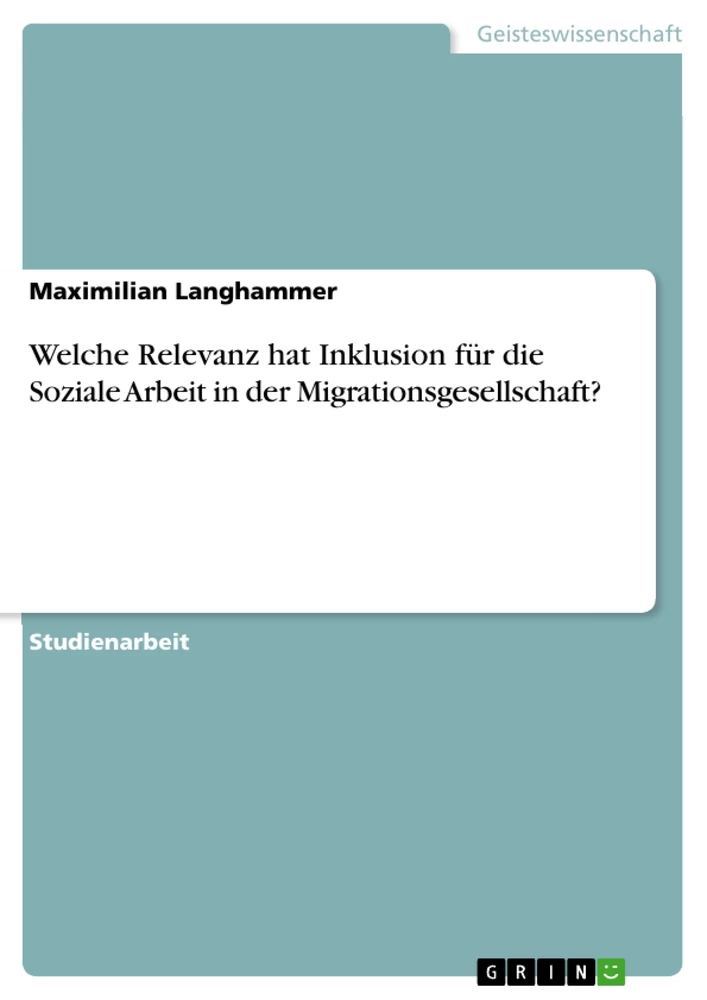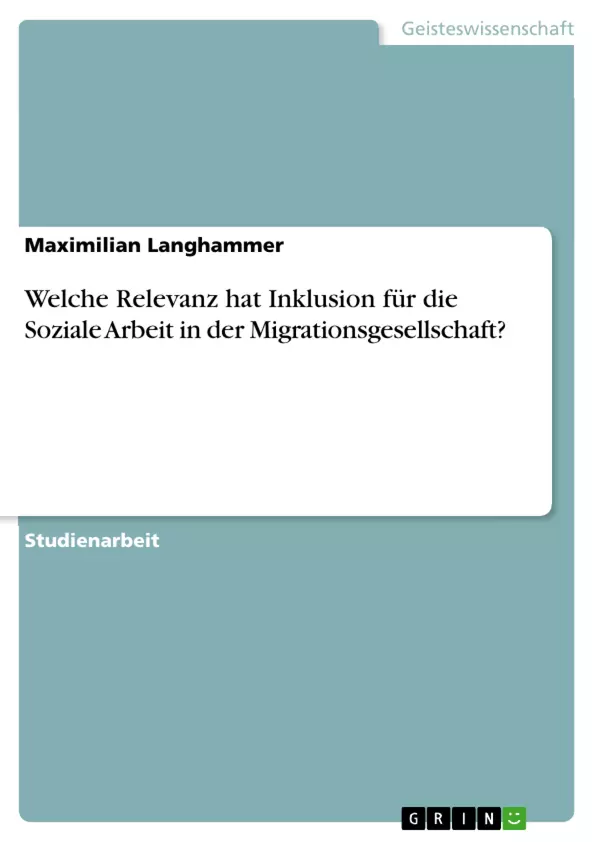Welche Relevanz hat Inklusion für die Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft? Zu Beginn der Arbeit wird die Begründung zur verwendeten Bezeichnung "Migrationsgesellschaft" erläutert. Daraufhin werden die Begrifflichkeiten der Exklusion, Separation, Integration und Inklusion nach dem Modell zur gesellschaftlichen Vielfalt nach Sander definiert. Dabei wird eine vermehrte Fokussierung auf die Termini Integration und Inklusion gelegt, da diese aktuell besonders im öffentlichen Diskurs stehen. Einhergehend wird dabei noch die Begriffsirritation von Integration und Inklusion in Deutschland und die Begründung zur Verwendung des Begriffs der Inklusion statt Integration beleuchtet. Dabei werden die Begrifflichkeiten in dem Kontext "Menschen mit Migrationshintergrund" betrachtet, um diese besser in den Bezug auf die Forschungsfrage eingrenzen zu können. Der Bezug auf die Forschungsfrage wird im fünften Kapitel bearbeitet. Es beschäftigt sich mit den Unterschieden und Gemeinsamkeiten der Konzepte der Integration und Inklusion, um einen Vergleich darstellen zu können. Abschließend wird die Kritik an den Modellen aufgezeigt, um die Möglichkeiten zur Durchsetzung dieser Konzeptionen sowie die pädagogische Relevanz in der Sozialen Arbeit darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Migrationsgesellschaft...
- 3. Modell zur gesellschaftlichen Vielfalt nach Sander...........
- 3.1. Exklusion........
- 3.2. Separation..
- 3.3. Integration.
- 3.4. Inklusion
- 4. Irritation bei den Begrifflichkeiten in Deutschland..
- 5. Vergleich von Integration und Inklusion in Bezug auf Menschen mit Migrationshintergrund.
- 6. Debatte über das Absetzten des Integrationsbegriffes.......
- 7. Kritik an der Inklusion.
- 8. Inklusion in der Sozialen Arbeit..
- 5. Fazit.........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Relevanz von Inklusion für die Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft. Sie analysiert die Entwicklung des Begriffs und die Bedeutung von Inklusion in Bezug auf Menschen mit Migrationshintergrund. Darüber hinaus werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Integration und Inklusion beleuchtet und die Kritik an diesen Konzepten diskutiert.
- Entwicklung des Begriffs der Migrationsgesellschaft und die Relevanz für die Soziale Arbeit
- Bedeutung von Inklusion für Menschen mit Migrationshintergrund
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Integration und Inklusion
- Kritik an den Konzepten der Integration und Inklusion
- Pädagogische Relevanz von Inklusion in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt die Ausgangssituation mit der hohen Anzahl von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland dar und verdeutlicht die Relevanz der Thematik. Außerdem wird die Forschungsfrage formuliert: Welche Relevanz hat Inklusion für die Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft?
- Kapitel 2: Migrationsgesellschaft: Dieses Kapitel erläutert den Begriff der Migrationsgesellschaft im Vergleich zu den Begriffen Einwanderung und Zuwanderung und beleuchtet die Bedeutung des Begriffs für die Soziale Arbeit.
- Kapitel 3: Modell zur gesellschaftlichen Vielfalt nach Sander: Hier wird das Modell zur gesellschaftlichen Vielfalt nach Sander vorgestellt. Die verschiedenen Grade der gesellschaftlichen Teilhabe, nämlich Exklusion, Separation, Integration und Inklusion, werden definiert und erläutert.
- Kapitel 4: Irritation bei den Begrifflichkeiten in Deutschland: Dieses Kapitel widmet sich den unterschiedlichen Begriffsverständnissen von Integration und Inklusion in Deutschland und beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus dieser Irritation ergeben.
- Kapitel 5: Vergleich von Integration und Inklusion in Bezug auf Menschen mit Migrationshintergrund: Dieses Kapitel setzt die beiden Konzepte Integration und Inklusion in Bezug zueinander und analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Hinblick auf Menschen mit Migrationshintergrund.
- Kapitel 6: Debatte über das Absetzten des Integrationsbegriffes: Dieses Kapitel beleuchtet die aktuelle Debatte um den Integrationsbegriff und diskutiert die Argumente für und gegen eine Ablösung durch den Inklusionsbegriff.
- Kapitel 7: Kritik an der Inklusion: In diesem Kapitel werden die Kritikpunkte am Konzept der Inklusion aufgezeigt und diskutiert. Dabei wird auch auf die Möglichkeiten zur Durchsetzung der Inklusion eingegangen.
- Kapitel 8: Inklusion in der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung von Inklusion für die Soziale Arbeit und zeigt die Möglichkeiten und Herausforderungen auf, die sich durch die Umsetzung des Inklusionskonzepts in der Praxis ergeben.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter in dieser Arbeit sind: Inklusion, Integration, Migrationsgesellschaft, Soziale Arbeit, Menschen mit Migrationshintergrund, gesellschaftliche Vielfalt, Teilhabe, Diversität, Partizipation. Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Begriffsverständnisse und die Bedeutung von Inklusion und Integration für Menschen mit Migrationshintergrund in der deutschen Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird der Begriff "Migrationsgesellschaft" in der Sozialen Arbeit verwendet?
Der Begriff betont, dass Migration ein konstitutives Merkmal der gesamten Gesellschaft ist und über Begriffe wie "Einwanderung" hinausgeht, um Vielfalt als Normalzustand zu beschreiben.
Was ist der Unterschied zwischen Integration und Inklusion?
Während Integration oft die Anpassung einer Minderheit an ein bestehendes System fordert, zielt Inklusion auf die strukturelle Veränderung der Gesellschaft ab, um allen Menschen von vornherein Teilhabe zu ermöglichen.
Was beschreibt das Modell zur gesellschaftlichen Vielfalt nach Sander?
Das Modell definiert vier Stufen der Teilhabe: Exklusion (Ausschluss), Separation (Trennung), Integration (Eingliederung) und Inklusion (vollständige Zugehörigkeit).
Welche Relevanz hat Inklusion für Menschen mit Migrationshintergrund?
Inklusion ermöglicht eine gleichberechtigte Partizipation an gesellschaftlichen Prozessen ohne die Notwendigkeit, die eigene kulturelle Identität vollständig aufgeben zu müssen.
Welche Kritik wird am Inklusionskonzept geäußert?
Die Arbeit diskutiert die Schwierigkeiten bei der praktischen Durchsetzung und die Gefahr, dass Inklusion als bloßes Schlagwort ohne echte strukturelle Veränderungen genutzt wird.
- Citation du texte
- Maximilian Langhammer (Auteur), 2020, Welche Relevanz hat Inklusion für die Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/913156