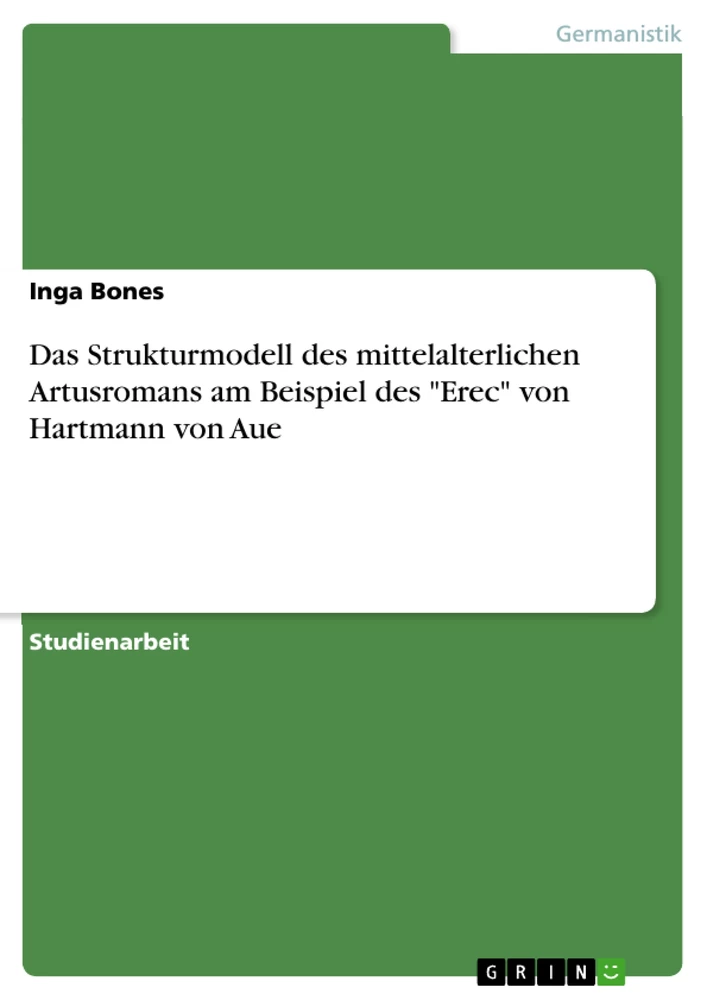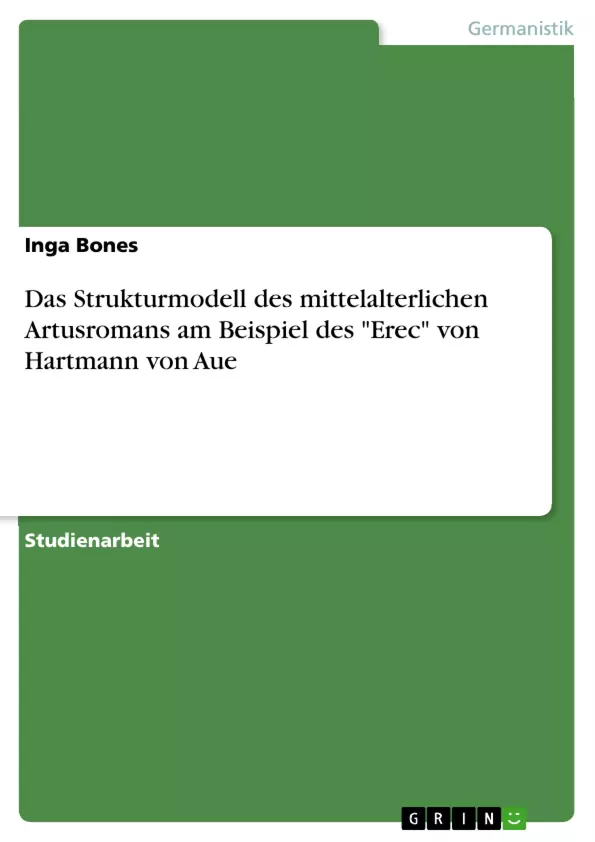Die Faszination, die der Erzählstoff um König Artus und seine Ritter der Tafelrunde auf Generationen von Lesern ausübt, liegt, mit den Worten des Mediävisten Kurt Ruh zu einem nicht unerheblichen Teil darin begründet, dass uns „im Artusroman […] eine dichterische Welt [begegnet], die nicht ihresgleichen hat“; deren „Zauber so stark [ist], daß sie vielfach auf das Leben zurückzuwirken vermochte.“ Drei wichtige Aspekte der Artusepik – ‚aventiure’, ‚êre’ und ‚minne’ – sind und bleiben zentrale Themen des gesellschaftlichen Lebens und der Literatur, welche dieses Leben kritisiert, kommentiert oder karikiert.
Zur Artusliteratur gehören zahlreiche Werke unterschiedlicher Autoren; jedes dieser Werke stellt verschiedene Aspekte in den Vordergrund, fokussiert den Werdegang eines Helden aus dem Kreis der Artusritter – ob Iwein, Erec oder Parzival – und bettet die Handlung auf die eine oder andere Weise in den Erzählstoff um den Artushof ein. Die Handlungsstruktur in den einzelnen Romanen weist dennoch in weiten Teilen Übereinstimmungen auf und soll in dieser Hausarbeit am Beispiel des „Erec“ von Hartmann von Aue exemplarisch aufgezeigt werden.
Der „Erec“, entstanden um 1180/90, gilt als erster Roman Hartmanns und ist zugleich der erste Artusroman im deutschsprachigen Raum. In seiner Bearbeitung orientierte sich Hartmann an der französischen Vorlage Chrétien de Troyes´, die er jedoch nicht einfach übernahm, sondern veränderte und den gesellschaftlichen Verhältnissen und Anforderungen seiner Umgebung anzupassen suchte.
Ziel dieser Arbeit ist es, das strenge Strukturschema aufzuzeigen, entlang dessen der Weg des Helden verläuft, und die Korrespondenz von Handlungs- und Erzählstruktur – insbesondere die Funktion des von Hugo Kuhn erstmals formulierten Doppelweg – zu untersuchen. Als Textgrundlage dient die 26. Auflage (2005) des „Erec“ Hartmann von Aues als mittelhochdeutsche Fassung mit Übertragung ins heutige Deutsch durch Thomas Cramer; erschienen im Fischer Taschenbuch Verlag. Zunächst soll jedoch die Herkunft des Artusstoffes und ihre Adaption durch Chrétien de Troyes skizziert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Von der ,,Matière de Bretagne“ zu Chrétien de Troyes – eine kurze Skizze der Herkunft des Artusstoffes
- 2. Hartmann von Aue und der erste deutsche Artusroman
- 2.1 Der erste Handlungszyklus – „Entfaltung der Motive“
- 2.2 Der zweite Handlungszyklus - „Doppelweg“
- 2.2.1. Die erste Triade
- 2.2.2. Die zweite Triade
- 2.3 Joie de la curt – „Freude des Hofes“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die strenge Struktur des Artusromans „Erec“ von Hartmann von Aue und die Korrespondenz zwischen Handlungs- und Erzählstruktur, insbesondere die Funktion des „Doppelwegs“. Sie analysiert, wie Hartmann von Aues Bearbeitung der französischen Vorlage von Chrétien de Troyes die gesellschaftlichen Verhältnisse seiner Zeit widerspiegelt. Die Arbeit basiert auf der 26. Auflage (2005) des „Erec“ in mittelhochdeutscher Fassung mit Übersetzung von Thomas Cramer.
- Die Herkunft des Artusstoffes und seine Adaption durch Chrétien de Troyes
- Die Struktur des „Erec“ als erster deutscher Artusroman
- Die Funktion des „Doppelwegs“ in der Erzählstruktur
- Die Anpassung der französischen Vorlage an die deutsche Gesellschaft
- Die Beziehung zwischen Handlung und Erzählstruktur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Artusromans ein und hebt die anhaltende Faszination für den Erzählstoff hervor. Sie betont die Bedeutung von „Aventure“, „Êre“ und „Minne“ als zentrale Themen im mittelalterlichen gesellschaftlichen Leben und in der Literatur. Die Arbeit fokussiert auf die Handlungsstruktur im „Erec“ von Hartmann von Aue als exemplarischem Beispiel und erklärt die Bedeutung des Werkes als ersten deutschen Artusroman und Hartmanns Adaption von Chrétien de Troyes' Vorlage. Das Hauptziel der Arbeit wird klar umrissen: die Untersuchung des strengen Strukturschemas des Heldenwegs und die Beziehung zwischen Handlungs- und Erzählstruktur, insbesondere die Funktion des „Doppelwegs“, zu analysieren.
1. Von der ,,Matière de Bretagne“ zu Chrétien de Troyes – eine kurze Skizze der Herkunft des Artusstoffes: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des Artusstoffes. Es diskutiert die Rolle von Chrétien de Troyes als wichtiger Gestalter der Artuswelt, der aus pseudohistorischen und unterliterarischen Quellen schöpfte und diese in ein experimentelles literarisches Modell einbettete. Es wird die „Matière de Bretagne“ als junger, überwiegend mündlich überlieferter Stoff vorgestellt, der Chrétien die nötige fiktionale Freiheit für seinen Strukturentwurf bot. Das Kapitel skizziert die Entwicklung des Artusstoffes von der „Historia Britonum“ über Geoffrey von Monmouths „Historia regum Britanniae“ bis zu Waces „Roman de Brut“, wobei die zunehmende Popularität und die Adaption des Stoffes hervorgehoben werden. Schließlich wird spekuliert, warum Chrétien sich diesem Stoff zuwandte, nämlich aufgrund der Möglichkeiten der feudalen und höfischen Adaption des keltisch-bretonischen Stoffes, der die mittelalterliche Gesellschaft ungebrochen und ungetrübt zum Ausdruck bringen konnte.
2. Hartmann von Aue und der erste deutsche Artusroman: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Hartmann von Aue und seinen „Erec“ als den ersten deutschen Artusroman. Es gibt einen knappen Überblick über Hartmanns Leben und seine Quellen, wobei die Bedeutung von Chrétien de Troyes' Einfluss hervorgehoben wird. Das Kapitel beschreibt den Aufbau des „Erec“ und analysiert dessen Funktion, wobei der Fokus auf der Untersuchung der Struktur des Romans im Hinblick auf die Frage nach seinem Zweck liegt. Es wird erwähnt, dass Hartmanns Bearbeitung von Chrétiens Werk nicht nur die Stoffquelle, sondern auch das Vorbild darstellt.
Schlüsselwörter
Artusroman, Hartmann von Aue, Chrétien de Troyes, Erec, Matière de Bretagne, Doppelweg, Handlungsstruktur, Erzählstruktur, mittelhochdeutsche Literatur, höfische Literatur.
Häufig gestellte Fragen zu Hartmann von Aues "Erec"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Struktur von Hartmann von Aues Artusroman "Erec" und untersucht die Beziehung zwischen Handlungs- und Erzählstruktur, insbesondere die Funktion des „Doppelwegs“. Sie beleuchtet die Adaption der französischen Vorlage von Chrétien de Troyes durch Hartmann von Aue und deren Spiegelung der gesellschaftlichen Verhältnisse des Mittelalters. Die Analyse basiert auf der 26. Auflage (2005) des "Erec" mit Übersetzung von Thomas Cramer.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Herkunft des Artusstoffes und dessen Adaption durch Chrétien de Troyes, die Struktur des "Erec" als ersten deutschen Artusromans, die Funktion des „Doppelwegs“ in der Erzählstruktur, die Anpassung der französischen Vorlage an die deutsche Gesellschaft und die Beziehung zwischen Handlung und Erzählstruktur.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Kapitel und einen Abschnitt mit Schlüsselbegriffen. Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt das Ziel der Arbeit. Kapitel 1 behandelt die Herkunft des Artusstoffes und die Rolle Chrétien de Troyes. Kapitel 2 konzentriert sich auf Hartmann von Aue und seinen "Erec", seine Struktur und Funktion. Die Kapitelzusammenfassungen bieten einen Überblick über den jeweiligen Inhalt.
Welche Bedeutung hat der „Doppelweg“ im "Erec"?
Der „Doppelweg“ ist ein zentraler Aspekt der Erzählstruktur im "Erec", der in der Arbeit detailliert untersucht wird. Seine Funktion innerhalb der Handlungs- und Erzählstruktur wird analysiert, um die Gesamtstruktur des Romans besser zu verstehen.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert primär auf der 26. Auflage (2005) des "Erec" von Hartmann von Aue in mittelhochdeutscher Fassung mit Übersetzung von Thomas Cramer. Zusätzlich werden die Entstehung und Entwicklung des Artusstoffes von der „Historia Britonum“ über Geoffrey von Monmouths „Historia regum Britanniae“ bis zu Waces „Roman de Brut“ sowie der Einfluss von Chrétien de Troyes berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Artusroman, Hartmann von Aue, Chrétien de Troyes, Erec, Matière de Bretagne, Doppelweg, Handlungsstruktur, Erzählstruktur, mittelhochdeutsche Literatur, höfische Literatur.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die strenge Struktur des Artusromans „Erec“ und die Korrespondenz zwischen Handlungs- und Erzählstruktur zu untersuchen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Analyse der Funktion des „Doppelwegs“ und der Spiegelung der gesellschaftlichen Verhältnisse der Zeit in Hartmanns Adaption von Chrétien de Troyes' Vorlage.
- Quote paper
- Inga Bones (Author), 2007, Das Strukturmodell des mittelalterlichen Artusromans am Beispiel des "Erec" von Hartmann von Aue, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91329