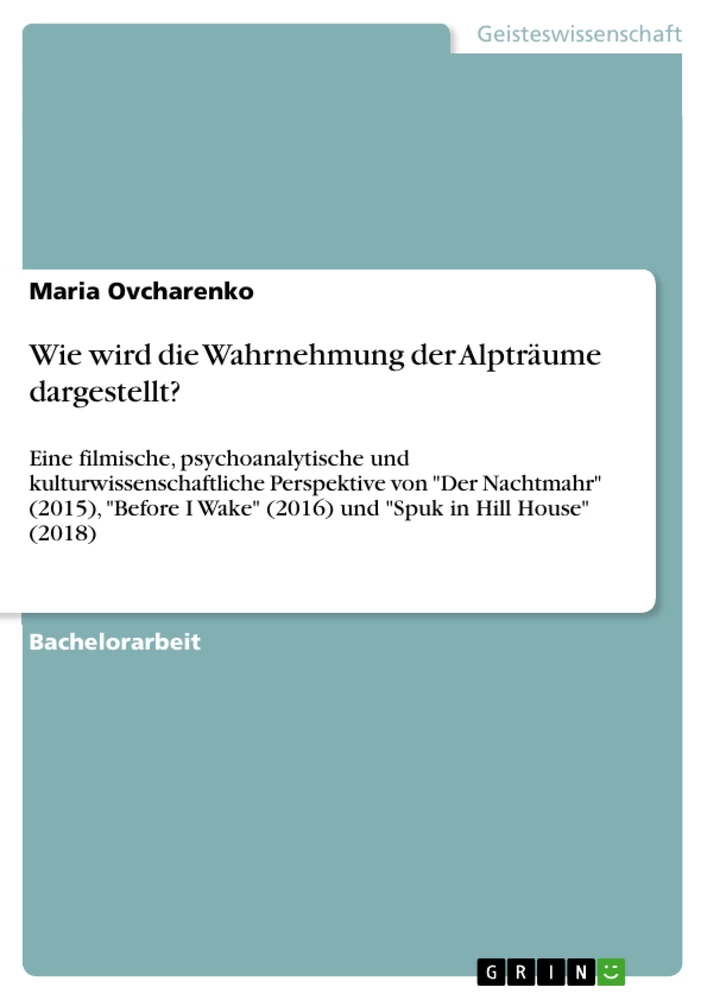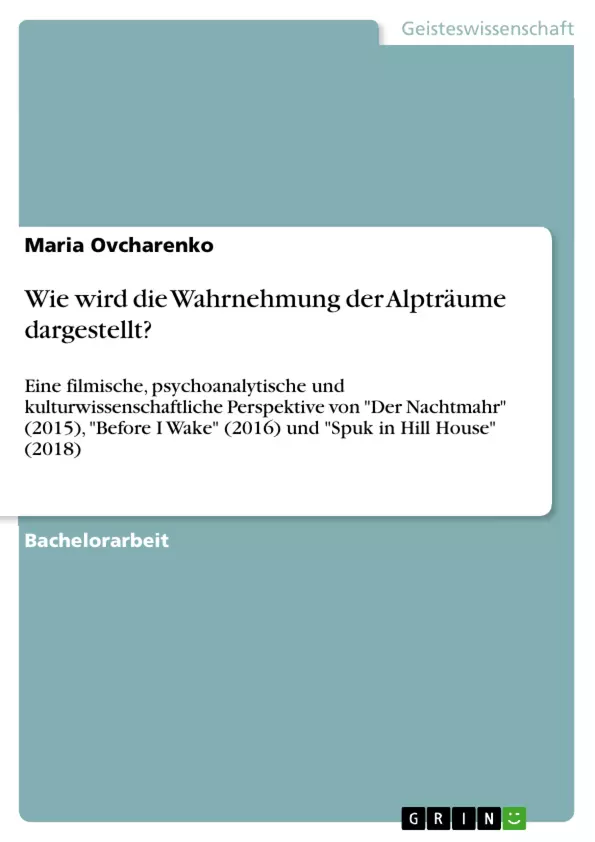Im Jahr 1900 wurde vom Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud unter dem Titel "Die Traumdeutung" eines der umfangreichsten und komplexesten Werke veröffentlicht. Ungefähr zur selben Zeit hat die Erfindung des Mediums Film ihren Ursprung. Kurz nach der Entwicklung dieser neuen Kunstform sind bereits mehrere Filme über Träume entstanden, zum Beispiel die avantgardistischen französischen Filme der 1920er-Jahre. Obwohl sich die Kunst auch davor mit der Abbildung der Träume beschäftigt hatte, schien der Film für die Abbildung innerer Realität prädestiniert zu sein. Seit mehr als hundert Jahren experimentieren die Filmemacher und Filmemacherinnen mit Kamerabewegungen, Ton, Montagetechniken usw., um die Traumphänomene nachzuahmen und die Konzepte von Zeit und Raum zu hinterfragen.
Es entstand eine spannende Beobachtung: Die beiden Konzepte von Film und Traum weisen Unterkategorien auf, die eine düstere und bedrohliche Atmosphäre erschaffen: den Horrorfilm und den Alptraum. Bei der allgemeinen Auseinandersetzung mit diesen Begriffen ist zu folgenden Schlussfolgerungen gekommen: Die erste, allgemeine Gemeinsamkeit dieser „dunklen“ Begriffe besteht in der Verbindung mit tiefen psychischen Prozessen und dem Spiel mit negativ konnotierten Gefühlen, die zweite bezieht sich auf die bildliche Sprache, die sowohl in den Träumen generell als auch im audiovisuellen Filmmedium ihren Platz findet.
Das Ziel der Arbeit besteht im Allgemeinen darin, die Verbindungen der großen Kategorien des Alptraums, des Films und der klassischen Freud‘schen Psychoanalyse anhand dieser drei Filme zu verfolgen. Dabei handelt es sich um die doppelte Wahrnehmung: Erstens wird betrachtet, wie die Charaktere den Alptraum erleben und wie er sich anhand ihrer Stellung mithilfe von Freud‘schen psychoanalytischen und/oder kulturwissenschaftlichen Theorien erklären lässt. Zweitens wird untersucht, wie der Zuschauer den Alptraum auf dem Bildschirm wahrnimmt und welche Rolle filmische audiovisuelle Mittel dabei spielen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Horrorfilme als Medium für die Darstellung der Alpträume
- Begründung der Filmauswahl.
- Der Nachtmahr (2015): Film der „Traumlogik“.
- Ausgangssituation
- Der Nachtmahr und dessen Verhältnis zu Tina
- Der Nachtmahr als Abjekt..
- Der Nachtmahr und die Psychoanalyse: das Wesen als Freud'sches,,Es“
- Bezug zur Romantikepoche
- Before I Wake (2016): Familiendrama und Mutter-Sohn-Beziehung..
- Codys Alpträume und Jessies Visionen: Analyse beider Traumata
- Psychoanalyse: der Alptraum und das Unheimliche.
- Spuk im Hill House (2018): zwischen dem Übernatürlichen und dem Femininen
- Die Figur Olivias und ihre Alpträume.
- Psychoanalytische Erklärung für Olivias Alpträume: Hysterie?.
- Die Frau als das böse Andere
- Fazit......
- Literaturverzeichnis.
- Internetquellen…...........
- Filmauswahl und Videomaterial
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Darstellung der Wahrnehmung von Alpträumen in drei ausgewählten Horrorfilmen – Der Nachtmahr (2015), Before I Wake (2016) und Spuk im Hill House (2018) – aus einer filmischen, psychoanalytischen und kulturwissenschaftlichen Perspektive zu analysieren. Im Zentrum der Arbeit steht die Frage, wie die Alpträume der Figuren in den Filmen inszeniert werden und welche Bedeutung ihnen im Kontext der jeweiligen Handlung zukommt.
- Die Rolle von Horrorfilmen als Medium für die Darstellung der Alpträume
- Die psychoanalytische Interpretation von Alpträumen im Kontext der Filme
- Die Verbindung von Alpträumen mit traumatischen Erlebnissen der Figuren
- Die Verwendung filmischer Mittel zur Inszenierung und Darstellung von Alpträumen
- Die kulturwissenschaftliche Analyse von Alpträumen im Kontext von Geschlecht und Macht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert den Forschungsgegenstand und die Relevanz der Alpträume in der Filmgeschichte. Das zweite Kapitel beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Horrorfilmen und Alpträumen, wobei das Buch "Medienhorror. Mediale Angst im Film" von Florian Leitner als zentrale Quelle dient.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Film "Der Nachtmahr" (2015) und analysiert die Entstehung des Alptraums, das Verhältnis zwischen dem Nachtmahr und der Protagonistin, die Abjekt-Theorie von Julia Kristeva und die Verbindung des Alptraums mit dem Freud'schen "Es".
Das vierte Kapitel behandelt den Film "Before I Wake" (2016) und untersucht die Folgen von traumatischen Ereignissen in der Mutter-Sohn-Beziehung, die Entstehung des Alptraums und die Anwendung der Freud'schen Konzeption des Unheimlichen.
Im fünften Kapitel werden die Alpträume der weiblichen Protagonistin aus "Spuk im Hill House" (2018) betrachtet. Die Analyse umfasst den Zusammenhang der Alpträume mit ihrer Rolle als Frau und Mutter, die Verwendung von filmischen Mitteln zur Inszenierung des Übernatürlichen und die Anwendung kulturwissenschaftlicher Theorien.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Darstellung von Alpträumen in Horrorfilmen, der psychoanalytischen Interpretation von Träumen, dem Einfluss traumatischer Erlebnisse auf die Entstehung von Alpträumen, den filmischen Mitteln der Inszenierung von Alpträumen und der kulturwissenschaftlichen Analyse von Alpträumen im Kontext von Geschlecht und Macht. Wichtige Schlüsselwörter sind: Alpträume, Horrorfilme, Psychoanalyse, Traumdeutung, Traumatische Erlebnisse, Filmanalyse, Audiovisuelle Mittel, Kulturwissenschaft, Geschlecht, Macht, Abjekt, Unheimliches, Hysterie.
Häufig gestellte Fragen
Wie werden Alpträume im Medium Film dargestellt?
Filmemacher nutzen Kamerabewegungen, Ton und Montagetechniken, um die „Traumlogik“ und innere Realitäten auf die Leinwand zu übertragen.
Welche Filme werden in dieser Analyse untersucht?
Die Arbeit analysiert „Der Nachtmahr“ (2015), „Before I Wake“ (2016) und die Serie „Spuk im Hill House“ (2018).
Welche Rolle spielt die Psychoanalyse nach Freud?
Sie dient als Basis, um Alpträume als Ausdruck des „Es“, des Unheimlichen oder traumatischer Erlebnisse der Charaktere zu deuten.
Was ist das „Abjekt“ im Kontext des Films „Der Nachtmahr“?
Basierend auf Julia Kristeva wird das Wesen im Film als Abjekt analysiert, das Grenzen zwischen Ich und Anderem auflöst.
Gibt es eine geschlechtsspezifische Analyse der Alpträume?
Ja, insbesondere bei „Spuk im Hill House“ wird die Verbindung zwischen Alpträumen, Weiblichkeit und der Rolle als Mutter untersucht.
- Citation du texte
- Maria Ovcharenko (Auteur), 2020, Wie wird die Wahrnehmung der Alpträume dargestellt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/913360