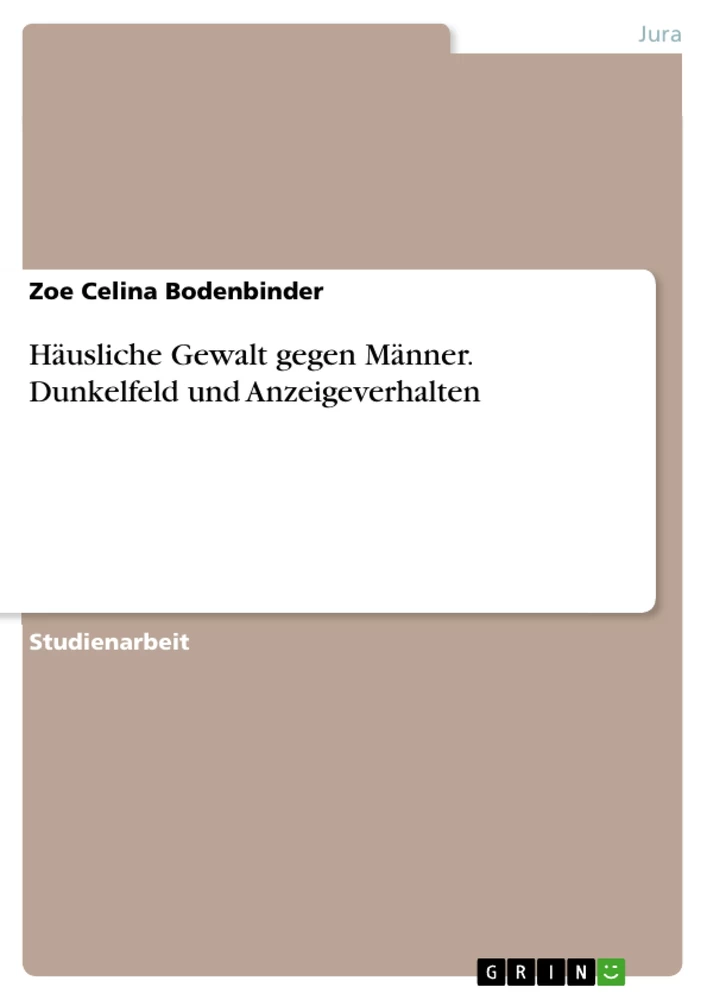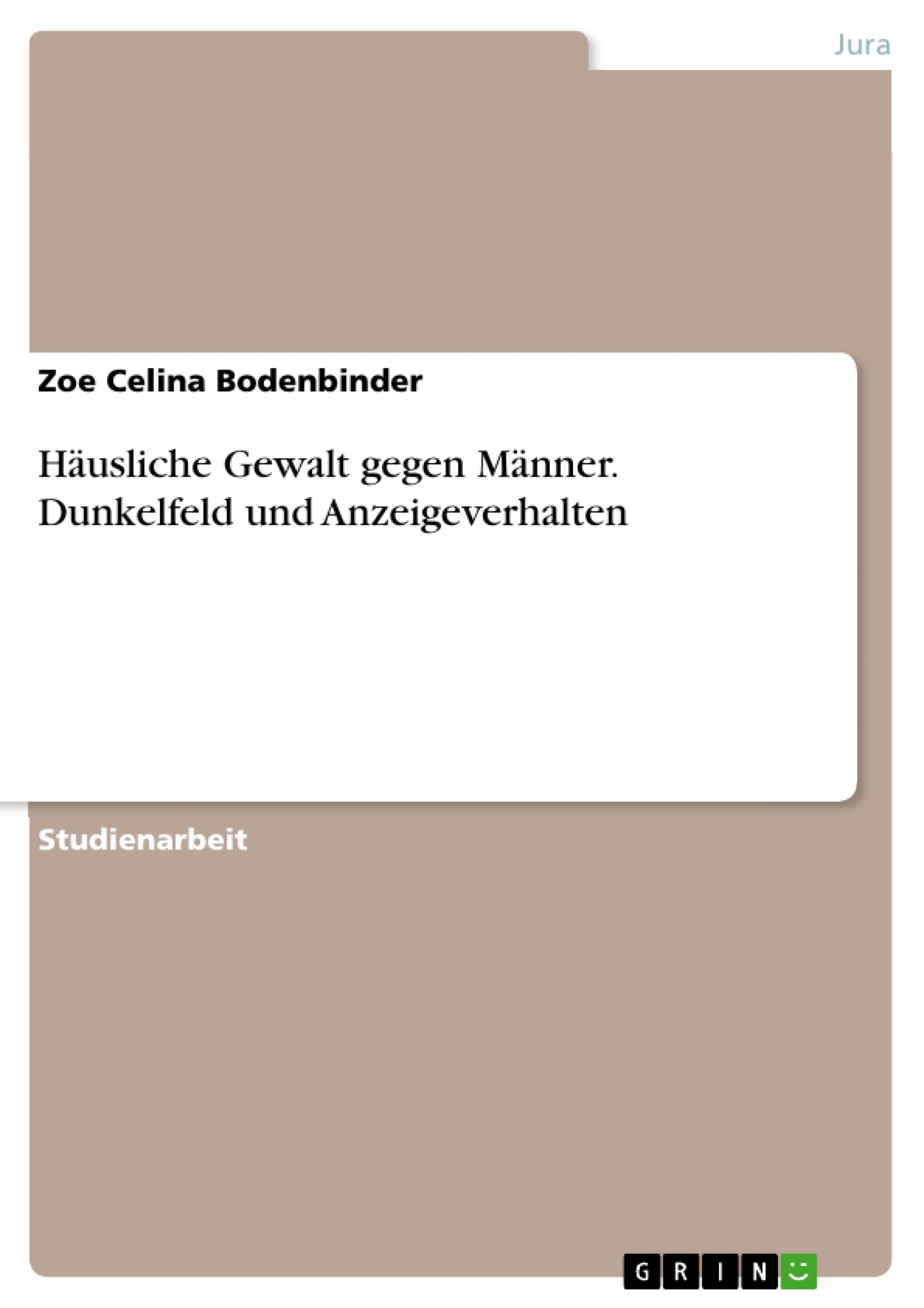In der Arbeit wird zunächst die Thematik der häuslichen Gewalt definiert und deren Erscheinungsformen mit der jeweiligen Strafbarkeit beschrieben. Anschließend werden die Ursprünge der Enttabuisierung der häuslichen Gewalt und die fehlende, damit einhergehende Thematisierung häuslicher Gewalt gegen Männer zur Erklärung der mangelnden Aufmerksamkeit für dieses Thema dargestellt. Außerdem werden die aktuellen Erkenntnisse der Forschung des Bundeskriminalamtes sowie das damit zusammenhängende Dunkelfeld anhand einer Pilotstudie bearbeitet. Es soll dargestellt werden, was die aktuellen Erkenntnisse des Themas sind und wie die Realität im Gegensatz dazu aussieht. Gründe für das Dunkelfeld werden durch das Anzeigeverhalten männlicher Opfer erklärt, welches grundlegend zu dem Dunkelfeld beiträgt. Zuletzt wird auf die (fehlende) Prävention und die aktuellen Hilfsangebote eingegangen.
Folgende Fragen sollen beantwortet werden: Wie hoch ist das Dunkelfeld? Warum gibt es ein Dunkelfeld? Inwieweit trägt das Anzeigeverhalten dazu bei? Warum zeigen Männer häusliche Gewalt gegen sich nicht an?
Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein objektiveres Umgehen mit häuslicher Gewalt von Polizeivollzugsbeamten, anderen staatlichen Organen, aber auch von Angehörigen zu erreichen. Es soll dazu beigetragen werden, einen differenzierteren Blickwinkel auf den Sachverhalt zu haben, statt den Täter vorschnell aufgrund des Klischee-Denkens zu verurteilen. Durch die Problematik des Dunkelfelds soll dazu angeregt werden, bessere Präventions- und Hilfsangebote einzuführen. Außerdem sollen männliche Opfer dazu ermutigt werden, häusliche Gewalt anzuzeigen, indem sie erkennen, dass sie nicht allein sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition häusliche Gewalt
- Erscheinungsformen
- Straftatbestände
- Ursprünge der Vorurteile durch die Gesellschaft
- Aktuelle Erkenntnisse der Forschung
- Das Dunkelfeld
- Pilotstudie
- Anzeigeverhalten männlicher Opfer
- Prävention / Hilfsangebote
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem komplexen Thema der häuslichen Gewalt und analysiert die unzureichende Aufmerksamkeit, die häuslicher Gewalt gegen Männer entgegengebracht wird. Ziel ist es, ein objektiveres Verständnis für häusliche Gewalt zu fördern und den Fokus auf die Bedürfnisse männlicher Opfer zu lenken. Die Arbeit soll dazu beitragen, dass Polizei, Behörden und Angehörige einen differenzierteren Blickwinkel auf die Problematik entwickeln und Vorurteile gegenüber männlichen Opfern abgebaut werden.
- Definition und Erscheinungsformen häuslicher Gewalt
- Ursprünge von Vorurteilen und ihre Auswirkungen auf die Wahrnehmung männlicher Opfer
- Aktuelle Forschungsergebnisse und die Problematik des Dunkelfelds
- Anzeigeverhalten männlicher Opfer und die Ursachen für die Unterreporting
- Präventionsmaßnahmen und Hilfsangebote für männliche Opfer
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt das Thema häusliche Gewalt ein und beleuchtet die Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung von Gewalt gegen Frauen und gegen Männer. Kapitel 2 definiert den Begriff der häuslichen Gewalt und beschreibt ihre verschiedenen Erscheinungsformen, inklusive körperlicher, psychischer und sexueller Gewalt. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Vorurteilen, die die Wahrnehmung von häuslicher Gewalt gegen Männer beeinflussen. Kapitel 4 beleuchtet aktuelle Forschungsergebnisse und das damit verbundene Dunkelfeld, wobei eine Pilotstudie vorgestellt wird. Kapitel 5 analysiert das Anzeigeverhalten männlicher Opfer und beleuchtet die Ursachen für die mangelnde Offenlegung. Kapitel 6 widmet sich den Präventions- und Hilfsangeboten für männliche Opfer.
Schlüsselwörter
Häusliche Gewalt, Männer als Opfer, Dunkelfeld, Anzeigeverhalten, Vorurteile, Prävention, Hilfsangebote.
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist das Dunkelfeld bei häuslicher Gewalt gegen Männer?
Das Dunkelfeld ist laut Forschungsberichten des Bundeskriminalamtes sehr hoch, da männliche Opfer Gewalt seltener zur Anzeige bringen als weibliche Opfer.
Warum zeigen Männer häusliche Gewalt oft nicht an?
Gründe für das geringe Anzeigeverhalten sind oft gesellschaftliche Vorurteile, Klischee-Denken und die Angst, als Opfer nicht ernst genommen zu werden.
Welche Erscheinungsformen von Gewalt werden untersucht?
Die Arbeit beschreibt körperliche, psychische und sexuelle Gewalt sowie deren jeweilige strafrechtliche Relevanz.
Welche Rolle spielt die Polizei beim Thema Gewalt gegen Männer?
Ein Ziel der Arbeit ist es, Polizeivollzugsbeamten einen objektiveren und differenzierteren Blickwinkel zu vermitteln, um vorschnelle Verurteilungen aufgrund von Klischees zu vermeiden.
Gibt es spezielle Hilfsangebote für männliche Opfer?
Die Arbeit analysiert bestehende Hilfsangebote und weist auf die Notwendigkeit hin, die Prävention und Unterstützung für Männer weiter auszubauen.
- Quote paper
- Zoe Celina Bodenbinder (Author), 2019, Häusliche Gewalt gegen Männer. Dunkelfeld und Anzeigeverhalten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/913376