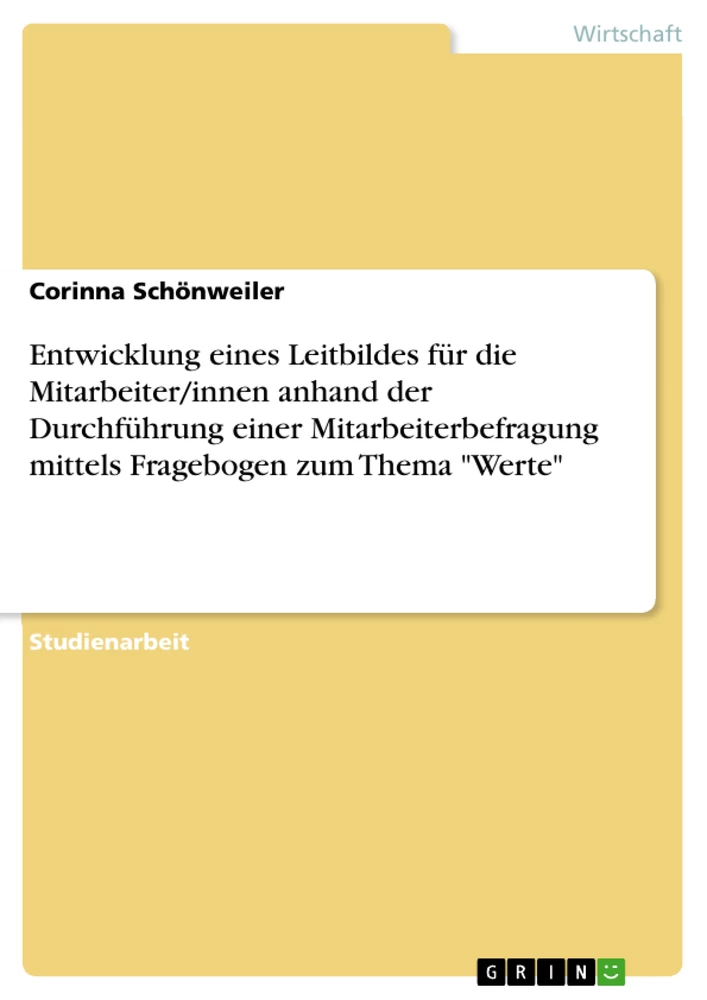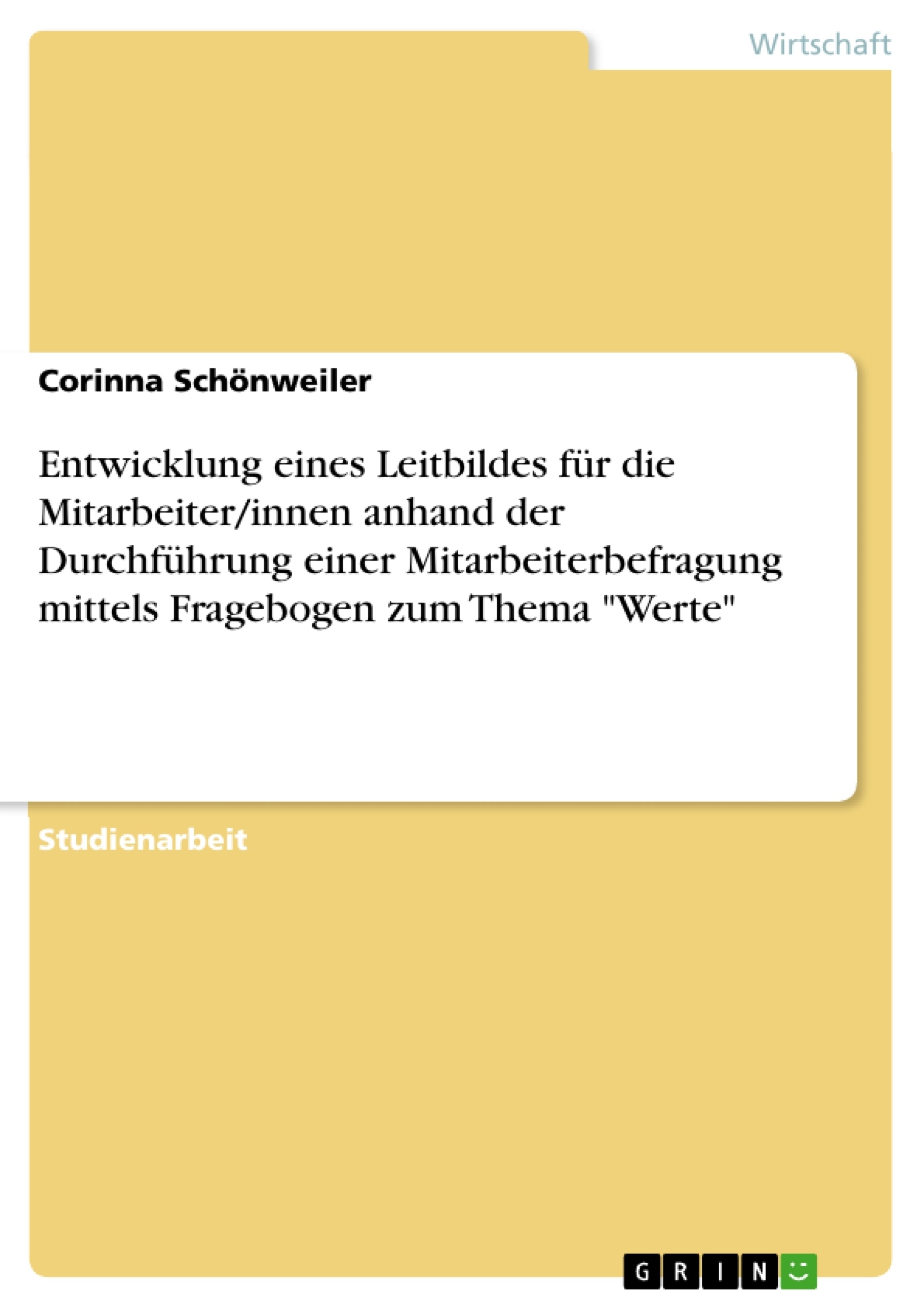In erfolgreichen Unternehmen gehören Veränderungen zum Alltag. Solche Anpassungen sind bspw. aufgrund von sich verändernden Wettbewerbsbedingungen erforderlich, um am Markt erfolgreich bleiben zu können. Eine Schwierigkeit beim Umsetzen von Veränderungen in Unternehmen sind jedoch die Ablehnungshaltungen der Mitarbeiter/innen gegenüber der Neuerungen. Eine Mitarbeiterbefragung, in der die Werte, die den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen am wichtigsten sind, abgefragt werden, dient als Grundlage zur Entwicklung eines Leitbildes. Durch die damit entgegengebrachte Wertschätzung und Anerkennung sollen die Mitarbeiter/innen aus eigenem Antrieb dazu motiviert werden, diese Veränderungen mitzugehen, um den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens zu unterstützen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Definitionen von Werten
- Merkmale von Werten
- Traditionelles Werteverständnis
- Die zehn Grundwerte nach Shalom H. Schwartz
- Die Struktur der Grundwerte
- Vorgehensweise zur Messung der Wertprioritäten
- Modernes bzw. erweitertes Werteverständnis
- Der Wertewandel
- Einflussfaktoren des Wertewandels
- Aktuelle Erhebungen zu derzeit geltenden Wertehaltungen
- Werte innerhalb von Organisationen
- Auswirkungen des Wertewandels
- Umgang mit dem Wertewandel
- Aufbau und Zweck eines Leitbildes
- Beurteilung der theoretischen Grundlagen und Ableitung von Forschungsfragen
- Methodischer Teil
- Entwicklung eines Strukturbaumes, Erläuterung der Variablen und Überleitung zur empirischen Messung
- Durchführung der empirischen Messung in der Praxis
- Erläuterungen zum Fragebogen
- Durchführung der Mitarbeiterbefragung mittels Fragebogen
- Auswertungskriterien
- Diskussion
- Überführung in ein Leitbild
- Kritische Reflexion und Ergebniseinschätzung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Leitbildes für Mitarbeiter, das auf einer empirischen Befragung zur Ermittlung der Werte der Mitarbeiter basiert. Das Ziel ist es, die Mitarbeitermotivation und -zufriedenheit zu steigern und die Akzeptanz von Veränderungen im Unternehmen zu erhöhen.
- Definition und Merkmale von Werten
- Traditionelles und modernes Werteverständnis
- Wertewandel und seine Einflussfaktoren
- Werte in Organisationen und die Entwicklung von Leitbildern
- Empirische Forschung zur Erhebung von Mitarbeiterwerten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problematik ein und stellt die Fragestellung der Hausarbeit vor. Der Theorieteil behandelt den Begriff „Werte“, die Merkmale von Werten und die Entwicklung des traditionellen und modernen Werteverständnisses. Dabei werden die zehn Grundwerte nach Schwartz und der Wertewandel sowie seine Einflussfaktoren erörtert. Im Anschluss werden die Auswirkungen des Wertewandels auf Organisationen und der Aufbau und Zweck von Leitbildern beleuchtet.
Der methodische Teil konzentriert sich auf die Entwicklung eines Strukturbaumes, die Erläuterung der Variablen und die Überleitung zur empirischen Messung. Es wird die Durchführung der Mitarbeiterbefragung mittels Fragebogen beschrieben und die Auswertungskriterien vorgestellt.
In der Diskussion werden die Ergebnisse der Befragung interpretiert und die Überführung in ein Leitbild dargestellt. Des Weiteren erfolgt eine kritische Reflexion der Ergebnisse und eine Einschätzung ihrer Bedeutung für die Praxis.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Hausarbeit sind: Werte, Leitbild, Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterbefragung, Empirische Forschung, Wertewandel, Organisation, Veränderung, Akzeptanz.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist ein Leitbild für Unternehmen wichtig?
Ein Leitbild dient der Orientierung, drückt Wertschätzung aus und motiviert Mitarbeiter, Veränderungen im Unternehmen aktiv mitzutragen.
Wie wurden die Werte der Mitarbeiter ermittelt?
Die Werte wurden durch eine empirische Mitarbeiterbefragung mittels eines Fragebogens erhoben, der als Grundlage für das Leitbild dient.
Was sind die zehn Grundwerte nach Shalom H. Schwartz?
Schwartz definiert universelle Werte wie Selbstbestimmung, Sicherheit, Macht und Universalismus, die die Basis für menschliches Handeln bilden.
Was versteht man unter dem „Wertewandel“?
Der Übergang von traditionellen Werten (Pflicht, Ordnung) zu modernen Werten (Selbstverwirklichung, Partizipation) in der Arbeitswelt.
Wie geht man mit Ablehnungshaltungen gegenüber Neuerungen um?
Durch Einbeziehung der Mitarbeiter und Anerkennung ihrer Werte kann Widerstand reduziert und die Akzeptanz für Veränderungen erhöht werden.
Was ist das Ziel der empirischen Messung in der Praxis?
Die Messung soll die tatsächlichen Wertprioritäten der Belegschaft aufzeigen, um ein authentisches und tragfähiges Unternehmensleitbild zu entwickeln.
- Quote paper
- Corinna Schönweiler (Author), 2020, Entwicklung eines Leitbildes für die Mitarbeiter/innen anhand der Durchführung einer Mitarbeiterbefragung mittels Fragebogen zum Thema "Werte", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/913390