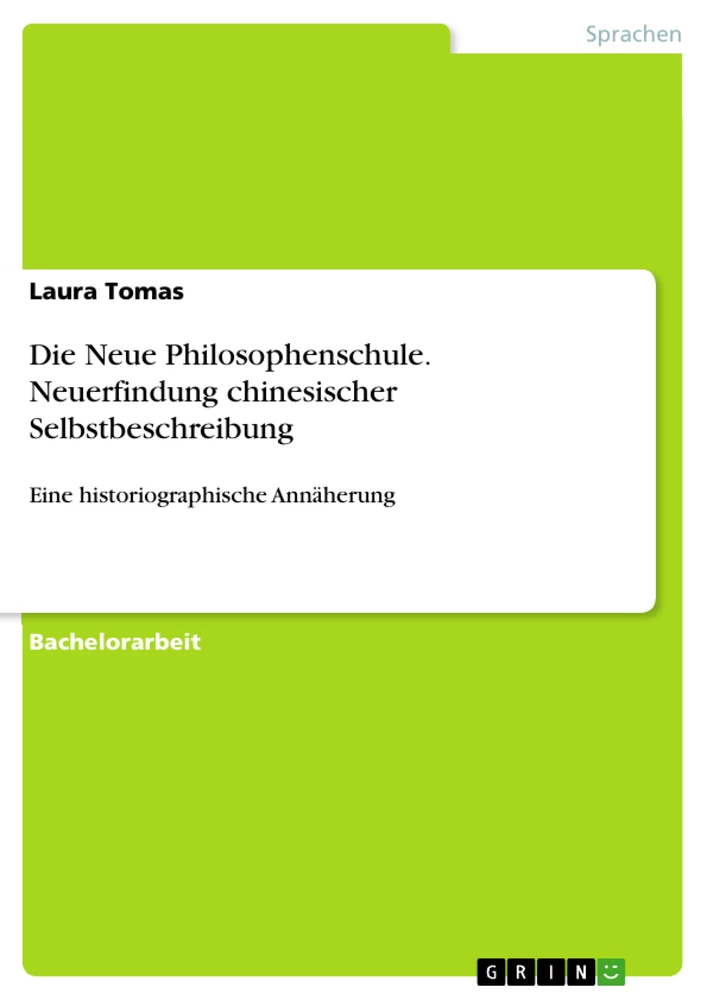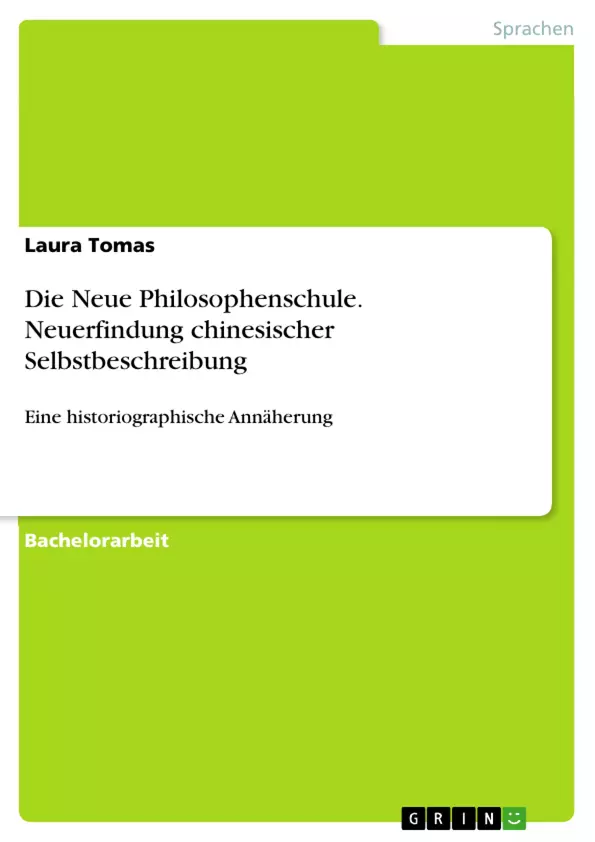Diese Arbeit ist eine historiographische Annäherung an die Neue Philosophenschule. Zeigen soll dieser Ansatz, welchen Einfluss das Verständnis des geschichtsphilosophisch aufgeladenen Projekts von "Moderne und Tradition", beziehungsweise "Alt und Neu", in der Welt des 21. Jahrhunderts auf den intellektuellen Diskurs in China und außerdem auf den interkulturellen Dialog ausübt. Als Vorbild für die gewählte Annäherung an die Thematik wurde die Monographie des chinesischen Autors Q. Edward Wang, "Inventing China Through History: The May Fourth Approach to Historiography" herangezogen.
Die Wahrnehmung von China im internationalen Raum beruhte im neunzehnten Jahrhundert auf der Annahme, dass China als unzivilisiert und der Westen als zivilisiert galt und dass die "traditionelle" chinesische Gesellschaft im Zuge der westlichen Konfrontation einem neuen und nach westlichen Maßstäben "modernem" China weichen würde. Diese ganze Struktur von Annahmen wurde gründlich erschüttert, als im fortschreitenden Modernisierungsprozess Chinas ein neues und komplexeres Modell für die Beziehung zwischen Vergangenheit und Gegenwart durch die chinesischen Intellektuellen vorgeschlagen wurde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Pluralismus – die Versöhnung mit dem Westen?
- 2.1 Knowledge: das kritischste Gebiet der chinesischen Verwundbarkeit gegenüber dem Westen
- 2.2 Die Moderne: ein unvollendetes Projekt.
- 2.3 Die Neue Philosophenschule bietet ein neues Verständnis von Tradition und Moderne
- 2.3.1 Paradigmenwechsel
- 2.3.2 Konstruktive Kulturreform: Anerkennung der kulturellen Einzigartigkeit
- 3. Neues Selbstbewusstsein: Rückbesinnung auf die Substanz des chinesischen Lernens
- 3.1 Aufbruch zu neuen Horizonten: Rising China
- 3.2 Die von Komplexität geprägte, kulturelle Umgebung der Moderne
- 3.3 Die Neue Philosophenschule: Ausweg aus der kulturellen Unselbstständigkeit Chinas?
- 3.3.1 Neues Verständnis von „neu“ und „alt“
- 3.3.2 Neues Verständnis von Chineseness
- 4. Die beständige Idee der Erneuerung
- 4.1 Die traditionelle Sonderstellung des Gelehrtenstands
- 4.2 Die ideologische Leitlinie: Chinese Dream
- 4.3 Die Notwendigkeit einer Neuerfindung der chinesischen Geschichte
- 4.4 Die Neue Philosophenschule: Lösung für das soziale „Wertevakuum“?
- 4.4.1 Aufklärung chinesischer Art
- 4.4.2 Aktuelle Verbreitung
- 5. Fazit
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und die Bedeutung der Neuen Philosophenschule (xinzixue) in China. Ziel ist es, die historiographischen Faktoren zu analysieren, die zur Bildung dieser Schule beigetragen haben und wie sie ein neues Verständnis chinesischer Identität im Kontext der Modernisierung und des westlichen Einflusses formuliert.
- Die Herausforderungen der Modernisierung für die chinesische Identität
- Das Verhältnis zwischen Tradition und Moderne in der Neuen Philosophenschule
- Die Auseinandersetzung mit dem Westen und die Suche nach kultureller Selbstbehauptung
- Die Rolle der Neuen Philosophenschule in der intellektuellen Debatte Chinas
- Die Neuerfindung chinesischer Selbstbeschreibung im 21. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den Faktoren der kulturellen und nationalen Identitätsbildung in China vor, die zur Entstehung der Neuen Philosophenschule im Jahr 2012 führten. Sie betont den Wunsch nach einer neuen Selbstbeschreibung Chinas im Kontext der Modernisierung und der Auseinandersetzung mit dem Westen, und skizziert den historiographischen Ansatz der Arbeit.
2. Pluralismus – die Versöhnung mit dem Westen?: Dieses Kapitel analysiert das Verständnis der Neuen Philosophenschule von Moderne und Tradition. Es beleuchtet die kritischen Punkte der chinesischen Verwundbarkeit gegenüber dem Westen, insbesondere im Bereich des Wissens, und untersucht wie die Neue Philosophenschule einen neuen Weg zur kulturellen Selbstbehauptung sucht, ohne westliche Einflüsse vollständig zu verwerfen oder nur auf chinesische Methoden zu setzen. Der Fokus liegt auf dem Paradigmenwechsel und der konstruktiven Kulturreform, die die Schule anstrebt.
3. Neues Selbstbewusstsein: Rückbesinnung auf die Substanz des chinesischen Lernens: Dieses Kapitel befasst sich mit dem neu gewonnenen Selbstbewusstsein Chinas und der Rückbesinnung auf die eigene philosophische Tradition als Antwort auf die Herausforderungen der Moderne. Es untersucht den Aufstieg Chinas ("Rising China") und die komplexe kulturelle Umgebung, die durch die Modernisierung geschaffen wurde. Die Neue Philosophenschule wird als ein möglicher Ausweg aus der kulturellen Unselbstständigkeit präsentiert, wobei ein neues Verständnis von "neu" und "alt", sowie von "Chineseness" im Mittelpunkt steht.
4. Die beständige Idee der Erneuerung: Dieses Kapitel untersucht die dauerhafte Idee der Erneuerung in der chinesischen Geschichte und ihre Beziehung zur Neuen Philosophenschule. Es beleuchtet die traditionelle Rolle des Gelehrtenstandes, den "Chinese Dream" als ideologische Leitlinie und die Notwendigkeit, die chinesische Geschichte neu zu interpretieren. Die Neue Philosophenschule wird als mögliche Lösung für ein bestehendes soziales Werte-Vakuum vorgestellt, wobei eine "Aufklärung chinesischer Art" und die aktuelle Verbreitung der Schule diskutiert werden.
Schlüsselwörter
Neue Philosophenschule (xinzixue), chinesische Identität, Modernisierung, Tradition, Moderne, Westen, kulturelle Selbstbehauptung, Historiographie, Identitätsbildung, Pluralismus, „Rising China“, „Chinese Dream“
Häufig gestellte Fragen zur Neuen Philosophenschule (xinzixue) in China
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entstehung und Bedeutung der Neuen Philosophenschule (xinzixue) in China. Sie untersucht die historiographischen Faktoren, die zur Bildung dieser Schule beigetragen haben und wie sie ein neues Verständnis chinesischer Identität im Kontext der Modernisierung und des westlichen Einflusses formuliert.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Herausforderungen der Modernisierung für die chinesische Identität, das Verhältnis zwischen Tradition und Moderne in der Neuen Philosophenschule, die Auseinandersetzung mit dem Westen und die Suche nach kultureller Selbstbehauptung, die Rolle der Neuen Philosophenschule in der intellektuellen Debatte Chinas und die Neuerfindung chinesischer Selbstbeschreibung im 21. Jahrhundert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Pluralismus – die Versöhnung mit dem Westen?, Neues Selbstbewusstsein: Rückbesinnung auf die Substanz des chinesischen Lernens, Die beständige Idee der Erneuerung und Fazit. Zusätzlich enthält sie ein Literaturverzeichnis.
Was ist das zentrale Argument von Kapitel 2 ("Pluralismus – die Versöhnung mit dem Westen?")?
Kapitel 2 analysiert das Verständnis der Neuen Philosophenschule von Moderne und Tradition. Es beleuchtet die kritischen Punkte der chinesischen Verwundbarkeit gegenüber dem Westen, insbesondere im Bereich des Wissens, und untersucht, wie die Neue Philosophenschule einen neuen Weg zur kulturellen Selbstbehauptung sucht, ohne westliche Einflüsse vollständig zu verwerfen oder nur auf chinesische Methoden zu setzen. Der Fokus liegt auf dem Paradigmenwechsel und der konstruktiven Kulturreform.
Was ist der Schwerpunkt von Kapitel 3 ("Neues Selbstbewusstsein: Rückbesinnung auf die Substanz des chinesischen Lernens")?
Kapitel 3 befasst sich mit dem neu gewonnenen Selbstbewusstsein Chinas und der Rückbesinnung auf die eigene philosophische Tradition als Antwort auf die Herausforderungen der Moderne. Es untersucht den Aufstieg Chinas ("Rising China") und die komplexe kulturelle Umgebung, die durch die Modernisierung geschaffen wurde. Die Neue Philosophenschule wird als ein möglicher Ausweg aus der kulturellen Unselbstständigkeit präsentiert, wobei ein neues Verständnis von "neu" und "alt", sowie von "Chineseness" im Mittelpunkt steht.
Worum geht es in Kapitel 4 ("Die beständige Idee der Erneuerung")?
Kapitel 4 untersucht die dauerhafte Idee der Erneuerung in der chinesischen Geschichte und ihre Beziehung zur Neuen Philosophenschule. Es beleuchtet die traditionelle Rolle des Gelehrtenstandes, den "Chinese Dream" als ideologische Leitlinie und die Notwendigkeit, die chinesische Geschichte neu zu interpretieren. Die Neue Philosophenschule wird als mögliche Lösung für ein bestehendes soziales Werte-Vakuum vorgestellt, wobei eine "Aufklärung chinesischer Art" und die aktuelle Verbreitung der Schule diskutiert werden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Neue Philosophenschule (xinzixue), chinesische Identität, Modernisierung, Tradition, Moderne, Westen, kulturelle Selbstbehauptung, Historiographie, Identitätsbildung, Pluralismus, „Rising China“, „Chinese Dream“.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die historiographischen Faktoren zu analysieren, die zur Bildung der Neuen Philosophenschule beigetragen haben und wie sie ein neues Verständnis chinesischer Identität im Kontext der Modernisierung und des westlichen Einflusses formuliert.
Wie wird die Neue Philosophenschule in dieser Arbeit dargestellt?
Die Neue Philosophenschule wird als ein Versuch dargestellt, ein neues Verständnis chinesischer Identität im Kontext der Modernisierung und des westlichen Einflusses zu formulieren. Sie sucht nach einem Weg zur kulturellen Selbstbehauptung, der sowohl die eigene Tradition als auch westliche Einflüsse berücksichtigt, und versucht, ein bestehendes soziales Werte-Vakuum zu füllen.
- Quote paper
- Laura Tomas (Author), 2018, Die Neue Philosophenschule. Neuerfindung chinesischer Selbstbeschreibung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/913860