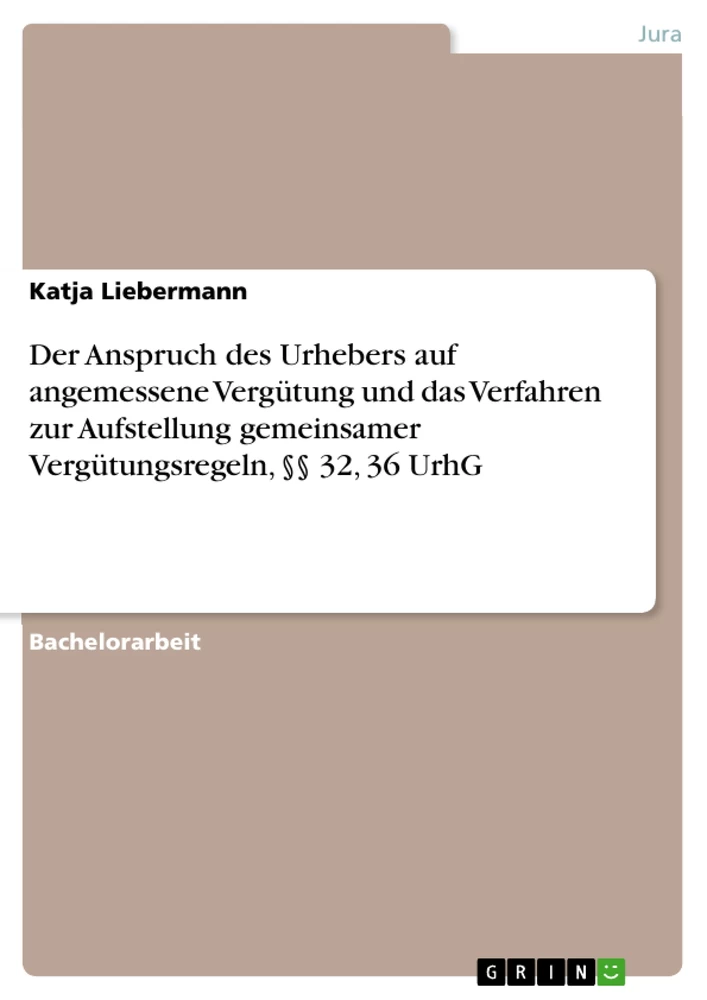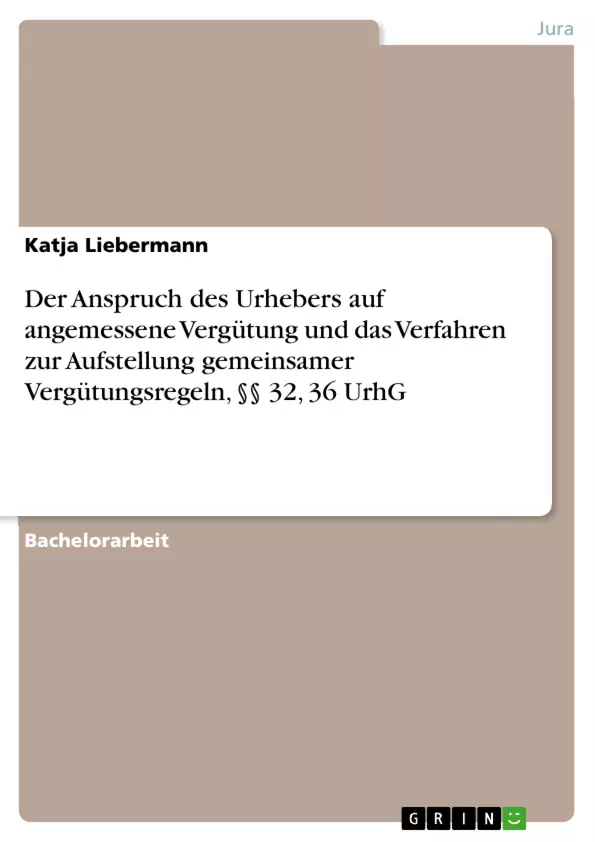Für die Vielfalt unserer Kultur ist das Schaffen von Künstlern, Autoren, Journalisten und anderen kreativ Tätigen unerlässlich. Für den Urheber kann ein Werk in wirtschaftlicher Hinsicht jedoch erst durch die Übertragung von Verwertungsrechten nutzbar gemacht werden. Bei der Aushandlung solcher Nutzungsverträge steht er regelmäßig Verwertern gegenüber. Für die inhaltliche Ausgestaltung solcher Verträge sah das Gesetz jedoch kein umfassendes Urhebervertragsrecht vor. Obwohl die Notwendigkeit hierfür bereits bei Inkrafttreten des heutigen Urheberrechts im Jahr 1965 erkannt wurde, wurde erst im Jahr 2000 auf Initiative der damaligen Justizministerin Herta Däubler-Gmelin von fünf unabhängigen Wissenschaftlern auf dem Gebiet des Urheberrechts ein Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern vorgelegt. Dieser wurde in 2001 beinahe unverändert als Referentenentwurf eingereicht.
In gängiger Praxis zeigte sich, dass die kreativ Tätigen gegenüber Ihren primären Vertragspartnern bei der vertraglichen Einräumung ihrer gesetzlich gewährten Rechte aufgrund ihrer strukturellen wirtschaftlichen Unterlegenheit meist nur unangemessene Vergütungen aushandeln konnten. Zielstellung der Initiatoren war es daher in erster Linie, die vertragliche Stellung der Urheber zu stärken und die Vertragsparität zwischen ihnen und den Verwertern wieder herzustellen, um so den kreativ Tätigen eine gerechte Entlohnung für ihre schöpferische Leistung zu sichern. Dieser Entwurf wurde seitens der Verwerter, aber auch seitens einiger Rechtswissenschaftler heftig kritisiert.
Im Ergebnis wurde am 22.03.2002 das Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern verabschiedet. Dieses beinhaltete keine umfassende Neuregelung des Urhebervertragsrechts für sämtliche Vertragstypen, stellt jedoch einen Kompromiss zwischen den ursprünglichen Vorschlägen und der daran geübten Kritik dar.
Diese Arbeit soll die Grundzüge der Ansprüche des Urhebers zur Gewährung einer angemessenen Vergütung darstellen und den unbestimmten Rechtsbegriff der Angemessenheit näher konkretisieren. Im Ergebnis werden einige mögliche Vergütungsmodelle dargestellt und die Besonderheiten dieser Vorschrift erläutert. Ein zweiter Schwerpunkt wird das Verfahren zur Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln darstellen und bewerten, da diese bei der Bestimmung der angemessenen Vergütung eine maßgebliche Rolle spielen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung
- B. Die Ansprüche aus § 32 1 UrhG im Überblick
- I. Allgemeine Anspruchsvoraussetzungen
- 1. Zeitlicher Anwendungsbereich
- 2. Einräumung von Nutzungsrechten und Erlaubnis der Werknutzung
- 3. Aktivlegitimation
- 4. Passivlegitimation
- II. Anspruch auf vereinbarte Vergütung § 32 I 1 UrhG
- III. Anspruch auf angemessene Vergütung § 32 I 2 UrhG
- IV. Anspruch auf Vertragsanpassung § 32 1 3 UrhG
- I. Allgemeine Anspruchsvoraussetzungen
- C. Bestimmung der Angemessenheit der Vergütung nach § 32 II UrhG
- I. Tarifvertragliche Bestimmung § 32 IV UrhG
- II. Gesetzliche Vermutung des § 32 II 1 UrhG bei gemeinsamen Vergütungsregeln
- 1. Wirkung
- 2. Voraussetzungen
- a) Wirksames Zustandekommen der gemeinsamen Vergütungsregel
- b) Einschlägigkeit
- c) Zeitlicher Geltungsbereich
- III. Generalklausel § 32 II 2 UrhG
- 1. Dreifacher Prüfungsweg zur Konkretisierung der Angemessenheit
- a) Üblichkeit
- b) Redlichkeit
- c) Festsetzung nach billigem Ermessen
- 2. Zeitlicher Anknüpfungspunkt
- 3. Kriterien für die Bestimmung einer angemessenen Vergütung
- a) Ertragsbezogene Ausrichtung der Abwägung und Beteiligungsprinzip
- b) Art und Umfang der Nutzungsmöglichkeit
- c) Geschäftsumstände
- d) Werkbezogene Betrachtung
- e) Subjektive Faktoren
- 4. Mögliche Vergütungsmodelle
- a) Absatzhonorar
- b) Pauschalhonorar
- c) Alternative Vergütungsmodelle
- 1. Dreifacher Prüfungsweg zur Konkretisierung der Angemessenheit
- D. Dogmatische Einordnung des § 32 UrhG
- I. Honorarordnung für Urheber?
- II. Verfassungsrechtliche Betrachtung
- 1. Vorliegen eines Eingriffs in die Privatautonomie
- 2. Vorliegen eines Rechtfertigungsgrunds für den Eingriff
- 3. Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit
- 4. Alternative Lösungsmöglichkeiten als milderes Mittel?
- E. Das Verfahren zur Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln nach § 36 UrhG
- 1. Inhaltliche Ausgestaltung gemeinsamer Vergütungsregeln
- II. Die beteiligten Parteien
- 1. Einzelne Werknutzer
- 2. Vereinigungen
- a) Rechtsform und Beispiele
- b) Anforderungen an die Vereinigungen
- aa) Repräsentativität
- bb) Unabhängigkeit
- cc) Ermächtigung
- dd) Notwendigkeit dieser Anforderungen
- III. Festsetzung durch die Parteien
- IV. Aufstellung im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens
- 1. Einleitung eines Schlichtungsverfahrens
- a) Schlichtungsverfahren kraft Parteivereinbarung § 36 III 1 UrhG
- b) Obligatorisches Schlichtungsverfahren auf Verlangen einer Partei § 36 III 2 UrhG
- aa) Einleitungsgründe § 36 III 2 Nr. 1 - - 3 UrhG
- (1) § 36 III 2 Nr. 1 UrhG
- (11) § 36 III 2 Nr. 2 UrhG
- (III) § 36 III 2 Nr. 3 UrhG
- bb) Schriftliches Verlangen mit Vorschlag
- aa) Einleitungsgründe § 36 III 2 Nr. 1 - - 3 UrhG
- 2. Bildung der Schlichtungsstelle
- a) Beisitzer
- b) Vorsitzender
- 3. Durchführung des Schlichtungsverfahrens
- a) Verhandlung und Beschlussfassung
- b) Einigungsvorschlag als Ergebnis, § 36 IV 1 UrhG
- c) Annahme des Einigungsvorschlags § 36 IV 2 UrhG
- aa) Voraussetzungen für die Annahme
- (1) Kein Widerspruch beider Parteien
- (11) Ort für die Einlegung des Widerspruchs
- (III) Frist für die Erklärung des Widerspruchs
- bb) Rechtsnatur eines angenommenen Vorschlags
- cc) Rechtsnatur eines abgelehnten Einigungsvorschlags und Folgen für das Schlichtungsverfahren
- aa) Voraussetzungen für die Annahme
- V. Kritische Bewertung des Verfahrens und Erfolgsaussichten
- 1. Verfahrensordnung
- 2. Einleitung des Verfahrens
- 3. Art und Zusammensetzung der Schieds- bzw. Schlichtungsstelle
- a) Dauerhafte versus ad-hoc Einrichtung und Zusammensetzung des Spruchkörpers
- b) Qualifikation und Eigenschaften der Mitglieder
- c) Bewertung
- 4. Entscheidungskompetenz des Spruchkörpers und Charakter der Entscheidung
- 5. Gesamtbeurteilung und Erfolgsaussichten
- 1. Einleitung eines Schlichtungsverfahrens
- F. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Anspruch des Urhebers auf angemessene Vergütung nach §§ 32, 36 UrhG. Sie analysiert sowohl die rechtlichen Grundlagen als auch die praktische Anwendung dieser Vorschriften.
- Die Anspruchsvoraussetzungen des § 32 UrhG
- Die Bestimmung der angemessenen Vergütung
- Die verfassungsrechtliche Einordnung des § 32 UrhG
- Das Verfahren zur Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln nach § 36 UrhG
- Die kritische Bewertung des Verfahrens und Erfolgsaussichten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema und stellt die rechtlichen Grundlagen des Anspruchs auf angemessene Vergütung dar. Kapitel B analysiert die Anspruchsvoraussetzungen des § 32 UrhG im Detail, während Kapitel C sich mit der Bestimmung der Angemessenheit der Vergütung befasst. Kapitel D führt eine dogmatische Einordnung des § 32 UrhG durch, und untersucht seine Verfassungsrechtlichkeit. Schließlich behandelt Kapitel E das Verfahren zur Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln nach § 36 UrhG.
Schlüsselwörter
Urheberrecht, Urhebervergütung, Angemessenheit, Vergütungsregeln, Schlichtungsverfahren, § 32 UrhG, § 36 UrhG
Häufig gestellte Fragen
Was regelt der § 32 des Urheberrechtsgesetzes (UrhG)?
Der § 32 UrhG regelt den Anspruch des Urhebers auf eine angemessene Vergütung für die Einräumung von Nutzungsrechten an seinen Werken.
Warum wurde das Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern eingeführt?
Das Ziel war es, die wirtschaftliche Unterlegenheit von Kreativen gegenüber Verwertern auszugleichen und eine Vertragsparität herzustellen, um gerechte Entlohnung zu sichern.
Wie wird die "Angemessenheit" einer Vergütung bestimmt?
Die Angemessenheit bestimmt sich primär nach gemeinsamen Vergütungsregeln oder Tarifverträgen. Fehlen diese, gilt eine Vergütung als angemessen, wenn sie dem entspricht, was im Geschäftsverkehr üblich und redlich ist.
Was ist das Ziel des Verfahrens nach § 36 UrhG?
Es dient der Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln zwischen Urhebervereinigungen und Werknutzern, oft unter Einbeziehung einer Schlichtungsstelle.
Welche Rolle spielt die Schlichtungsstelle im Urhebervertragsrecht?
Die Schlichtungsstelle kann angerufen werden, wenn sich die Parteien nicht auf Vergütungsregeln einigen können. Sie erarbeitet Einigungsvorschläge zur Beilegung des Konflikts.
Welche Vergütungsmodelle werden im Urheberrecht unterschieden?
Häufige Modelle sind das Absatzhonorar (Beteiligung an jedem verkauften Stück), das Pauschalhonorar oder hybride alternative Vergütungsmodelle.
- Quote paper
- Katja Liebermann (Author), 2007, Der Anspruch des Urhebers auf angemessene Vergütung und das Verfahren zur Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln, §§ 32, 36 UrhG, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91411