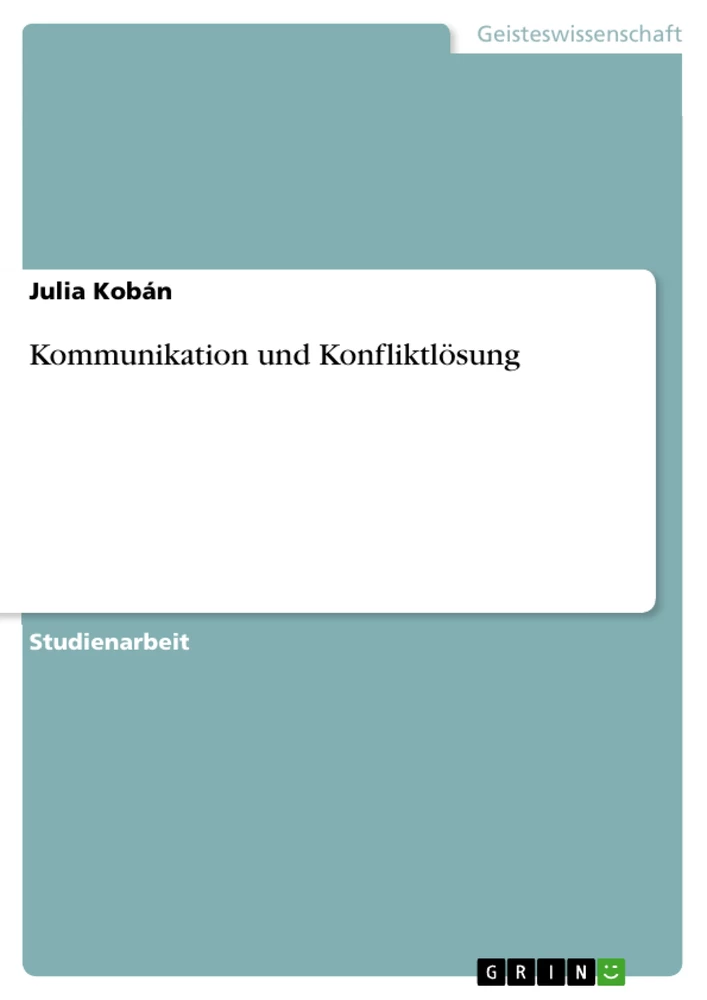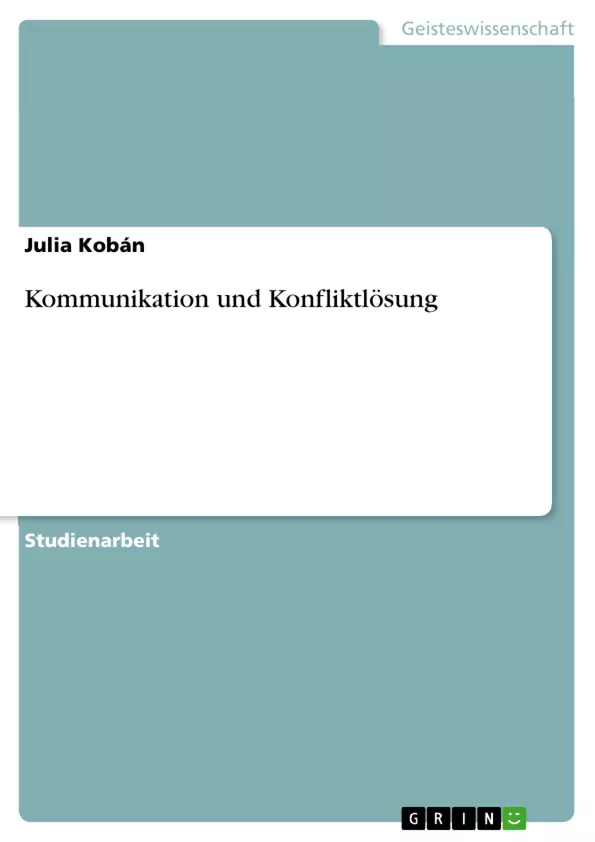Diese Arbeit stellt Kommunikations- und Konfliktlösungsmodelle vor. Die Dialog-Modelle "beschäftigen sich zentral mit der Frage, wie gemeinsame Wirklichkeit zwischen den an einem Kommunikationsprozess Beteiligten konstruiert wird." Anhand des Kommunikationsmodells nach Paul Watzlawick von 1996 wird im nächsten Abschnitt versucht, die Kernmerkmale dieses Prozesses zu identifizieren. Das nun folgende, selbstkonstruierte Beispiel soll zur Unterstützung und Veranschaulichung dienen.
Es gibt unterschiedliche Kommunikationsmodelle, die den Prozess der Kommunikation näher beleuchten, sich jedoch hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Tradition, Komplexität und inhaltlichen Schwerpunkten unterscheiden. Hierbei wird zwischen den allgemeinen Kommunikationsmodellen, die interdisziplinärer Natur sind und mithilfe verschiedener Wissenschaftsrichtungen die Thematik der Kommunikation näher zu erläutern versuchen, und den psychologischen Kommunikationsmodellen, welche eine eingeschränktere und differenzierte Perspektive einnehmen, unterschieden. Nach Krauss und Fussel (1996) können psychologische Kommunikationsmodelle in vier Gruppen unterteilt werden: Encoder/ Decoder- Modelle, Intensionsorientierte Modelle, Perspektivübernahmemodelle und Dialog-Modelle.
Inhaltsverzeichnis
- Kommunikations- und Konfliktlösungsmodelle
- Selbstkonstruiertes Beispiel
- Kommunikationsmodell nach Paul Watzlawick
- Die fünf Axiome
- Mittel nonverbaler Kommunikation
- Haptische Signale, Körpersprache, Proxemik, physische Charakteristika
- Aspekte für den (LER) Unterricht: Bezug zu den thematischen Schwerpunkten im Rahmenlehrplan
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit unterschiedlichen Kommunikations- und Konfliktlösungsmodellen und deren Relevanz im Kontext des (LER) Unterrichts. Sie analysiert das Kommunikationsmodell nach Paul Watzlawick und erläutert die fünf Axiome, die Störungen in der Kommunikation identifizieren und ggbfs. beheben helfen.
- Analyse verschiedener Kommunikationsmodelle
- Anwendung des Kommunikationsmodells nach Paul Watzlawick
- Erläuterung der fünf Axiome
- Bedeutung nonverbaler Kommunikation im Unterricht
- Integration von Konfliktlösungsstrategien im (LER) Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beleuchtet unterschiedliche Kommunikationsmodelle und führt das selbstkonstruierte Beispiel ein, das im weiteren Verlauf der Arbeit zur Veranschaulichung dient.
- Das zweite Kapitel fokussiert auf das Kommunikationsmodell nach Paul Watzlawick und seine fünf Axiome. Jedes Axiom wird anhand des selbstkonstruierten Beispiels erklärt.
Schlüsselwörter
Kommunikation, Konfliktlösung, Kommunikationsmodelle, Paul Watzlawick, Axiome, Nonverbale Kommunikation, (LER) Unterricht, Rahmenlehrplan.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die fünf Axiome von Paul Watzlawick?
Watzlawicks Axiome beschreiben Grundregeln der Kommunikation, darunter: „Man kann nicht nicht kommunizieren“ und „Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt“.
Welche Rolle spielt nonverbale Kommunikation im Unterricht?
Nonverbale Signale wie Körpersprache, Haptik (Berührung) und Proxemik (Raumverhalten) sind entscheidend für die Beziehungsgestaltung zwischen Lehrkräften und Schülern.
Wie helfen Kommunikationsmodelle bei der Konfliktlösung?
Sie ermöglichen es, Störungen im Prozess zu identifizieren (z.B. auf der Beziehungsebene) und durch Perspektivübernahme oder Dialog-Modelle gemeinsame Wirklichkeiten zu konstruieren.
Was versteht man unter 'Proxemik'?
Proxemik bezeichnet das Raumverhalten und die Distanzzonen zwischen Kommunikationspartnern, die maßgeblich beeinflussen, wie eine Nachricht aufgenommen wird.
Was unterscheidet psychologische von allgemeinen Kommunikationsmodellen?
Psychologische Modelle (wie Encoder/Decoder oder Dialog-Modelle) nehmen eine differenziertere Perspektive auf das Erleben und Verhalten der Beteiligten ein.
- Quote paper
- Julia Kobán (Author), 2017, Kommunikation und Konfliktlösung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/914818