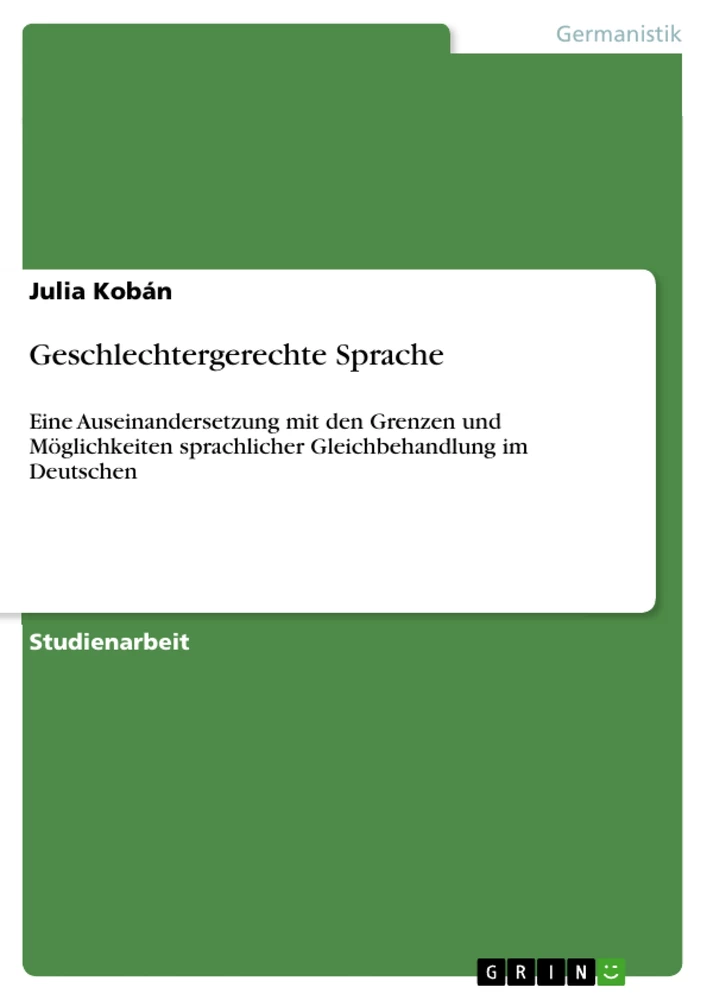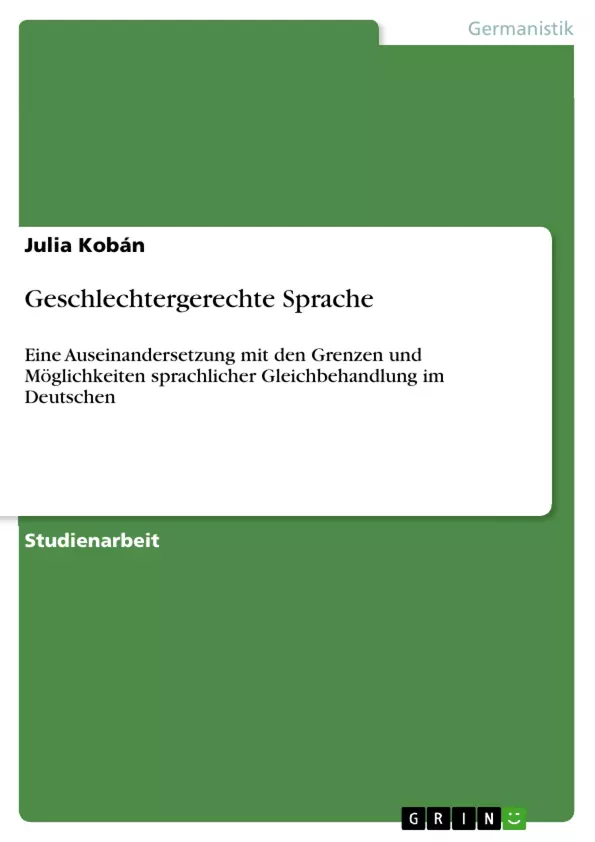Diese Arbeit zum Thema "Geschlechtergerechte Sprache" beleuchtet die Grenzen und Möglichkeiten sprachlicher Gleichbehandlung in der deutschen Sprache. Bevor es durch Aufzeigen der unterschiedlichen wissenschaftlichen Argumente zu einer umfangreichen kritischen Betrachtung der sprachlichen Veränderung kommt, sollen vorher die rechtlichen Grundlagen, Kritikpunkte der Feministen/innen sowie Erneuerungen und Empfehlungen dargelegt werden. Ein weiterer Aspekt ist die Sprachpolitik, die ein wesentlicher Bestandteil in Bezug auf die Geschlechtergerechtigkeit ist. Abschließend werden im Fazit die Erkenntnisse zusammengetragen.
Kaum ein Thema wird derzeit so heiß diskutiert wie die Gendergerechtigkeit in der deutschen Sprache. Zur Debatte steht, ob das Deutsche eine frauenfeindliche Sprache ist – eine "Männersprache" –, die die Unterdrückung der Frauen widerspiegelt und fördert. Dabei bezieht sich der Hauptvorwurf auf das generische Maskulinum. Somit wäre eine Veränderung der Sprache, mündlich als auch schriftlich, unabdingbar.
Der Diskurs wird von einer Vielzahl von Akteuren geführt, die nicht nur Experten einzelner gesellschaftlicher Bereiche wie Politik, Biologie, Gender Studies sowie Sprach- und Sozialwissenschaften sind. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich auch um Laien auf eben genannten Gebiete handelt. Sie seien aber Experten ihrer eigenen Sprache, da sie derselben Sprechergemeinschaft zugehören und zugleich Sprachkompetenz und Sprachgefühl aufweisen. So reicht die Debatte von wissenschaftlichen Beiträgen und konventionellen Textsorten wie politischen Reden oder Zeitungsartikeln bis hin zu neueren Textsorten wie Online-Kommentaren oder Blogs. Das Thema berührt alle, weil sich jeder in einer bestimmten Art sprachlich äußert oder auf andere Weise der Sprache bedient.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Anwendung geschlechtergerechter Sprache
- 2.1 Rechtliche Grundlagen
- 2.2 Feministische Kritik
- 2.3 Erneuerungen und Empfehlungen in der Schriftsprache
- 3. Geschlechtergerechtigkeit im Hintergrund der Sprachpolitik
- 4. Kritik: Grenzen der sprachlichen Gleichbehandlung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Grenzen und Möglichkeiten geschlechtergerechter Sprache im Deutschen. Sie analysiert den Diskurs um die Gendergerechtigkeit in der Sprache, berücksichtigt rechtliche Grundlagen und feministische Kritikpunkte, und beleuchtet die Rolle der Sprachpolitik. Das Ziel ist, ein umfassendes Bild der Debatte zu zeichnen, ohne vorschnelle Schlussfolgerungen zu ziehen.
- Rechtliche Grundlagen geschlechtergerechter Sprache in Deutschland
- Feministische Kritik an der deutschen Sprache und dem generischen Maskulinum
- Möglichkeiten und Grenzen der sprachlichen Gleichbehandlung
- Der Einfluss der Sprachpolitik auf die Geschlechtergerechtigkeit
- Der Wandel der Sprache und der Widerstand dagegen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der geschlechtergerechten Sprache ein und stellt die zentrale Frage nach den Grenzen und Möglichkeiten sprachlicher Gleichbehandlung im Deutschen. Sie beschreibt den kontroversen Diskurs um das generische Maskulinum und dessen vermeintlich frauenfeindlichen Charakter. Der Text betont die Vielfältigkeit der Akteure in dieser Debatte, von Experten aus verschiedenen Disziplinen bis hin zu Laien, die dennoch als Sprachkompetente gelten. Der wandelbare Charakter der Sprache wird hervorgehoben, ebenso wie der zunehmende Widerstand gegen diesen Wandel im Vergleich zu früheren Zeiten. Die Arbeit kündigt die Untersuchung der rechtlichen Grundlagen, feministischer Kritikpunkte, Erneuerungen und Empfehlungen sowie der Sprachpolitik an.
2. Die Anwendung geschlechtergerechter Sprache: Dieses Kapitel behandelt den Begriff der geschlechtergerechten Sprache und deren Umsetzung in der Praxis. Es wird der rechtliche Rahmen in Deutschland, insbesondere Artikel 3 des Grundgesetzes, erläutert, der die Gleichberechtigung von Mann und Frau garantiert und die Regierung zur Förderung dieser Gleichberechtigung verpflichtet. Die Bedeutung von Gleichberechtigung im schulischen Kontext wird anhand des Brandenburgischen Schulgesetzes verdeutlicht. Das Kapitel betont die Notwendigkeit sprachlicher Gleichstellung, während gleichzeitig die potenziellen Konflikte mit der Grammatik und die Konsequenzen sprachlicher Eingriffe angedeutet werden. Die Ausführungen bilden die Grundlage für die spätere Diskussion der Grenzen und Möglichkeiten sprachlicher Gleichbehandlung.
2.2 Feministische Kritik: Dieser Abschnitt präsentiert feministische Kritikpunkte an der deutschen Sprache. Er thematisiert die Asymmetrien in der Personenbezeichnung, wie sie von Linguistinnen wie Luise Pusch beschrieben werden. Der Fokus liegt auf dem "Differentialgenus" bei substantivierten Adjektiven und Partizipien, sowie auf der morphologischen Ableitung von Femininformen (Movierung) zu maskulinen Personenbezeichnungen. Diese Kritikpunkte verdeutlichen die Ungleichgewichte in der sprachlichen Repräsentation von Geschlechtern und bilden einen wichtigen Teil der Argumentation für geschlechtergerechte Sprache.
Schlüsselwörter
Geschlechtergerechte Sprache, generisches Maskulinum, feministische Linguistik, Sprachpolitik, Gleichberechtigung, Grundgesetz, Brandenburgisches Schulgesetz, Sprachwandel, Differentialgenus, Movierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Geschlechtergerechten Sprache
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen geschlechtergerechter Sprache im Deutschen. Sie analysiert den Diskurs um Gendergerechtigkeit in der Sprache, berücksichtigt rechtliche Grundlagen und feministische Kritik, und beleuchtet die Rolle der Sprachpolitik. Das Ziel ist ein umfassendes Bild der Debatte, ohne vorschnelle Schlussfolgerungen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt u.a. die rechtlichen Grundlagen geschlechtergerechter Sprache in Deutschland (inkl. Artikel 3 des Grundgesetzes und des Brandenburgischen Schulgesetzes), feministische Kritik am generischen Maskulinum, die Möglichkeiten und Grenzen sprachlicher Gleichbehandlung, den Einfluss der Sprachpolitik und den Wandel der Sprache sowie den Widerstand dagegen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung: Einführung in das Thema und die Problematik des generischen Maskulinums. Anwendung geschlechtergerechter Sprache: Rechtliche Grundlagen und praktische Umsetzung, inkl. der Bedeutung von Gleichberechtigung im schulischen Kontext. Feministische Kritik: Asymmetrien in der Personenbezeichnung und Kritik am generischen Maskulinum aus feministisch-linguistischer Sicht. Geschlechtergerechtigkeit im Hintergrund der Sprachpolitik: Der Einfluss von Sprachpolitik auf die Geschlechtergerechtigkeit. Fazit: Zusammenfassung der Ergebnisse.
Welche feministischen Kritikpunkte werden angesprochen?
Die Arbeit thematisiert feministische Kritikpunkte an der deutschen Sprache, insbesondere die Asymmetrien in der Personenbezeichnung (wie von Luise Pusch beschrieben), den "Differentialgenus" bei substantivierten Adjektiven und Partizipien und die morphologische Ableitung von Femininformen (Movierung) zu maskulinen Personenbezeichnungen. Diese Kritikpunkte verdeutlichen die Ungleichgewichte in der sprachlichen Repräsentation der Geschlechter.
Welche rechtlichen Grundlagen werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf Artikel 3 des Grundgesetzes (Gleichberechtigung von Mann und Frau) und das Brandenburgische Schulgesetz, um die rechtlichen Grundlagen geschlechtergerechter Sprache und deren Bedeutung im schulischen Kontext zu verdeutlichen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Geschlechtergerechte Sprache, generisches Maskulinum, feministische Linguistik, Sprachpolitik, Gleichberechtigung, Grundgesetz, Brandenburgisches Schulgesetz, Sprachwandel, Differentialgenus, Movierung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist für alle relevant, die sich mit den Themen Geschlechtergerechtigkeit, Sprache und Sprachpolitik auseinandersetzen, einschließlich Wissenschaftler*innen, Studierende, Lehrer*innen und alle Interessierten an der deutschen Sprache und ihren gesellschaftlichen Implikationen.
- Arbeit zitieren
- Julia Kobán (Autor:in), 2019, Geschlechtergerechte Sprache, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/914828