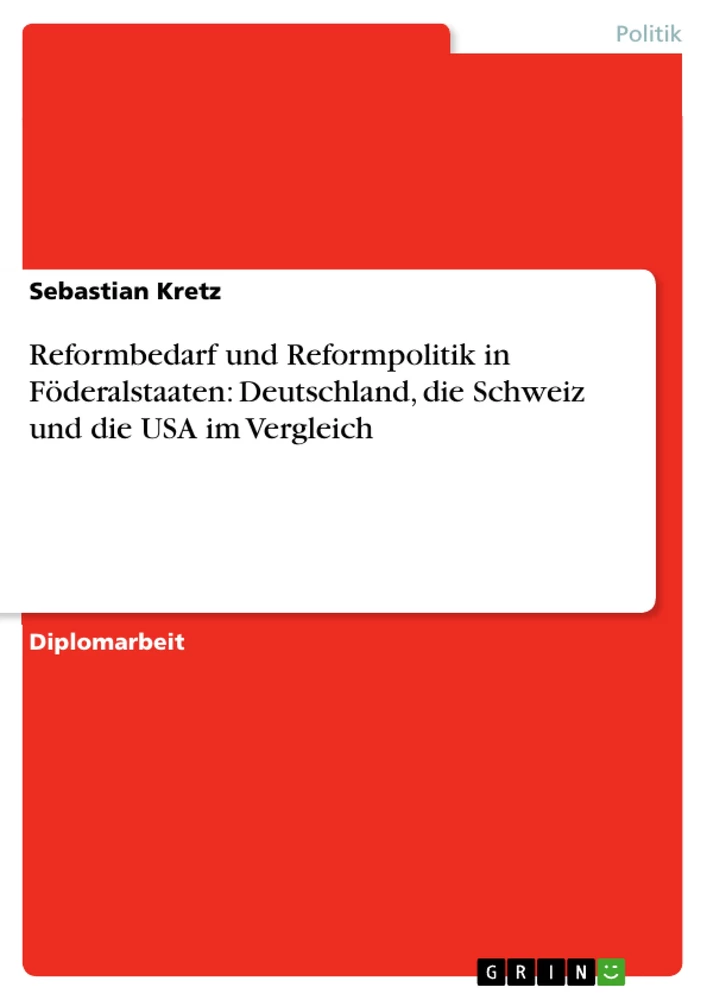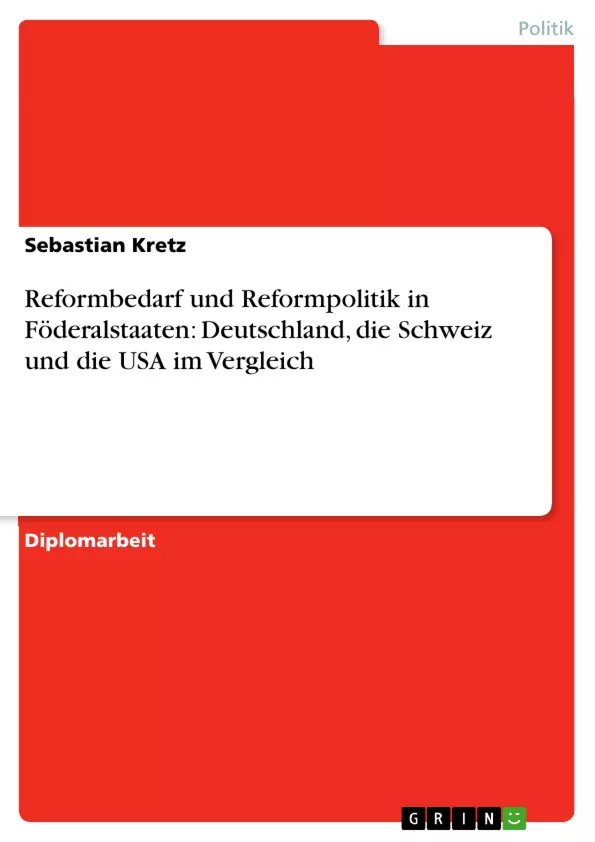Die doppelte Staatlichkeit im Föderalismus provoziert Konflikte und erfordert Verhandlungen. In Bundesstaaten besteht eine ständige Diskussion darüber, wie die föderale Ordnung ausgestaltet werden solle. Ein Ziel der Arbeit ist es zu untersuchen, wodurch Reformbedarf ausgelöst wird, welche Lösungen diskutiert werden und warum womöglich unterschiedliche Ergebnisse zustande kommen.
Der Vergleich Deutschland-Schweiz-USA bedeutet, drei Fälle zu untersuchen, die sich in Grundzügen ähneln (Demokratie, Föderalismus, hoch entwickelte Marktwirtschaft). Durch Industrialisierung, Tertiärisierung, technologischen Wandel und internationale Zusammenarbeit stehen sie vor vergleichbaren Herausforderungen. So entstehen staatenübergreifend institutionenpolitische Trends, die jeweils zeitgemäße Lösungen für Strukturprobleme versprechen (z.B. die Planungseuphorie in den 1960er Jahren und die Rückkehr des Wettbewerbsgedankens seit den 1980er Jahren). Es gilt zu zeigen, dass derartige Leitideen auch die Diskussion über die Reformbedürftigkeit der jeweiligen föderalen Ordnung etwa gleichzeitig in dieselbe Richtung lenken.
Trotz dieser übergeordneten Einflüsse betreiben die drei Föderalstaaten jedoch unterschiedliche Reformpolitik. Dass sie hinsichtlich ihrer spezifischen Entwicklungspfade, nationaler institutioneller Arrangements und Akteurkonstellationen große Unterschiede aufweisen, deutet darauf hin, dass nicht der international induzierte Reformbedarf, sondern endogene Faktoren darüber entscheiden, ob und wie Reformen stattfinden.
Die vergleichende Untersuchung dieser Gemeinsamkeiten und Unterschiede verspricht, Regelmäßigkeiten aufzudecken, die der Einzelfallstudie verborgen blieben und soll die angesprochene Diskrepanz zwischen Reformbedarf und Reformpolitik
erklären. Daraus ergibt sich folgende Forschungsfrage:
Warum kommt es in den drei Föderalstaaten trotz ähnlich wahrgenommenen Reformbedarfs zu unterschiedlicher Reformpolitik?
Die Untersuchung dieser Fragestellung setzt voraus, dass die Hypothesen „Der Reformbedarf ist ähnlich“ und „Die Reformpolitik ist unterschiedlich“ empirisch
bewiesen werden. Wenn der Reformbedarf tatsächlich durch gemeinsame institutionelle Trends beeinflusst wird, muss auch dies empirisch gezeigt werden. Schließlich gilt es, und darin besteht das Hauptziel der Arbeit, die spezifischen endogenen Faktoren zu ermitteln, die in den jeweiligen Staaten zu unterschiedlichen Reformen führen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Gegenstand der Untersuchung und Fragestellung
- 1.2. Forschungsstand
- 1.3. Aufbau der Arbeit
- 2. Methode
- 2.1. Definition des Begriffs Föderalstaat
- 2.2. Forschungsstrategie, Variablen und Fallauswahl
- 2.3. Untersuchungszeitraum und verwendete Daten
- 3. Analyserahmen
- 3.1. Bedingungen für Wandel des wahrgenommenen Reformbedarfs
- 3.2. Bedingungen für tatsächliche Reformpolitik
- 4. Die Bundesrepublik Deutschland
- 4.1. Institutioneller Entwicklungspfad: Exekutivföderalismus mit ausgeprägtem Hang zur Verflechtung
- 4.2. Die föderale Ordnung der Bundesrepublik Deutschland 1955: Ein unitarischer Bundesstaat
- 4.3. Reformabschnitte
- 4.3.1. 1955 – 76: Verflechtungseuphorie und Fortschritt auf dem Pfad der Unitarisierung
- 4.3.2. 1980 – dato: Langwieriges Loslösen vom Pfad der Verflechtung mit heftigen Rückfällen
- 4.4. Fazit
- 5. Die Schweizerische Eidgenossenschaft
- 5.1. Institutioneller Entwicklungspfad: Von der Konföderation souveräner Kantone zum mäßig verflochtenen Bundesstaat
- 5.2. Die föderale Ordnung der schweizerischen Eidgenossenschaft 1964: Funktionale Aufgabenteilung unter Beibehaltung dualer Strukturen
- 5.3. Reformabschnitte
- 5.3.1. 1964-1978: Keine Chance für institutionalisierte Verflechtung
- 5.3.2. 1978 - 2004: Zähe Dezentralisierungs-Debatte führt zu ambivalenter Reform
- 5.4. Fazit
- 6. Die Vereinigten Staaten von Amerika
- 6.1. Institutioneller Entwicklungspfad: Gleichzeitiges Entstehen der bundesstaatlichen Ebenen und flexibler Föderalismus
- 6.2. Die föderale Ordnung der USA 1963: Nominell duales System mit informeller Aufgaben- und Ressourcenverflechtung
- 6.3. Reformabschnitte
- 6.3.1. 1963-1981: Johnsons „Creative Federalism" und Nixons „,New Federalism“ – ambivalente Reformpolitik und zunehmende Verflechtung
- 6.3.2. 1981 - 2001: Reagan, Bush, Clinton: Zwei Jahrzehnte bescheidener Dezentralisierung
- 6.4. Fazit
- 7. Reformbedarf und Reformpolitik im Vergleich: Die Dominanz endogener Faktoren über internationale Trends und die Bedeutung von Entwicklungspfaden, Institutionen und Akteuren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Reformbedarf und die Reformpolitik in föderalen Staaten, indem sie drei Fallbeispiele – Deutschland, die Schweiz und die USA – vergleicht. Ziel ist es, die Bedingungen für den Wandel des wahrgenommenen Reformbedarfs und für die Umsetzung von Reformpolitik zu erforschen. Hierbei wird analysiert, ob und unter welchen Bedingungen eine föderale Ordnung in der Lage ist, sich an neue Rahmenbedingungen anzupassen.
- Der Einfluss internationaler Trends auf den Reformbedarf in föderalen Staaten
- Die Rolle von Entwicklungspfaden, Institutionen und Akteuren bei der Gestaltung von Reformpolitik
- Der Vergleich der Reformpolitik in Deutschland, der Schweiz und den USA
- Die Analyse des Zusammenspiels zwischen wahrgenommenem Reformbedarf und tatsächlicher Reformpolitik
- Die Herausforderungen des Föderalismus in einer globalisierten Welt
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt den Gegenstand der Untersuchung und die Fragestellung vor. Sie definiert den Begriff „Föderalismus“ und erläutert die Forschungsstrategie sowie die Auswahl der Fallbeispiele.
- Kapitel 2: Methode: Dieses Kapitel erläutert die Forschungsmethodik, die Variablen und die Fallauswahl. Es beschreibt auch den Untersuchungszeitraum und die verwendeten Daten.
- Kapitel 3: Analyserahmen: Dieses Kapitel stellt den Analyserahmen vor und beschreibt die Bedingungen für den Wandel des wahrgenommenen Reformbedarfs sowie die Bedingungen für die Umsetzung von Reformpolitik.
- Kapitel 4: Die Bundesrepublik Deutschland: Dieses Kapitel untersucht den institutionellen Entwicklungspfad Deutschlands und analysiert die föderale Ordnung des Landes. Es beschreibt die Reformabschnitte und deren Auswirkungen auf die föderale Ordnung.
- Kapitel 5: Die Schweizerische Eidgenossenschaft: Dieses Kapitel analysiert den institutionellen Entwicklungspfad der Schweiz und die föderale Ordnung des Landes. Es beschreibt die Reformabschnitte und deren Auswirkungen auf die föderale Ordnung.
- Kapitel 6: Die Vereinigten Staaten von Amerika: Dieses Kapitel untersucht den institutionellen Entwicklungspfad der USA und analysiert die föderale Ordnung des Landes. Es beschreibt die Reformabschnitte und deren Auswirkungen auf die föderale Ordnung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Föderalismus, Reformbedarf, Reformpolitik, Vergleichende Politikwissenschaft, Entwicklungspfade, Institutionen, Akteure, Deutschland, Schweiz, USA, Internationale Trends, Globalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Länder werden in diesem Föderalismus-Vergleich untersucht?
Die Arbeit vergleicht die föderalen Systeme von Deutschland, der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika (USA).
Warum unterscheiden sich die Reformergebnisse trotz ähnlicher Herausforderungen?
Die Untersuchung zeigt, dass primär endogene Faktoren wie nationale Institutionen, Akteurskonstellationen und spezifische Entwicklungspfade über den Erfolg von Reformen entscheiden.
Wie wird die föderale Ordnung Deutschlands in der Arbeit charakterisiert?
Deutschland wird als Exekutivföderalismus mit einem ausgeprägten Hang zur Verflechtung (unitarischer Bundesstaat) beschrieben.
Was kennzeichnet die Reformpolitik in den USA zwischen 1963 und 1981?
Dieser Zeitraum war geprägt durch Johnsons „Creative Federalism“ und Nixons „New Federalism“, was zu einer ambivalenten Reformpolitik und zunehmender Verflechtung führte.
Welche Rolle spielt die Globalisierung für moderne Föderalstaaten?
Globalisierung und technologischer Wandel erzeugen internationalen Reformbedarf, der die Diskussionen über die föderale Ordnung in ähnliche Richtungen lenkt.
- Citar trabajo
- Sebastian Kretz (Autor), 2007, Reformbedarf und Reformpolitik in Föderalstaaten: Deutschland, die Schweiz und die USA im Vergleich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91485