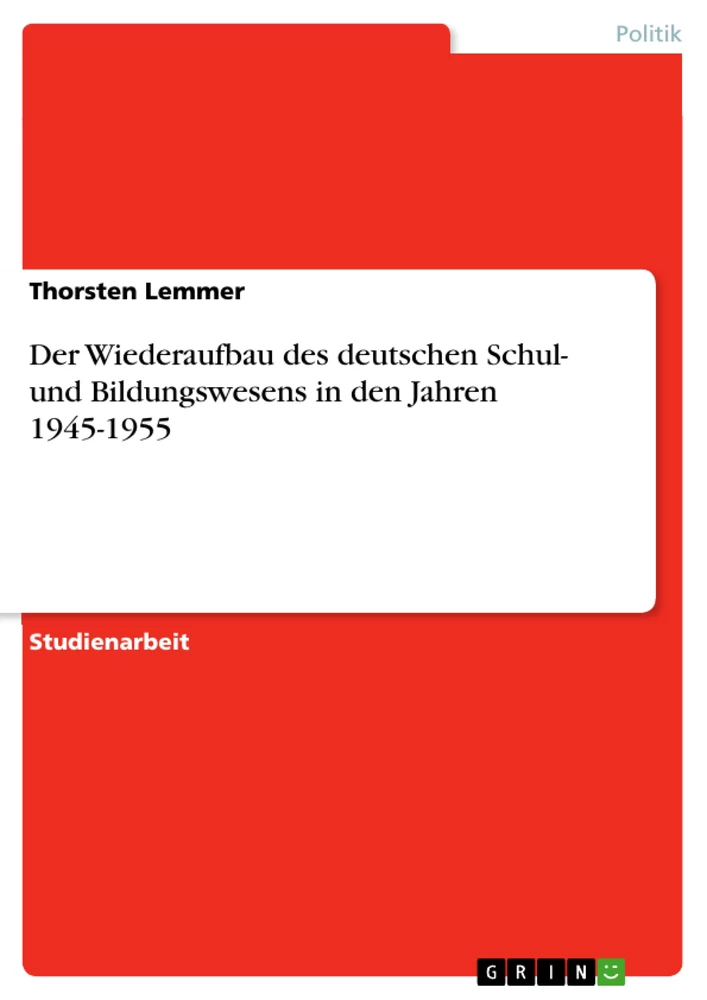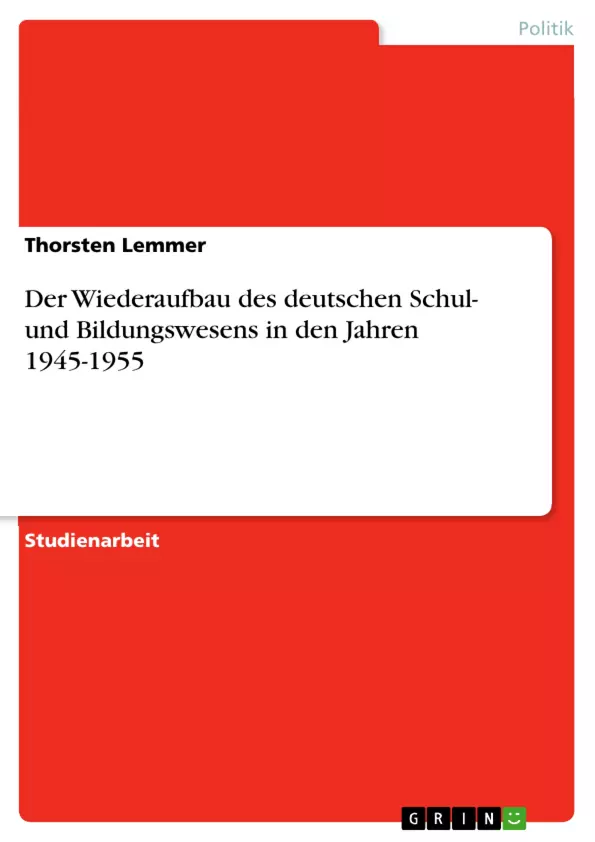Die Arbeit befasst sich mit dem Wiederaufbau des deutschen Schul- und
Bildungswesens in den Jahren 1945-1955 im Spannungsfeld bildungspolitischer
Vorstellungen der Alliierten, untersucht am Beispiel der USA, und der in
Deutschland am Wiederaufbau maßgeblich beteiligten politischen Gruppen,
untersucht am Beispiel der Christlich-Demokratischen Union.
Es soll die Frage untersucht werden, ob es "nach 1945 die Chance für einen
schul- und bildungspolitischen Neuanfang"1 gab, wer in welcher Form an
Entscheidungen beteiligt war und welche Positionen vertreten wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Reformpädagogik vor 1933 als Basis für Bildungspolitik nach 1945
- Reformpädagogische Forderungen seit 1848
- Reichsschulkonferenz und Weimarer Schulkompromiss 1920
- Zielsetzung, Planung und Verlauf amerikanischer Bildungsreformanstrengungen nach 1945
- Diskussion verschiedener Ansätze in den Vereinigten Staaten
- Die Vorstellungen des „Morgenthau-Kreises“
- Die Vorstellungen der Befürworter einer Westintegration
- Auswirkungen des amerikanischen Schulsystem und des Deweyismus auf die Vorstellungen zur re-education
- Planung der re-education bis zur deutschen Kapitulation
- Weitere Planung und Verlauf der re-education
- JCS 1067, Potsdam und die SWNCC 269/5
- Zook-Kommission, JCS 1779 und ACC Nr.54
- Unterschiede amerikanischer und britischer re-education-Politik
- Diskussion verschiedener Ansätze in den Vereinigten Staaten
- Historischer Exkurs; Entwicklung in Deutschland seit Potsdam bis zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland
- Die Formierung gesellschaftlich relevanter Gruppen in Deutschland am Beispiel der CDU
- Einschätzung des Nationalsozialismus als Grundlage des Neuanfangs
- Die parteigeschichtliche Entwicklung der CDU
- Das „Ahlener Programm\" und das Ende des christlichen Sozialismus
- Die Wende zur Marktwirtschaft
- Bildungspolitische Vorstellungen der CDU
- Das christliche Bildungsideal der CDU
- Schulpolitische Konsequenzen
- Die Forderung nach Konfessionsschulen
- Die Forderung nach dem dreigliedrigen Schulwesen
- Äußere und innere Schulreform
- Re-education, Schulreform und deutscher Widerstand
- Amerikanische Vorstellungen zur Schulreform
- Deutscher Widerstand gegen die Reformpläne
- Antikommunismus
- Antiamerikanismus
- Traditionalismus
- Innerschulische Gründe
- Sozio-ökonomische Rahmenbedingungen
- Das Reformbeispiel Bayern
- Besonderheiten und Ausgangslage Bayerns
- Der zweite und dritte Reformplan Hundhammers
- Die Verhinderung der Reform
- Der erste Reformplan Hundhammers
- Das Reformbeispiel Hessen
- Der Schramm-Plan
- Stein: Der erste Reformplan
- Stein: Der zweite Reformplan und der weitere Verlauf
- Die Phase der offenen Restauration
- Die Revision der progressiven Schulgesetze
- Berlin
- Schleswig-Holstein
- Hamburg
- Bremen
- Die Ausweitung des Konfessionalismus
- Die Revision der progressiven Schulgesetze
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Wiederaufbau des deutschen Schul- und Bildungswesens in den Jahren 1945-1955 im Spannungsfeld bildungspolitischer Vorstellungen der Alliierten, untersucht am Beispiel der USA, und der in Deutschland am Wiederaufbau maßgeblich beteiligten politischen Gruppen, untersucht am Beispiel der Christlich-Demokratischen Union. Die Arbeit analysiert, ob es nach 1945 die Chance für einen schul- und bildungspolitischen Neuanfang gab, wer in welcher Form an Entscheidungen beteiligt war und welche Positionen vertreten wurden.
- Analyse der Reformpädagogik vor 1933 als Grundlage für die Bildungspolitik nach 1945.
- Untersuchung der Zielsetzung, Planung und des Verlaufs amerikanischer Bildungsreformanstrengungen nach 1945, einschließlich der Diskussion verschiedener Ansätze in den Vereinigten Staaten und der Planung der re-education.
- Analyse der Formierung gesellschaftlich relevanter Gruppen in Deutschland am Beispiel der CDU, insbesondere deren Einschätzung des Nationalsozialismus und deren bildungspolitische Vorstellungen.
- Behandlung der Re-education, der Schulreform und des deutschen Widerstands gegen die Reformpläne, einschließlich der Analyse der sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen und der Reformbeispiele Bayern und Hessen.
- Darstellung der Phase der offenen Restauration und der Revision der progressiven Schulgesetze.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Darstellung der Reformpädagogik vor 1933, um zu zeigen, dass die Vorstellungen der Alliierten nicht gänzlich neu waren und auch im besiegten Deutschland viele Anhänger hatten. Anschließend wird das Programm der re-education der USA als Grundlage amerikanischer Forderungen nachgezeichnet. Die bildungspolitischen Vorstellungen der USA erscheinen besonders bedeutsam, da sie selbst als Hauptträger dieser Politik der Umerziehung galten und den größten Aufwand an Mensch und Material betrieben. Die Arbeit beleuchtet dann die öffentliche Meinung in Deutschland, insbesondere die Position der Christlich-Demokratischen Union, die in dieser Zeit gesellschaftlich relevant war und die Geschicke Deutschlands lange Jahre zu steuern hatte. Am Beispiel des Landes Bayern wird der starke Widerstand der Deutschen gegen jede Antastung ihres Schulsystems und die dadurch bedingten Einschränkungen der amerikanischen Reformbemühungen aufgezeigt. Schließlich wird die schulpolitische Entwicklung nach 1950 dargestellt, die durch die einsetzende Restauration der progressiven Schulreformen durch die inzwischen zu politischer Macht gekommene CDU gekennzeichnet ist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die folgenden Schlüsselwörter und Themengebiete: Reformpädagogik, Bildungspolitik, Schulreform, Einheitsschule, dreigliedriges Schulwesen, re-education, Amerikanisierung, deutsche Nachkriegsgesellschaft, Christlich-Demokratische Union, Widerstand, Restauration.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der amerikanischen "re-education" nach 1945?
Ziel war die demokratische Umerziehung der deutschen Bevölkerung und die Beseitigung nationalsozialistischer Ideologien durch eine grundlegende Reform des Schul- und Bildungswesens.
Welche Rolle spielte die CDU beim Wiederaufbau des Schulwesens?
Die CDU vertrat ein christliches Bildungsideal und forderte die Beibehaltung des dreigliedrigen Schulsystems sowie die Einführung von Konfessionsschulen, was oft im Gegensatz zu den Reformplänen der Alliierten stand.
Warum gab es in Deutschland Widerstand gegen die US-Reformpläne?
Der Widerstand speiste sich aus Traditionalismus, Antiamerikanismus und der Sorge, das bewährte Bildungssystem zu verlieren. Auch sozio-ökonomische Faktoren spielten eine Rolle.
Was bedeutet "Restauration" im Kontext der Bildungspolitik nach 1950?
Restauration bezeichnet die Rückkehr zu traditionellen Strukturen (wie dem dreigliedrigen System) und die Revision progressiver Schulgesetze, die kurz nach dem Krieg eingeführt worden waren.
Wie unterschieden sich die Reformansätze in Bayern und Hessen?
In Bayern gab es unter Kultusminister Hundhammer starken Widerstand gegen US-Vorgaben, während in Hessen mit dem Schramm-Plan progressivere Ansätze verfolgt wurden, die jedoch ebenfalls auf Hürden stießen.
- Citar trabajo
- Thorsten Lemmer (Autor), 2002, Der Wiederaufbau des deutschen Schul- und Bildungswesens in den Jahren 1945-1955, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9155