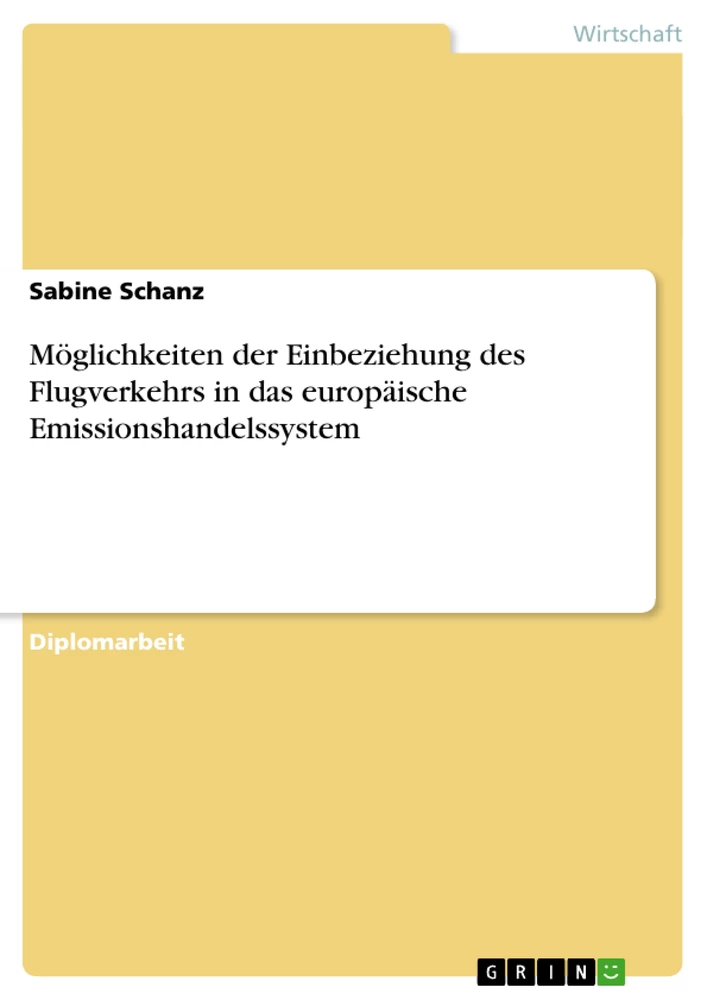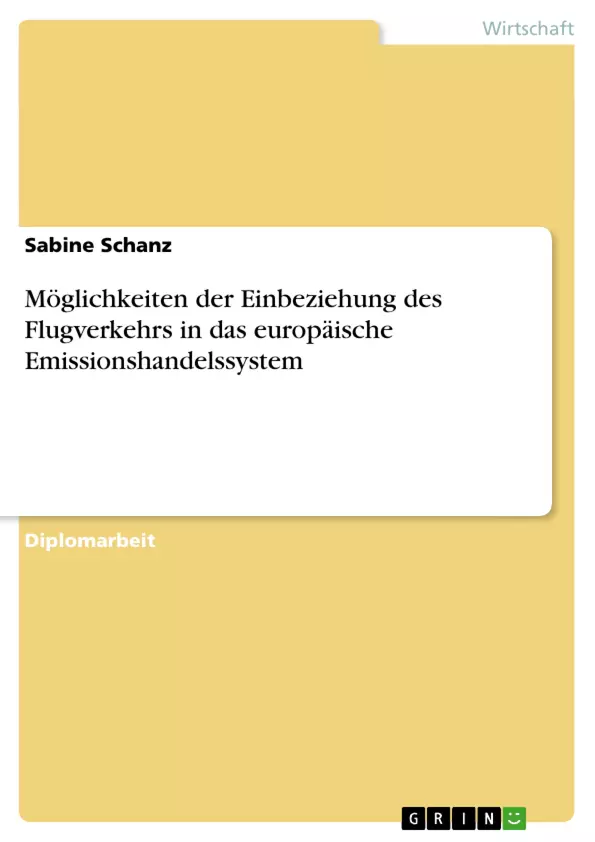Seit der Industrialisierung und den stetig wachsenden Bedürfnissen der Menschen, sind die natürlichen Ressourcen der Erde durch Übernutzung und Missbrauch gefährdet. Klimawandel und Erderwärmung sind mittlerweile in aller Munde. Die Menschen auf der ganzen Welt bekom-men die Folgen des Klimawandels zu spüren. Spätestens die breite Berichterstattung der letzten Jahre über Umweltkatastrophen, wie Hochwasser, Trockenheit, Stürme und Waldbrände, haben die Sensibilität der Menschen für dieses Thema geweckt. Als Hauptursache der steigenden Temperaturen und dem damit einhergehenden Klimawandel, entdeckten die Klimaforscher einen Anstieg verschiedener Treibhausgase in der Atmosphäre, der auf den Menschen zurückzuführen ist. Aufgrund ihres Erwärmungspotentials, könnten diese Gase einen Temperaturanstieg von bis zu 5°C innerhalb der nächsten 100 Jahre auslösen. Dies hätte nicht nur weitreichende Folgen für Umwelt und Menschen, sondern würde auch bezifferbare ökonomische Probleme mit sich bringen. Aufgrund der hohen Bedeutsamkeit des Themas, wurde 1988 der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) gegründet, der sich mit der neutralen und objektiven Auswertung und Verbreitung der naturwissenschaftlichen Daten befasst. Ziel war und ist es, der breiten Masse das Thema Klimaveränderungen näher zu bringen. Im Jahr 1992 setzte sich dann die internationale Weltgemeinschaft in der Klimarahmenkonvention von Rio de Janeiro zum Ziel, „[…] die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre auf einem Niveau zu erreichen, auf dem eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems verhindert wird. Ein solches Ziel sollte innerhalb eines Zeitraums erreicht werden, der ausreicht, damit sich die Ökosysteme auf natürliche Weise den Klimaänderungen anpassen können, die Nahrungsmittelerzeugung nicht bedroht wird und die wirtschaftliche Entwicklung auf nachhaltige Weise fortgeführt werden kann“ [Vereinte Nationen (1992, Art. 2)]. Seitdem hat es viele weitere Vertragsstaatenkonferenzen gegeben, die sich alle die Verminderung der klimaschädlichen Auswirkungen zum Ziel gesetzt haben. [....]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ökonomische Grundlagen
- Marktgleichgewicht und der 1. Satz der Wohlfahrtstheorie
- Marktversagen und externe Effekte
- Klassifizierung von Gütern: Das öffentliche Gut
- Luft, ein öffentliches Gut?
- Externe Effekte
- Übersicht der umweltpolitischen Instrumente
- Internalisierung von externen Effekten durch Umweltinstrumente
- Kriterien zur Bewertung umweltpolitischer Instrumente
- Statisch ökonomische Effizienz
- Ökologische Treffsicherheit
- Dynamisch ökonomische Effizienz
- Administrative Effizienz
- Zertifikate als Instrument der Umweltpolitik
- Allgemeine Bedingungen und Voraussetzungen für den Handel mit Zertifikaten
- Erstausgabemechanismen
- Grandfathering
- Benchmarking
- Versteigerung
- Bewertung des umweltpolitischen Instruments Zertifikate
- Statisch ökonomische Effizienz
- Ökologische Treffsicherheit
- Dynamisch ökonomische Effizienz
- Administrative Effizienz
- Auktionsformen im Rahmen von Emissionshandel
- Unterscheidung von Auktionen nach der Bietregel
- Unterscheidung von Auktionen nach der Art des Gutes
- Das Erlös-Äquivalenz-Theorem
- Auktionen unter veränderten Bedingungen
- Flugverkehr
- Grundlagen zur Klimaproblematik im Flugverkehr und ökonomische Notwendigkeiten
- Klimarelevante Emissionen des Luftverkehrs und ihre Auswirkungen
- Besonderheiten der Fluggesellschaften in Hinblick auf Kosten, Marktstrukturen und die Wettbewerbssituation
- Linienfluggesellschaften
- Billigfluggesellschaften
- Charterfluggesellschaften
- Wettbewerbssituation der unterschiedlichen Marktformen im Flugverkehr
- Europäischer Emissionshandel
- Emissionshandel in Deutschland und Europa unter Berücksichtigung von Ergebnissen und bisherigen Erfahrungen
- Aktueller Stand des Emissionshandels in Europa
- Aktueller Stand des Emissionshandels in Deutschland
- Erfahrungen und Probleme mit dem Emissionshandel in Deutschland und Europa
- Bestimmungen und Voraussetzungen zur Einbindung des Flugverkehrs in das EU-ETS
- Zentrale Optionen der Gestaltung der Einbindung des Flugverkehrs in das EU-ETS
- Klimawirksamkeit der Maßnahmen
- Geografischer Anwendungsbereich
- Zuteilung und Verteilung von Zertifikaten
- Zusammenspiel mit dem Kyoto-Protokoll
- Kontrollmethoden und Auswahl von drei politischen Handlungsoptionen
- Die Handlungsoptionen, ihre ökonomischen und ökologischen Auswirkungen und ihre Gegenüberstellung und Bewertung durch die EU
- Ökologische Auswirkungen
- Ökonomische Auswirkungen
- Gegenüberstellung und Bewertung der Optionen durch die EU
- Der Vorschlag der EU-Kommission zur Einbindung des Flugverkehrs in das EU-ETS
- Reaktionen auf die Richtlinien und Gesetze zur Einführung des Flugverkehrs in das EU-ETS
- Aktuelle Entwicklungen
- Einbeziehung des Flugverkehrs in das EU-ETS unter besonderer Berücksichtigung der Allokation durch Versteigerungen
- Theoretische Analyse einer Primärallokation von Zertifikaten anhand von Versteigerungen
- Preiselastizitäten und Preisdiskriminierung im Flugverkehr
- Wahl der Versteigerungsform im Mehrgüterfall
- Ermittlung von Zahlungsbereitschaften der Fluggesellschaften
- Wahl der Auktionsform und Praktikabilität von Auktionen in den Marktsegmenten der Billig- und Linienfluggesellschaften
- Analyse der ökonomischen Grundlagen des Emissionshandels
- Beurteilung der Klimaproblematik im Flugverkehr
- Bewertung der unterschiedlichen Marktstrukturen im Flugverkehr
- Untersuchung verschiedener Optionen für die Einbindung des Flugverkehrs in das EU-ETS
- Analyse der Auswirkungen von Versteigerungen im Kontext des Emissionshandels für den Flugverkehr
- Das erste Kapitel bietet eine Einführung in die Thematik und legt den Fokus auf die Bedeutung der Einbeziehung des Flugverkehrs in das EU-ETS.
- Das zweite Kapitel analysiert die ökonomischen Grundlagen des Emissionshandels, einschließlich der Diskussion von Marktversagen, externen Effekten und der Rolle von Zertifikaten.
- Das dritte Kapitel beleuchtet die spezifischen Herausforderungen und Besonderheiten des Flugverkehrs im Kontext der Klimaproblematik.
- Das vierte Kapitel befasst sich mit dem aktuellen Stand des EU-ETS, den Erfahrungen mit dem Emissionshandel und den zentralen Optionen für die Einbindung des Flugverkehrs.
- Das fünfte Kapitel untersucht die Auswirkungen von Versteigerungen als Allokationsmechanismus für Zertifikate im Flugverkehr.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Einbeziehung des Flugverkehrs in das europäische Emissionshandelssystem (EU-ETS). Ziel ist es, die ökonomischen und ökologischen Auswirkungen verschiedener Handlungsoptionen zu analysieren und die beste Variante für die Einbindung des Flugverkehrs zu identifizieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Emissionshandel, EU-ETS, Flugverkehr, Klimawandel, externe Effekte, Zertifikate, Versteigerungen, Auktionen, Marktstrukturen, Wettbewerb, Preisdiskriminierung, ökologische Effizienz, ökonomische Effizienz.
Häufig gestellte Fragen
Warum soll der Flugverkehr in das EU-ETS einbezogen werden?
Um die steigenden Treibhausgasemissionen des Luftverkehrs zu begrenzen und einen Beitrag zur Stabilisierung des Klimasystems zu leisten.
Was sind externe Effekte im Kontext des Luftverkehrs?
Es handelt sich um Klimaschäden, die durch Emissionen verursacht werden, aber nicht in den Preisen der Fluggesellschaften enthalten sind (Marktversagen).
Welche Methoden zur Zuteilung von Zertifikaten gibt es?
Die Arbeit untersucht das Grandfathering (historische Basis), Benchmarking (Effizienzbasis) und die Versteigerung (Auktionen).
Wie unterscheiden sich Billig- und Linienfluggesellschaften im Emissionshandel?
Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Kostenstrukturen und Preiselastizitäten, die die Zahlungsbereitschaft für Zertifikate beeinflussen.
Was ist das Ziel der ökologischen Treffsicherheit bei Zertifikaten?
Es soll sichergestellt werden, dass die politisch festgelegten Emissionsziele durch das Instrument tatsächlich präzise erreicht werden.
- Citar trabajo
- Dipl. oek. Sabine Schanz (Autor), 2007, Möglichkeiten der Einbeziehung des Flugverkehrs in das europäische Emissionshandelssystem, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91610