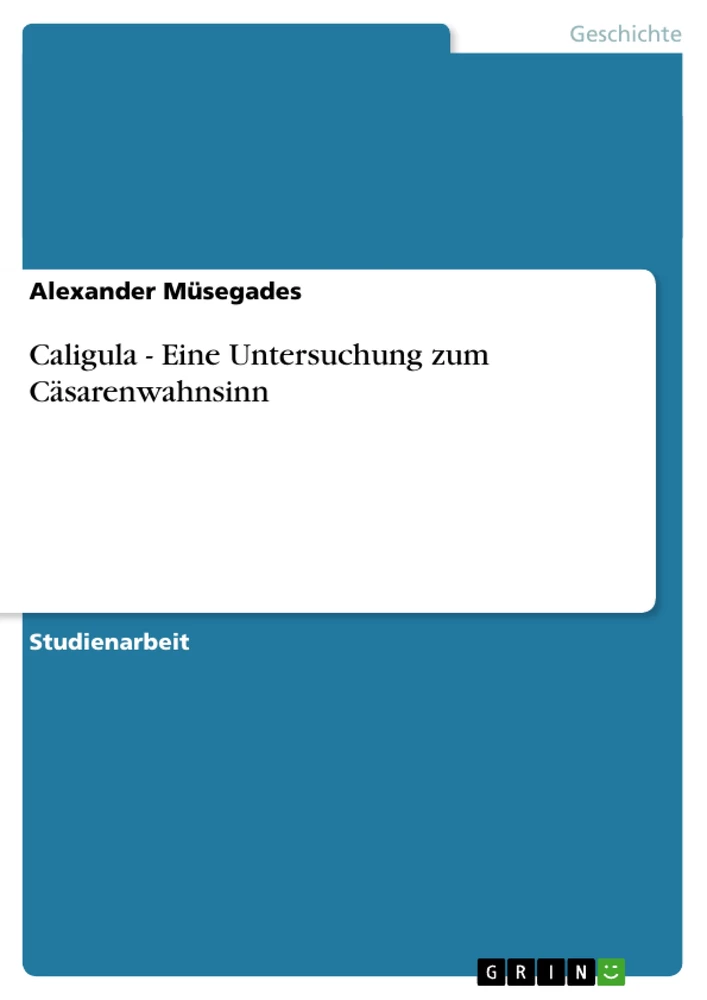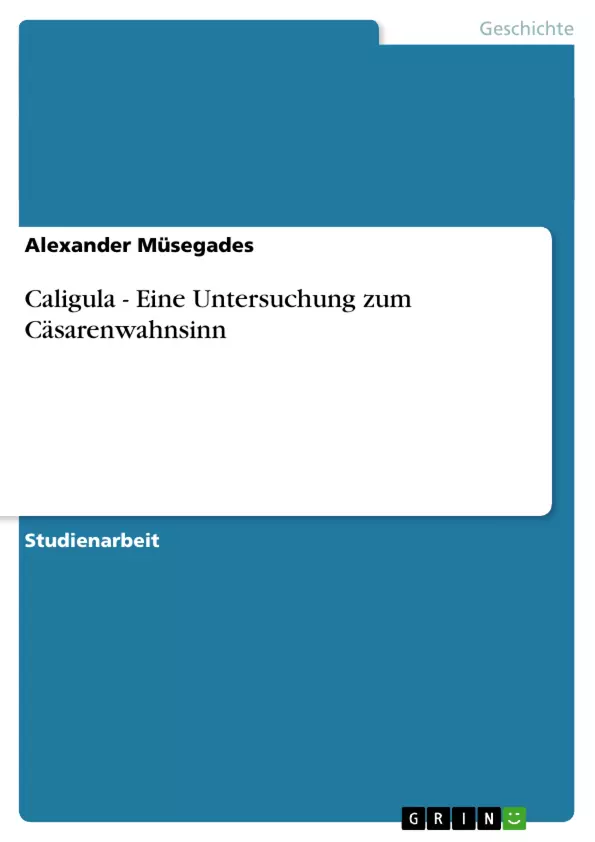Nachdem Tiberius im Jahr 37 n. Chr. gestorben war, folgte ihm Caligula, der Enkel seines Bruders Drusus d. Ä. und zugleich Urenkel des Augustus, als römischer Kaiser nach. Er regierte bis zu seiner Ermordung im Jahr 41 n. Chr.
In seiner Herrschaftszeit wird von vielen willkürlich erscheinenden Taten berichtet: Überhebliche Bautätigkeiten, blutige Gladiatorenspiele, sinnlose Militärakte und allgemeine Tyrannei über das römische Volk. In diesem Zusammenhang wird in den antiken Quellen und den Forschungsberichten der Neuzeit oftmals herausgestellt, dass Caligula dem Wahnsinn verfallen sein soll. Die moderne Forschung hat dafür den Begriff des „Cäsarenwahnsinns“ eingeführt.
In der folgenden Arbeit soll geklärt werden, welches Caligula-Bild die antiken Quellen vermitteln und welche Rückschlüsse die moderne Forschung daraus gezogen hat. Insbesondere die These des Cäsarenwahnsinns in der antiken und modernen Darstellung und ihre Glaubhaftigkeit werden untersucht. Eine Definition des Cäsarenwahnsinns wird im Nachfolgenden gegeben. Sueton, Cassius Dio und Tacitus werden als antike Quellen behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Quellenlage
- III. Caligulas Darstellung in den Quellen
- IV. Mögliche Gründe für Caligulas Handeln
- V. Cäsarenwahnsinn
- VI. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Darstellung Caligulas in antiken Quellen und untersucht die These des „Cäsarenwahnsinns“. Sie beleuchtet die Glaubhaftigkeit dieser These sowohl in der antiken als auch in der modernen Forschung.
- Analyse der antiken Quellen zur Persönlichkeit und Herrschaft Caligulas
- Bewertung der Glaubwürdigkeit und der möglichen Verzerrungen in den Quellen
- Definition und Untersuchung des Konzepts „Cäsarenwahnsinn“
- Beurteilung der Argumente für und gegen die These des Cäsarenwahnsinns bei Caligula
- Einordnung der Herrschaft Caligulas im Kontext der römischen Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt den Leser in das Thema der Arbeit ein, stellt die zentrale Frage nach der Rolle des "Cäsarenwahnsinns" bei Caligula und benennt die relevanten Quellen.
II. Quellenlage: Dieses Kapitel analysiert die wichtigsten Quellen für die Erforschung Caligulas, darunter die Kaiserviten von Suetonius, die Römische Geschichte von Cassius Dio und die Annalen von Tacitus. Es werden die Stärken und Schwächen jeder Quelle sowie deren mögliche Verzerrungen kritisch beleuchtet.
III. Caligulas Darstellung in den Quellen: Dieses Kapitel untersucht, welches Bild von Caligula die antiken Quellen vermitteln. Es analysiert die Beschreibungen seiner Taten, seines Charakters und seiner Herrschaft in den Werken von Suetonius, Cassius Dio und Tacitus.
IV. Mögliche Gründe für Caligulas Handeln: Dieses Kapitel erörtert verschiedene Gründe für Caligulas Handeln und Verhalten. Es werden Faktoren wie seine Kindheit, seine Erziehung, die politische Situation und mögliche psychische Störungen betrachtet.
V. Cäsarenwahnsinn: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Cäsarenwahnsinn" und untersucht, ob und inwieweit diese Diagnose auf Caligula zutrifft. Es werden die Argumente für und gegen die These des Cäsarenwahnsinns bei Caligula analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der antiken Quellen zur Herrschaft Caligulas, insbesondere auf die Werke von Suetonius, Cassius Dio und Tacitus. Zentrale Themen sind der "Cäsarenwahnsinn", die Darstellung Caligulas in den Quellen, die Bewertung der Glaubwürdigkeit der Quellen und die Analyse von möglichen Gründen für Caligulas Verhalten. Die Arbeit untersucht die These des Cäsarenwahnsinns und die Frage, ob und inwieweit diese Diagnose auf Caligula zutrifft.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff „Cäsarenwahnsinn“?
Der Begriff beschreibt die in der Forschung diskutierte These, dass römische Kaiser wie Caligula aufgrund ihrer unbeschränkten Macht psychischen Störungen oder Größenwahn verfielen.
Welche antiken Quellen berichten über Caligula?
Die wichtigsten Quellen sind Sueton (Kaiserviten), Cassius Dio (Römische Geschichte) und Tacitus (Annalen).
Wie glaubwürdig sind die Berichte über Caligulas Wahnsinn?
Die Arbeit untersucht kritisch, inwieweit die antiken Autoren durch politische Voreingenommenheit oder literarische Topoi das Bild eines „wahnsinnigen Tyrannen“ bewusst konstruiert haben.
Welche Taten Caligulas werden oft als Beweis für seinen Wahnsinn angeführt?
Berichtet wird von willkürlichen Hinrichtungen, überheblichen Bauprojekten, blutigen Gladiatorenspielen und bizarren Militäraktionen.
Welche alternativen Erklärungen gibt es für Caligulas Verhalten?
Die Forschung betrachtet auch Faktoren wie seine traumatische Kindheit, die politische Instabilität und das Bestreben, ein absolutistisches Herrschaftsmodell gegen den Widerstand des Senats durchzusetzen.
- Citar trabajo
- Alexander Müsegades (Autor), 2007, Caligula - Eine Untersuchung zum Cäsarenwahnsinn, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91621