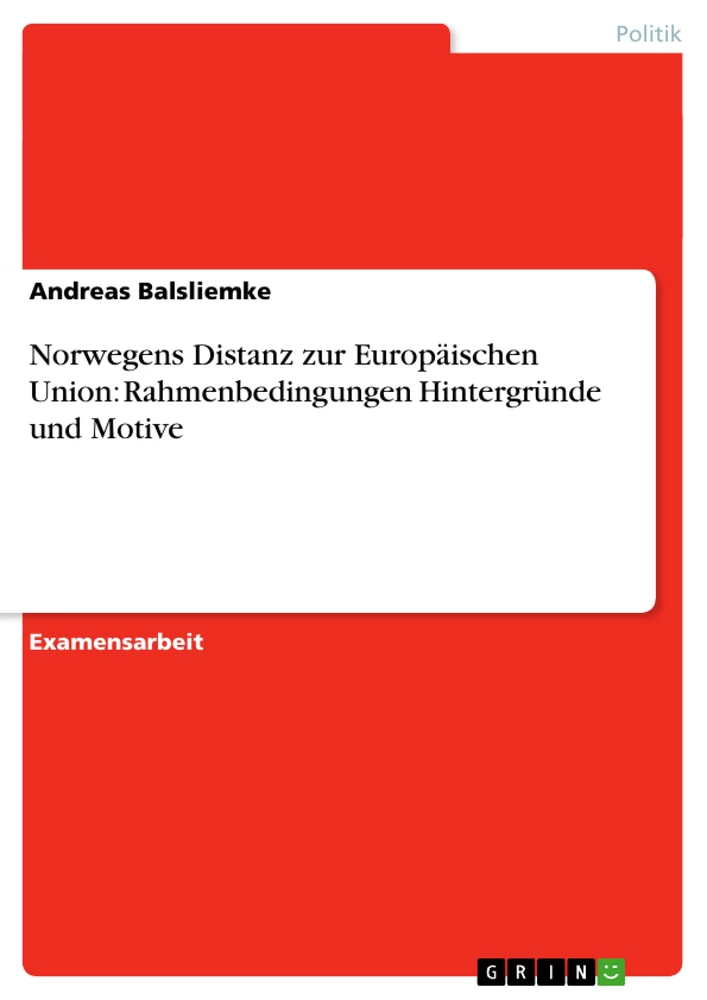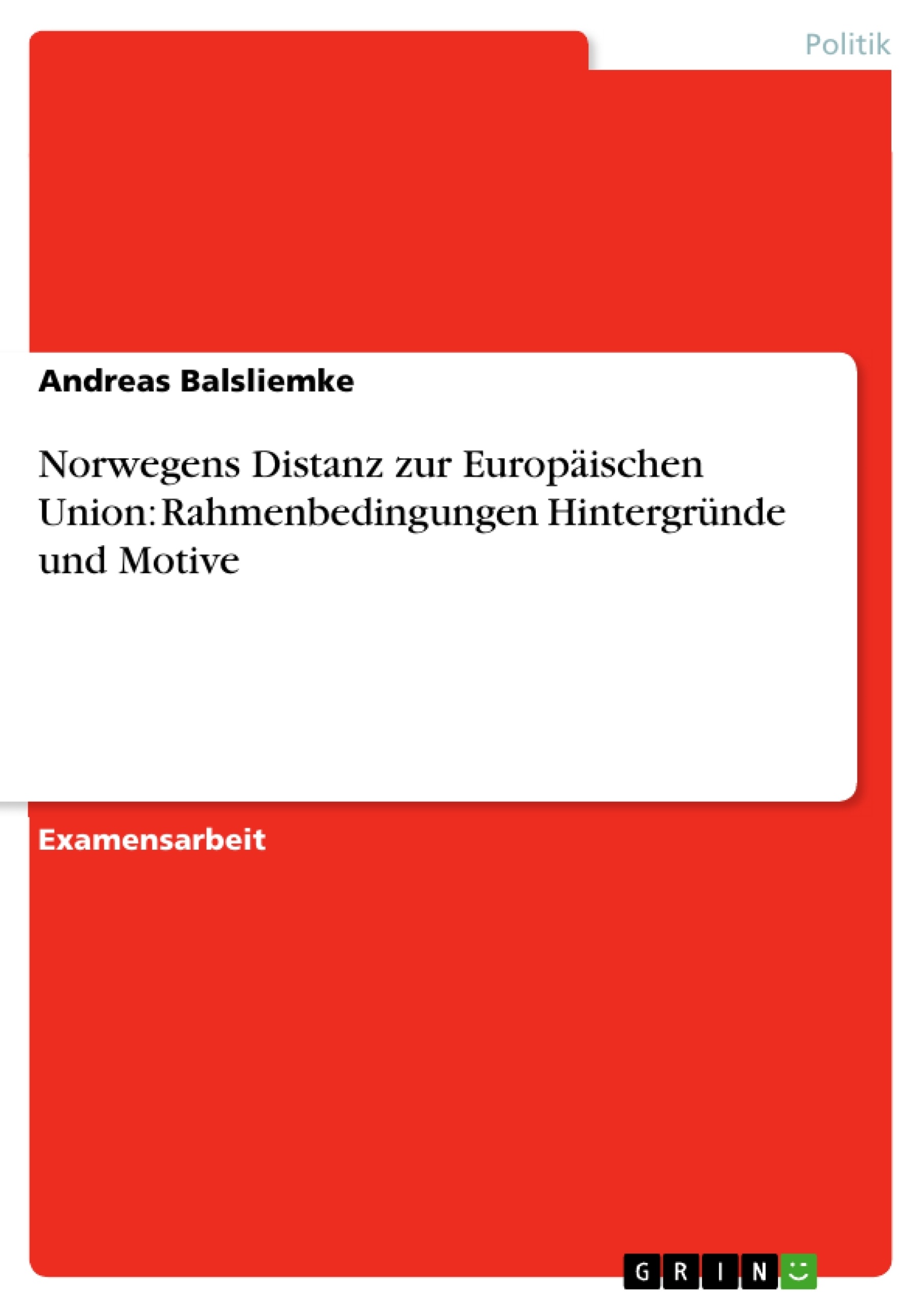„Norwegen, diese Extravaganz an der Peripherie Europas, zwischen Ölterminal und Sommerhütte, Einödhof und Glasarchitektur, Kapitalexport und Gottesfrieden, ist nicht das irdische
Paradies, sondern ein Monument des Eigensinns, und eine maulende Idylle.“ Mit diesem Satz schloß Hans Magnus Enzensberger eine Reportage aus dem Jahr 1984, zwölf Jahre nachdem eine knappe Mehrheit der Norweger bei einem Referendum den Beitritt ihres Landes zur damaligen Europäischen Gemeinschaft abgelehnt hatte.
Zehn Jahre nach Vollendung der Reportage, in welcher die Paradoxien, welche das Leben in Norwegen charakterisieren, so treffend wie in wenigen anderen Texten beschrieben wurden, fand ein zweites Referendum über eine mögliche Mitgliedschaft des Landes
in der Europäischen Union statt. Diese wurde von einer neuerlichen Mehrheit abgeschmettert.[...]
Statt nach Gründen wird in dieser Arbeit nach Hintergründen gesucht, welche helfen können, den Ausgang des letzten Referendums jenseits der offen vorgetragenen Argumente zu erleuchten. Statt Argumente für oder vor allem gegen den möglichen Beitritt Norwegens zur Europäischen Union zusammenzutragen und zu erörtern, soll erstens die
Frage gestellt werden, inwiefern eine mögliche Mitgliedschaft in der EU mit der nationalen Identität als Ganzem in Norwegen in Konflikt geraten konnte, und zweitens, welche Gruppen der Gesellschaft aus welchen Gründen gegen den Beitritt waren.
Eröffnet wird die Arbeit mit einem Kapitel über begriffliche und geschichtliche Grundlagen, welche für das Verständnis der nachfolgenden Darstellungen unverzichtbar oder
zumindest nützlich sind. In den weiteren Kapiteln werden dann verschiedene Aspekte der politischen Soziologie Norwegens und ihre Relevanz für das Verständnis des Referendums
von 1994 erläutert. Im einzelnen sind dies kulturgeschichtliche Rahmenbedingungen, welche für die ganze Bevölkerung von Bedeutung sind, sowie kulturgeographische und sozioökonomische Rahmenbedingungen, welche jeweils bestimmte Gruppen der Bevölkerung zu beschreiben helfen. Diese Unterscheidung schien aus Gründen der inneren Logik der Abhandlung sinnvoll zu sein, auch wenn sie sich nicht an allen Stellen konsequent durchhalten ließ, da die einzelnen behandelten Aspekte intern verflochten sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Inhalt und Gliederung
- Kapitel I: Begriffsdefinitionen und eine geschichtliche Einführung
- Wichtige Begriffe kurz erläutert
- Einige Hinweise zur Geographie und Demographie Norwegens
- Eine kursorische Schilderung der politischen ‘Frühgeschichte' Norwegens
- Der Unabhängigkeit entgegen: Die Zeit bis zum 17. Mai 1814
- Der Nation entgegen: Die Zeit bis 1905:
- Kapitel II: Kulturgeschichtliche Charakteristika Norwegens
- Darstellung und Analyse der Entstehungsgeschichte nationaler Identität
- Einige Anmerkungen zu den Ereignissen im Jahr 1814
- Die Entstehung der nationalen Identität und der Nationalismus im 19. Jahrhundert:
- Kulturgeschichtliche Charakteristika Norwegens
- Das große Dorf Norwegen
- Feindbild Union
- Schaler Nationalismus
- Zwischenresümee
- Darstellung und Analyse der Entstehungsgeschichte nationaler Identität
- Kapitel III: Kulturgeographische Charakteristika Norwegens
- Litt om motsetninga mellom austlandet og vestlandet"
- Ein wenig über die Gegensätze zwischen Østland und Vestland
- Die Gegenkulturen
- Die Sprachbewegung und das Nynorsk/ Landsmål
- Religion, Pietismus und nationale Identität
- Die Abstinenzbewegung
- Zwischenresümee
- Die extreme Peripherie: Nordnorwegen
- Litt om motsetninga mellom austlandet og vestlandet"
- Kapitel IV: Sozioökonomische Charakteristika Norwegens
- Die Bauernbewegung, Nei til EU und die Distriktspolitik
- Über den direkten Einfluß der Landwirte
- Über die Motivation und den indirekten Einfluß der Landwirte
- Die Frauenbewegung
- Überblick über die jüngere Geschichte
- Zahlen über den Stand der Bemühungen
- Motivationen für den Widerstand
- Über den politischen Einfluß der Frauen in den Jahren 1972 und 1994
- Zwischenresümee
- Die Bauernbewegung, Nei til EU und die Distriktspolitik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Norwegens Distanz zur Europäischen Union und untersucht die Rahmenbedingungen, Hintergründe und Motive für diese Haltung. Sie beleuchtet die Entwicklung der norwegischen Identität, insbesondere die Herausbildung des Nationalismus im 19. Jahrhundert und die damit verbundenen kulturellen und sozioökonomischen Faktoren.
- Entstehung und Entwicklung der norwegischen Identität
- Kulturgeschichtliche und sozioökonomische Charakteristika Norwegens
- Die Rolle der Bauernbewegung und der Frauenbewegung in der norwegischen Politik
- Die Distanz Norwegens zur Europäischen Union und die dahinterliegenden Motive
- Die Bedeutung der Gegenkulturen und der Peripherie in der norwegischen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I stellt wichtige Begriffe vor und gibt eine geschichtliche Einführung in die norwegische Politik, von der Zeit der Unabhängigkeit bis zur Auflösung der Union mit Schweden. Kapitel II erörtert die Entstehung der norwegischen Identität und untersucht die kulturellen Charakteristika des Landes, einschließlich der Rolle der Gegenkulturen und des Nationalismus. Kapitel III widmet sich den kulturgeographischen Charakteristika Norwegens, mit einem Fokus auf die Gegensätze zwischen Ost- und Westnorwegen sowie die Bedeutung der Peripherie. Kapitel IV beleuchtet die sozioökonomischen Charakteristika Norwegens, insbesondere die Bauernbewegung, die Frauenbewegung und die Rolle der Landwirtschaft in der Politik.
Schlüsselwörter
Norwegische Identität, Nationalismus, Gegenkulturen, Europäische Union, Bauernbewegung, Frauenbewegung, Distanz, Kulturgeschichte, Sozioökonomie, Peripherie, Landwirtschaft, Politik, Geographie, Demographie.
Häufig gestellte Fragen
Warum hat Norwegen den EU-Beitritt abgelehnt?
Die Ablehnung in den Referenden (1972 und 1994) beruhte auf einer starken nationalen Identität, dem Wunsch nach Souveränität, dem Schutz der Fischerei und Landwirtschaft sowie einer tief verwurzelten Skepsis gegenüber zentralistischen Unionen.
Welche Rolle spielt die norwegische Geschichte beim EU-Widerstand?
Norwegen war lange Zeit Teil von Unionen mit Dänemark und Schweden. Die Erlangung der Unabhängigkeit 1905 prägte ein „Feindbild Union“, das jede Abgabe von Souveränität an eine übergeordnete Instanz wie die EU kritisch erscheinen lässt.
Was sind die sogenannten „Gegenkulturen“ in Norwegen?
Dazu gehören die Sprachbewegung (Nynorsk), religiöse pietistische Strömungen und die Abstinenzbewegung. Diese Gruppen sind oft ländlich geprägt und bilden ein starkes Fundament für den Widerstand gegen die europäische Integration.
Warum sind norwegische Landwirte gegen die EU?
Die Bauernbewegung fürchtet um die Existenz der kleinteiligen norwegischen Landwirtschaft und die nationalen Subventionen (Distriktspolitik), die durch die EU-Agrarpolitik gefährdet sein könnten.
Wie unterschied sich das Stimmverhalten von Frauen und Männern?
Die Frauenbewegung spielte eine wichtige Rolle beim „Nei til EU“. Viele Frauen befürchteten negative Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft auf den norwegischen Wohlfahrtsstaat und die Gleichstellungspolitik.
- Quote paper
- Andreas Balsliemke (Author), 1997, Norwegens Distanz zur Europäischen Union: Rahmenbedingungen Hintergründe und Motive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9169