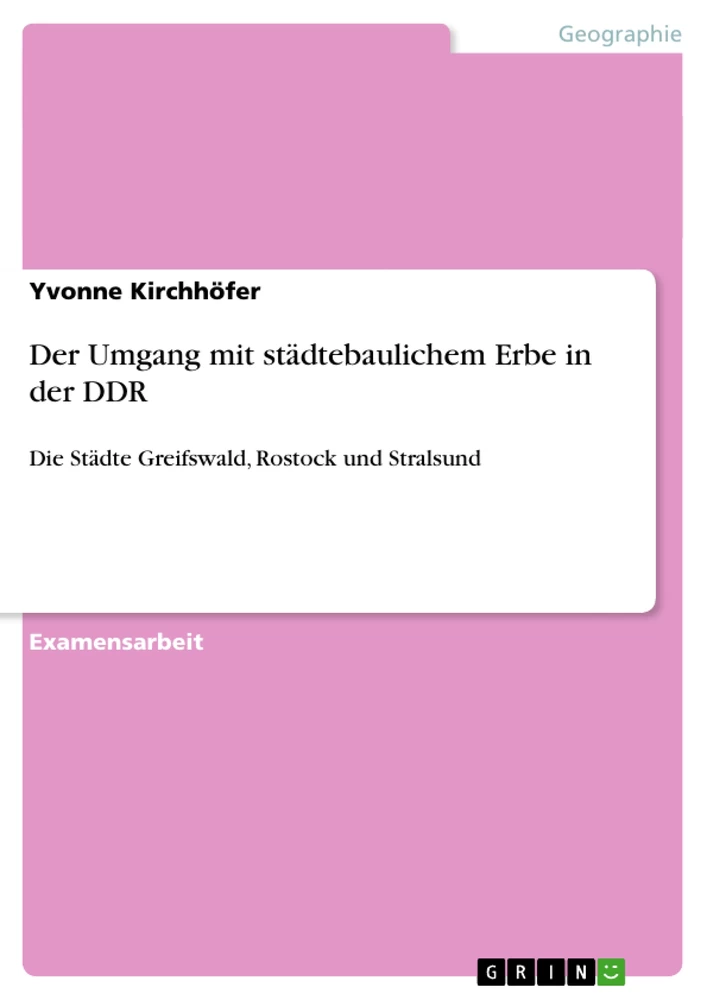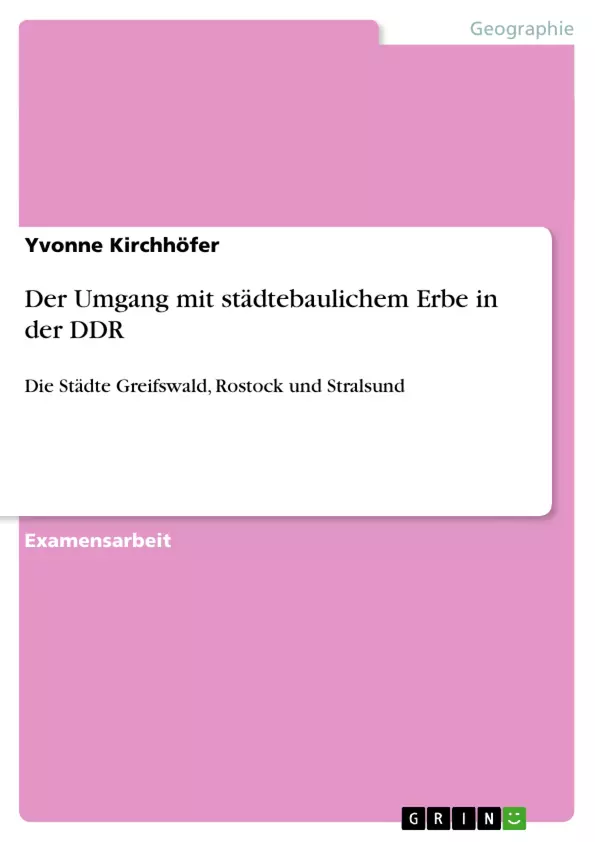Weltweit gibt es in vielen Städten bedeutende historische Gebäude, welche als Wahrzeichen der jeweiligen Städte gelten, einen hohen Bekanntheitsgrad aufweisen, Touristen in die Städte locken und eine Identifikation der Bürger mit »ihrer Stadt« schaffen. Neben diesen Wahrzeichen sind aber auch beispielsweise die verwinkelten Gassen einer Altstadt, alte Marktplätze, Rat- und Bürgerhäuser Zeugnisse vergangener Zeiten und gehören zum städtebaulichen Erbe einer Stadt. Anhand von diesem kann man häufig viele Facetten der geschichtlichen Entwicklung von Städten und damit auch der jeweiligen Gesellschaft und des gesamten Staates nachvollziehen. Denn der Kulturraum Stadt ist einem ständigen Wandel unterzogen und wird im Laufe der Zeit von unterschiedlichen Akteuren gestaltet und verändert.
In Deutschland wurden vor allem seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Städte in ihrem inneren Aufbau und ihrem äußeren Erscheinungsbild starken Veränderungen unterzogen. So hält ZEHNER fest, dass „[i]n keiner anderen Epoche [..] Städte derart fundamental umgestaltet, überprägt und erweitert“ (ZEHNER 2001: 13) worden sind, wie seit der Mitte des 20. Jahrhunderts. Dabei sah diese Umgestaltung, Überprägung und Erweiterung in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) infolge der verschiedenen ideologischen Systeme und politischen Situationen jeweils anders aus, da das Raumgefüge Stadt von beiden deutschen Staaten unterschiedlich bewertet und behandelt wurde.
In dieser Arbeit soll es nun darum gehen herauszustellen, wie speziell in der ehemaligen DDR Städte gestaltet und verändert wurden und wie dort mit städtebaulichem Erbe umgegangen wurde. Dabei sind auch die Jahre der sowjetischen Besatzungszeit in die Betrachtung mit eingeschlossen, so dass im Gesamten der Zeitraum zwischen 1945 und 1990 untersucht wird.
Der Umgang mit städtebaulichem Erbe in der DDR wird anhand von drei Fallstudienstädten untersucht, so dass die Gefahr der Einseitigkeit, die eine Betrachtung von nur einer Stadt vermutlich mit sich gebracht hätte, ausgeschlossen wird. Untersucht werden die Städte Greifswald, Rostock und Stralsund. Die Betrachtung einer größeren Anzahl von Städten ist im Rahmen dieser Arbeit leider nicht möglich.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff »Städtebauliches Erbe«
- Kurzer Abriss der Geschichte und Stadtentwicklung der Fallstudienstädte Greifswald, Rostock und Stralsund
- Die Stadt Greifswald bis 1945
- Die Stadt Rostock bis 1945
- Die Stadt Stralsund bis 1945
- Das zentralistisch – gesteuerte System der DDR
- Die SED als Staatspartei
- Zentralismus in der Stadtplanung
- Die Entwicklung der Stadtplanung, des Städtebaus und der städtebaulichen Leitbilder in der SBZ und in der DDR
- 1945 - 1949: Anfänge der Stadtplanung und des Städtebaus in der SBZ - Leitbild der funktionellen Stadt?
- 1950 - 1955: Anknüpfung an nationale Bautraditionen - Leitbild der schönen kompakten Stadt
- 1955 – 1960: Industrialisierung des Bauwesens - Fehlen eines städtebaulichen Leitbildes
- 1961 – 1971: Industrialisierung des Bauwesens ― Leitbild der kompakten Stadt mit sozialistischen Dominanten
- 1971 - 1981: Lösung der Wohnungsfrage - Leitbild des extensiven Städtebaus
- 1981 – 1990: Senkung des Bauaufwandes und Rückbesinnung auf die Altbausubstanz – Leitbild der intensiven Stadtentwicklung
- Der Umgang mit städtebaulichem Erbe in Greifswald zwischen 1945 und 1990
- Der Umgang mit städtebaulichem Erbe in Greifswald zwischen 1945 und 1949
- Der Umgang mit städtebaulichem Erbe in Greifswald zwischen 1950 und 1955
- Der Umgang mit städtebaulichem Erbe in Greifswald zwischen 1955 und 1960
- Der Umgang mit städtebaulichem Erbe in Greifswald zwischen 1961 und 1971
- Der Umgang mit städtebaulichem Erbe in Greifswald zwischen 1971 und 1981
- Der Umgang mit städtebaulichem Erbe in Greifswald zwischen 1981 und 1990
- Der Umgang mit städtebaulichem Erbe in Rostock zwischen 1945 und 1990
- Der Umgang mit städtebaulichem Erbe in Rostock zwischen 1945 und 1949
- Der Umgang mit städtebaulichem Erbe in Rostock zwischen 1950 und 1955
- Der Umgang mit städtebaulichem Erbe in Rostock zwischen 1955 und 1960
- Der Umgang mit städtebaulichem Erbe in Rostock zwischen 1961 und 1971
- Der Umgang mit städtebaulichem Erbe in Rostock zwischen 1971 und 1981
- Der Umgang mit städtebaulichem Erbe in Rostock zwischen 1981 und 1990
- Der Umgang mit städtebaulichem Erbe in Stralsund zwischen 1945 und 1990
- Der Umgang mit städtebaulichem Erbe in Stralsund zwischen 1945 und 1949
- Der Umgang mit städtebaulichem Erbe in Stralsund zwischen 1950 und 1955
- Der Umgang mit städtebaulichem Erbe in Stralsund zwischen 1955 und 1960
- Der Umgang mit städtebaulichem Erbe in Stralsund zwischen 1961 und 1971
- Der Umgang mit städtebaulichem Erbe in Stralsund zwischen 1971 und 1981
- Der Umgang mit städtebaulichem Erbe in Stralsund zwischen 1981 und 1990
- Zusammenfassende Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Gestaltung und Veränderung von Städten in der ehemaligen DDR sowie mit dem Umgang mit städtebaulichem Erbe in diesem Kontext. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Entwicklungen zwischen 1945 und 1990, einschließlich der sowjetischen Besatzungszeit. Die Arbeit untersucht anhand von Fallstudien in den Städten Greifswald, Rostock und Stralsund, wie städtebauliches Erbe in der DDR genutzt, verändert oder gar zerstört wurde. Die wichtigsten Themenschwerpunkte sind:- Die Entwicklung des städtebaulichen Denkens und Planens in der DDR
- Die Rolle des zentralistischen Systems der DDR in der Stadtentwicklung
- Der Einfluss politischer und ideologischer Vorgaben auf die Gestaltung des städtischen Raumes
- Die Auseinandersetzung mit städtebaulichem Erbe in den Fallstudienstädten
- Die unterschiedlichen Phasen der Entwicklung des Umgangs mit städtebaulichem Erbe in der DDR
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas »Umgang mit städtebaulichem Erbe in der DDR« heraus und skizziert die Forschungsfrage sowie den methodischen Ansatz der Arbeit. Das zweite Kapitel erläutert den Begriff »Städtebauliches Erbe« und zeigt dessen Bedeutung für die Identitätsbildung von Städten auf. Die Kapitel 3.1 bis 3.3 geben jeweils einen kurzen Abriss der Geschichte und Stadtentwicklung der drei Fallstudienstädte Greifswald, Rostock und Stralsund bis 1945. Diese Kapitel dienen als Grundlage für die spätere Analyse des Umgangs mit städtebaulichem Erbe in der DDR. Kapitel 4 beleuchtet das zentralistisch gesteuerte System der DDR mit der SED als Staatspartei und die Auswirkungen auf die Stadtplanung. Kapitel 5 analysiert die Entwicklung der Stadtplanung, des Städtebaus und der städtebaulichen Leitbilder in der SBZ und der DDR. Es werden die verschiedenen Phasen von 1945 bis 1990 betrachtet und die jeweils dominierenden Leitbilder beschrieben. Die Kapitel 6 bis 8 befassen sich mit dem Umgang mit städtebaulichem Erbe in den drei Fallstudienstädten Greifswald, Rostock und Stralsund zwischen 1945 und 1990. Die einzelnen Kapitel betrachten die verschiedenen Zeitabschnitte und analysieren die spezifischen Herausforderungen und Strategien im Umgang mit dem städtebaulichen Erbe.Schlüsselwörter
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema »Städtebauliches Erbe« im Kontext der DDR und der damit einhergehenden Herausforderungen und Entwicklungen. Schlüsselbegriffe sind: Stadtentwicklung, DDR, Stadtplanung, städtebauliches Erbe, Zentralismus, SED, Leitbilder, Fallstudien, Greifswald, Rostock, Stralsund, 1945-1990.Häufig gestellte Fragen
Was umfasst der Begriff „städtebauliches Erbe“?
Dazu gehören historische Wahrzeichen, Altstadtgassen, alte Marktplätze sowie Rat- und Bürgerhäuser, die als Zeugnisse vergangener Epochen die Identität einer Stadt prägen.
Welche Städte wurden als Fallstudien untersucht?
Die Untersuchung konzentriert sich auf die Städte Greifswald, Rostock und Stralsund im Zeitraum von 1945 bis 1990.
Welchen Einfluss hatte die SED auf die Stadtplanung?
Die SED steuerte die Stadtplanung zentralistisch und ideologisch, wobei das Leitbild der „sozialistischen Stadt“ oft über den Erhalt historischer Bausubstanz gestellt wurde.
Wie veränderte sich die Stadtplanung in der DDR über die Jahrzehnte?
Die Phasen reichten von der Anknüpfung an nationale Traditionen (1950er) über die Industrialisierung des Bauwesens bis hin zur Rückbesinnung auf die Altbausubstanz in den 1980er Jahren.
Was war das Ziel der Stadtentwicklung in den 1970er Jahren?
In den 1970er Jahren stand die Lösung der Wohnungsfrage durch extensiven Städtebau und Großwohnsiedlungen im Vordergrund.
- Quote paper
- Yvonne Kirchhöfer (Author), 2007, Der Umgang mit städtebaulichem Erbe in der DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91721