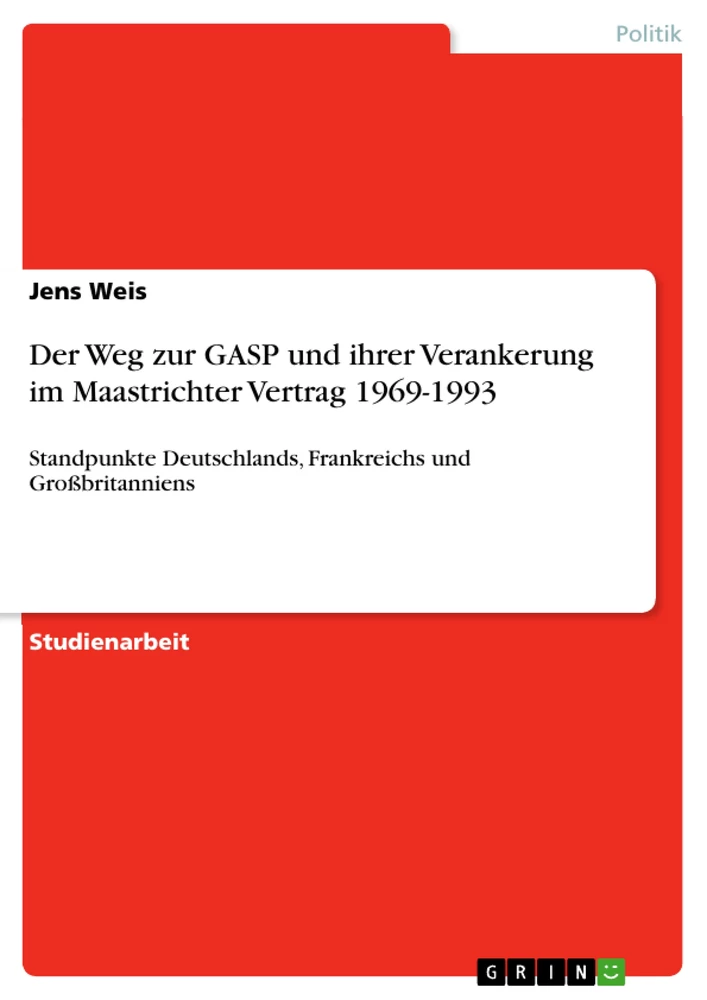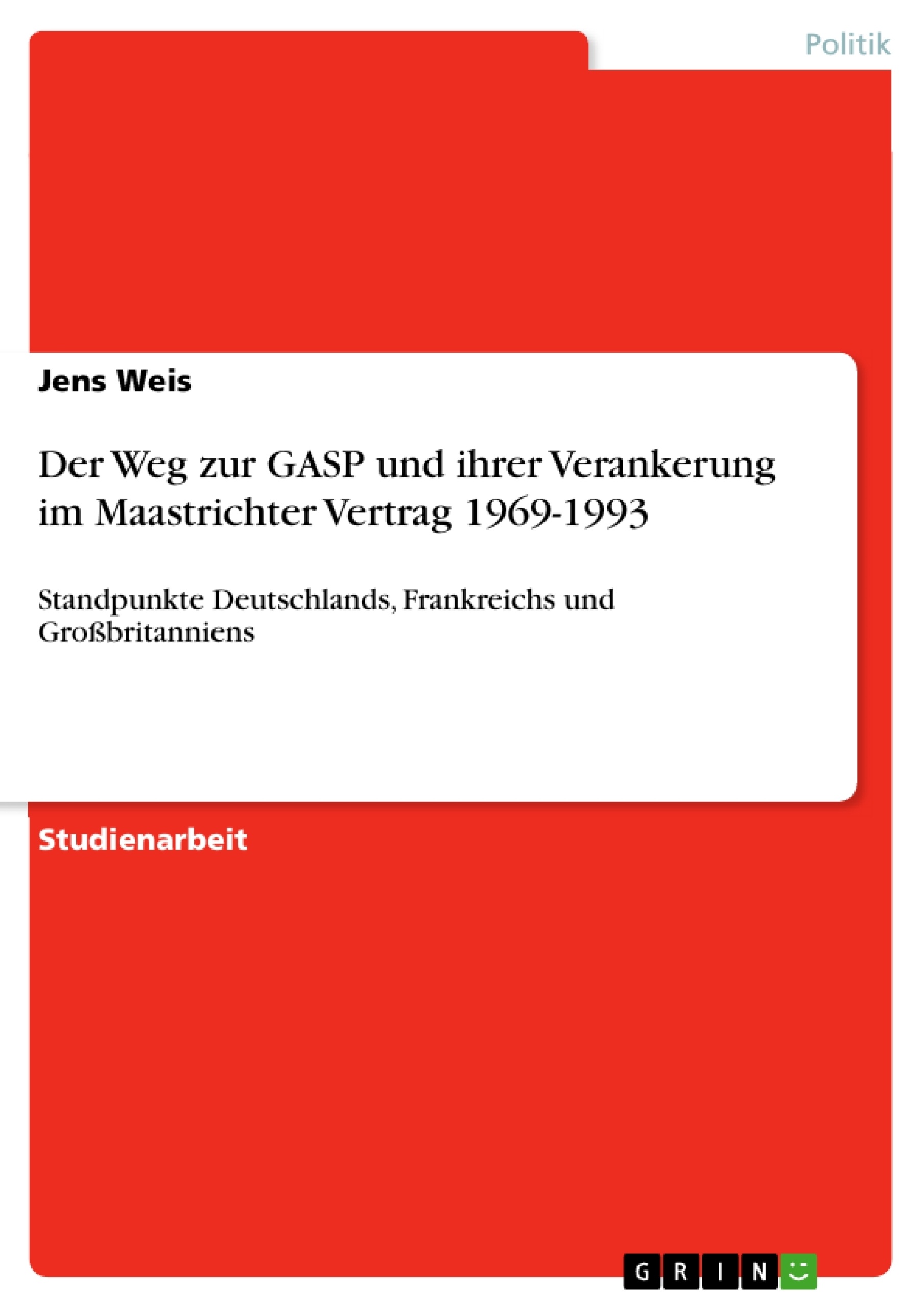Das Zusammenwachsen Europas bildet den integralen Bestandteil für die nächsten Generationen. Der europäische Gedanke scheint, so er in allen Bereichen Europas umgesetzt werden kann, die Kraft für eine wirtschaftliche sowie politische Einheit und eine gemeinsame Bewältigung bzw. Überwindung von Konflikten zu besitzen. Diesem Vorsatz stehen allerdings weitreichende, ungelöste Problemfelder gegenüber, die dieses Ziel höchst visionär anmuten lassen. Regionale Unruhen, Minderheitenkonflikte, ungleiche Ressourcenverteilung, Nationalismus, Macht- und Eliteninteressen, um nur einige davon zu nennen, sind längst nicht überwunden und bedürfen der Lösung. Dem Integrationsprozess Westeuropas, als einem Musterbeispiel zukünftigem Zusammenwachsens Europas, stehen vor allem Desintegrationsbestrebungen und Nationalitätenprobleme Osteuropas entgegen.
Mit welchen Mitteln versucht Europa auf diese Entwicklungen zu reagieren, welche Verfahren aus dem bisherigen Integrationsprozess wurden entwickelt und erweitert, um auf die außen- und sicherheitspolitischen Fragen Europas eine Antwort zu geben und welche Probleme sind dabei zu überwinden? Welche Positionen trafen und treffen immer noch aufeinander?
In dieser Arbeit soll versucht werden einen in den nächsten Jahren wohl zunehmend bedeutender werdenden Aspekt der europäischen Zusammenarbeit im Überblick zu schildern – den Weg zu einer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). Ein so weitreichendes Thema wird in diesem Rahmen nicht erschöpfend abgehandelt werden können. Im Folgenden wird die Entwicklung der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ) und die Fortführung der EPZ als GASP 1969-1993 Gegenstand der Betrachtungen sein. Dabei soll die institutionelle Entwicklung der EPZ zur GASP skizziert und die Standpunkte Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens, als ausgewählte Mitgliedsstaaten, während der Verhandlungen zur Politischen Union erläutert werden. Vorangestellt wird ein kurzer Abriss zu den Anfängen des Integrationsprozesses nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Grundeinstellungen der Mitgliedsstaaten sind teilweise bis heute unverändert und daher nicht nur für die damaligen Bemühungen wichtig, sondern liefern auch das Verständnis für heutige Positionen. In dieser Entwicklung ist immer wieder das zögerliche Ringen um eine umfassende gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ersichtlich. Es zeigt sich, dass die Defizite und Probleme der EPZ auch mit Maastricht nur unzureichend gelöst wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Integrationsbestrebungen nach dem Zweiten Weltkrieg
- Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ)
- Luxemburger Bericht
- Kopenhagener Bericht
- Tindeman- Bericht
- Londoner Bericht
- Einheitliche Europäische Akte (EEA)
- Bilanz der EPZ
- Regierungskonferenzen und Standpunkte zur politischen Union
- Deutschland
- Frankreich
- Großbritannien
- Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)
- Ziele
- Probleme
- Bilanz
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) innerhalb der Europäischen Union. Sie analysiert den Weg von der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ) zur GASP im Zeitraum von 1969 bis 1993, wobei sie insbesondere die Standpunkte Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens während der Verhandlungen zur Politischen Union beleuchtet. Zudem soll die Arbeit einen kurzen Abriss zu den Anfängen des Integrationsprozesses nach dem Zweiten Weltkrieg bieten, um das Verständnis für die späteren Positionen der Mitgliedsstaaten zu ermöglichen.
- Die Entwicklung der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ)
- Die Fortführung der EPZ als GASP
- Die institutionelle Entwicklung der EPZ zur GASP
- Die Standpunkte Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens während der Verhandlungen zur Politischen Union
- Die Schwierigkeiten bei der Etablierung einer umfassenden gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit, die Entwicklung der GASP, vor und skizziert die wichtigsten Ziele und Schwerpunkte. Sie beleuchtet zudem die Herausforderungen, die dem Integrationsprozess Europas und der Etablierung einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik entgegenstehen.
- Kapitel 2 bietet einen kurzen Überblick über die Anfänge des Integrationsprozesses in den fünfziger Jahren, die Gründung der EGKS und die gescheiterten Pläne für eine Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) und eine Europäische Politische Gemeinschaft (EPG).
- Kapitel 3 beschreibt die Entstehung und Entwicklung der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ) ab 1969. Es erläutert die verschiedenen Phasen der EPZ, von den ersten Berichten bis hin zur Einheitlichen Europäischen Akte (EEA), und beleuchtet die verschiedenen Positionen der Mitgliedsstaaten.
- Kapitel 4 analysiert die Standpunkte Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens während der Verhandlungen zur Politischen Union in den 1990er Jahren.
- Kapitel 5 behandelt die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), ihre Ziele, Probleme und ihre Bilanz.
Schlüsselwörter
Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ), Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), Europäische Integration, Europäische Union, Maastricht-Vertrag, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik, Integrationsprozess, Politikwissenschaft, Internationale Politik.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die Abkürzung GASP?
GASP steht für Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union.
Welchen Zeitraum deckt die Arbeit ab?
Die Arbeit analysiert die Entwicklung von 1969 (Beginn der EPZ) bis zur Verankerung im Maastrichter Vertrag 1993.
Was war die EPZ?
Die Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ) war der informelle Vorläufer der GASP zur Koordinierung der Außenpolitik der EG-Mitgliedstaaten.
Welche Länderpositionen werden in der Arbeit besonders verglichen?
Es werden die Standpunkte von Deutschland, Frankreich und Großbritannien während der Verhandlungen zur Politischen Union erläutert.
Warum scheiterten frühere Pläne wie die EVG?
Frühe Pläne für eine Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) scheiterten oft an nationalen Souveränitätsbedenken, insbesondere in Frankreich.
Welche Probleme blieben auch nach dem Vertrag von Maastricht ungelöst?
Defizite bei der Entscheidungsfindung (Einstimmigkeitsprinzip) und das Ringen um eine wirklich umfassende gemeinsame Verteidigungspolitik blieben bestehen.
- Quote paper
- Magister Artium Jens Weis (Author), 2003, Der Weg zur GASP und ihrer Verankerung im Maastrichter Vertrag 1969-1993, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91758