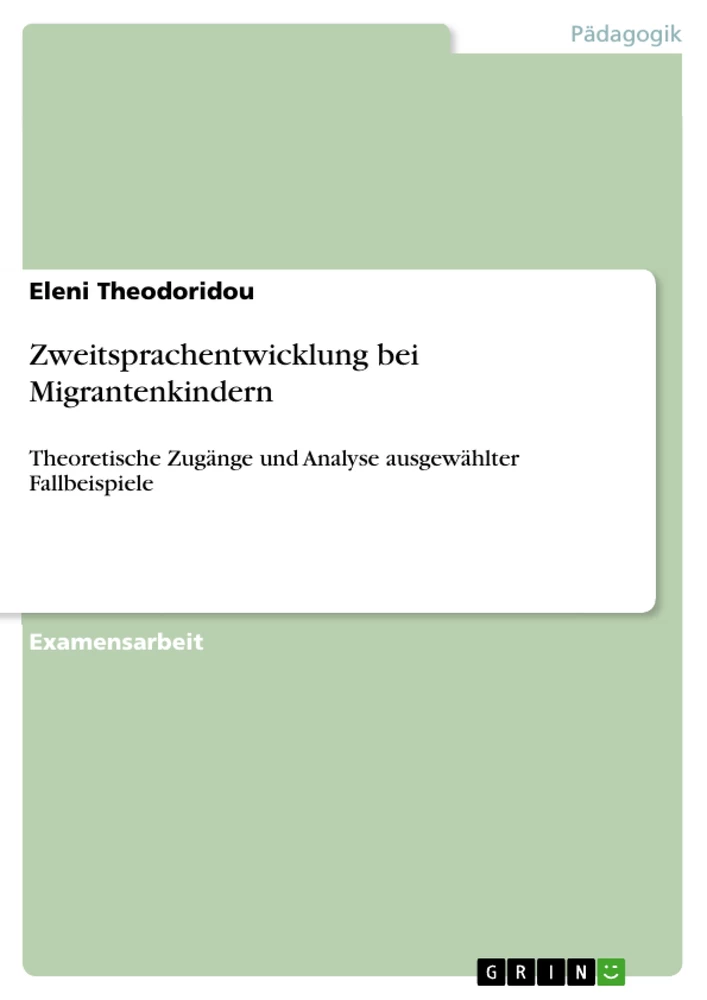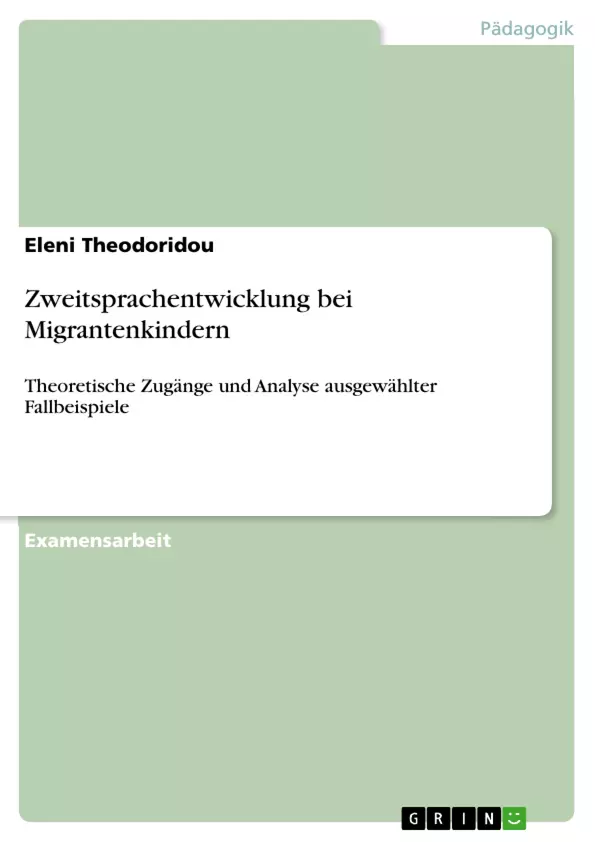Der internationale Schulleistungsvergleich PISA (‚Programme for International Student Assessment’) im Jahr 2000 entfachte die Diskussion um die (sprachliche) Bildung der Migrantenschülerinnen und -schüler in der Bundesrepublik Deutschland. Die Ergebnisse der PISA-Studie sind –vor allem im Bereich der Lesekompetenz– Besorgnis erregend und rückten die gesellschaftliche Entwicklung mit der steigenden Zahl von zwei- und mehrsprachig aufwachsenden Kindern und deren Schwierigkeiten in deutschen Bildungseinrichtungen ins öffentliche Bewusstsein.
Eine bedeutende Konsequenz der Schulleistungsuntersuchungen der letzten Jahre (PISA, IGLU) besteht, neben den Neuerungen im Primarbereich (Offene Ganztagsschule und Neue Schuleingangsphase), in der Sprachförderung von Migrantenkindern, die im Elementarbereich beginnt und in die Primarstufe übergeht. Seitdem entwickeln alle Bundesländer Verfahren zur Sprachstandserfassung, die bei Migrantenkindern im Übergang vom Elementar- zum Primarbereich angewendet werden, und Modelle zur Förderung zwei- bzw. mehrsprachiger Kinder.
Bei der Entwicklung solcher Verfahren und Modelle müssen Aspekte der Sprach- und Zweitsprachenerwerbsforschung, der Kinderforschung und auch der Sprachheildiagnostik berücksichtigt werden. Da vergleichbare Industrieländer in diesem Gebiet schon weiter fortgeschritten sind, kann sich die deutsche Forschung an deren Erkenntnisse orientieren.
Immer mehr Untersuchungen bestätigen beispielsweise die Bedeutung der Erstsprache für den Zweitspracherwerb, so dass Sprachstandserhebungen auch den Entwicklungsstand der Erstsprache in Betracht ziehen sollten und Sprachförderprogramme nicht den Kindern ihre Erstsprache verbieten, sondern diese in das Programm integrieren und auch die Erstsprache fördern sollten. Auf diese Weise werden größere Erfolge in beiden Sprachen erzielt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Spracherwerb
- 2.1 Voraussetzungen für den Spracherwerb
- 2.2 Vorstufen des Spracherwerbs
- 2.3 Stadien des Spracherwerbs
- 3. Zweitsprachentwicklung bei Migrantenkindern
- 3.1 Einflüsse auf die Entwicklung der Zweitsprache
- 3.1.1 Alter des Kindes und Art des Zweitspracherwerbs
- 3.1.2 Einfluss der Familie
- 3.1.3 Lesesozialisation in der Familie
- 3.1.4 Literacy-Erziehung in Kindertagesstätten
- 3.1.5 Einfluss der Schule und der Peers
- 3.1.6 Die Bedeutung der Erstsprache
- 3.2 Der Zweitspracherwerb
- 3.2.1 Das Lautsystem der Zweitsprache
- 3.2.2 Aktivität und Kreativität des Kindes
- 3.2.3 Vorwissen durch die Erstsprache
- 3.2.4 Der Satzbau
- 3.2.5 Strategien zur Vereinfachung
- 3.2.6 Der Wortschatz
- 3.3 Zweisprachige Erziehung
- 3.3.1, Eine Sprache/eine Person'-Theorie
- 3.3.2 Sprachmischung
- 3.3.2.1 Interferenz
- 3.3.2.2 Code-Wechsel und Code-mixing
- 3.3.2.3 Fazit: Sprachmischungen
- 3.3.3 Mögliche Konflikte in der Familie
- 3.3.4 Zweisprachigkeit und Schulerfolg
- 3.3.4.1,BICS' und,CALP'
- 4. Schulpolitik
- 4.1 Schulpolitik der letzten Jahrzehnte
- 4.2 Schulmodelle für zweisprachige Kinder
- 4.2.1 Einsprachige Modelle
- 4.2.2 Zweisprachige Modelle
- 4.2.3 Schulorganisatorische Maßnahmen und ihre Evaluation
- 4.3 Richtlinien, Lehrpläne und Empfehlungen
- 5. Sprachstanderhebungsverfahren
- 5.1 Qualität von Verfahren zur Sprachstandserfassung
- 5.2 Vier Ansätze zur Sprachstandsdiagnose
- 5.3 Spezielle Sprachstanderhebungsverfahren
- 5.3.1 HAVAS
- 5.3.2 CITO
- 5.3.3 SISMIK
- 6. Analyse ausgewählter Fallbeispiele
- 6.1 Erstes Fallbeispiel-Paar: F. und M.
- 6.1.1 Fallbeispiel F.
- 6.1.1.1 Quantitative Auswertung des SISMIK-Bogens
- 6.1.2 Fallbeispiel 3M
- 6.1.2.1 Quantitative Auswertung des SISMIK-Bogens
- 6.1.3 F. und M.: Fazit
- 6.1.1 Fallbeispiel F.
- 6.2 Zweites Fallbeispiel-Paar: K. und S.
- 6.2.1 Fallbeispiel K.
- 6.2.1.1 Quantitative Auswertung des SISMIK-Bogens
- 6.2.2 Fallbeispiel S.
- 6.2.2.1 Quantitative Auswertung des SISMIK-Bogens
- 6.2.3 K. und S.: Fazit
- 6.2.1 Fallbeispiel K.
- 6.1 Erstes Fallbeispiel-Paar: F. und M.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Zweitsprachentwicklung bei Migrantenkindern. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen des Spracherwerbs und der Zweitsprachentwicklung zu beleuchten und anhand von Fallbeispielen die Entwicklung der Zweitsprache bei Kindern mit Migrationshintergrund zu analysieren.
- Einflüsse auf die Zweitsprachentwicklung
- Aspekte des Zweitspracherwerbs
- Zweisprachige Erziehung
- Schulpolitik und Sprachförderung
- Sprachstanderhebungsverfahren
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 legt den Grundstein der Arbeit mit einer Einleitung, die die aktuelle Diskussion um die Sprachförderung von Migrantenkindern in Deutschland beleuchtet. Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Spracherwerb im Allgemeinen, beleuchtet Voraussetzungen und Phasen des Spracherwerbs. Kapitel 3 befasst sich mit der Zweitsprachentwicklung bei Migrantenkindern und betrachtet Einflüsse, den Prozess des Zweitspracherwerbs, die zweisprachige Erziehung und mögliche Konflikte sowie den Zusammenhang zwischen Zweisprachigkeit und Schulerfolg. Kapitel 4 beleuchtet die Schulpolitik der letzten Jahrzehnte, verschiedene Schulmodelle für zweisprachige Kinder und wichtige Richtlinien sowie Empfehlungen. Kapitel 5 geht auf Sprachstanderhebungsverfahren ein, analysiert deren Qualität, verschiedene Ansätze zur Sprachstandsdiagnose und stellt spezielle Verfahren vor. Kapitel 6 präsentiert zwei Fallbeispiele von Migrantenkindern, die anhand des SISMIK-Bogens und weiteren Beobachtungsbögen analysiert werden.
Schlüsselwörter
Zweitsprachentwicklung, Migrantenkinder, Spracherwerb, Sprachförderung, Schulpolitik, Sprachstandserhebungsverfahren, SISMIK, Fallbeispiele
Häufig gestellte Fragen
Wie wichtig ist die Erstsprache für den Erwerb des Deutschen?
Untersuchungen zeigen, dass eine gut entwickelte Erstsprache das Fundament für einen erfolgreichen Zweitspracherwerb bildet.
Was ist der SISMIK-Bogen?
SISMIK ist ein Beobachtungsbogen zur Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen.
Was versteht man unter "Code-Wechsel" (Code-switching)?
Damit ist das fließende Wechseln zwischen zwei Sprachen innerhalb eines Gesprächs gemeint, was oft ein Zeichen für hohe sprachliche Kompetenz ist.
Welche Schulmodelle gibt es für zweisprachige Kinder?
Es wird zwischen einsprachigen (immersiven) und zweisprachigen Modellen unterschieden, die beide Sprachen in den Unterricht integrieren.
Was bedeutet Literacy-Erziehung?
Literacy umfasst Erfahrungen rund um die Buch-, Erzähl- und Schriftkultur, die bereits im Kindergartenalter beginnen sollten.
- 3.1 Einflüsse auf die Entwicklung der Zweitsprache
- Citation du texte
- Eleni Theodoridou (Auteur), 2005, Zweitsprachentwicklung bei Migrantenkindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91862