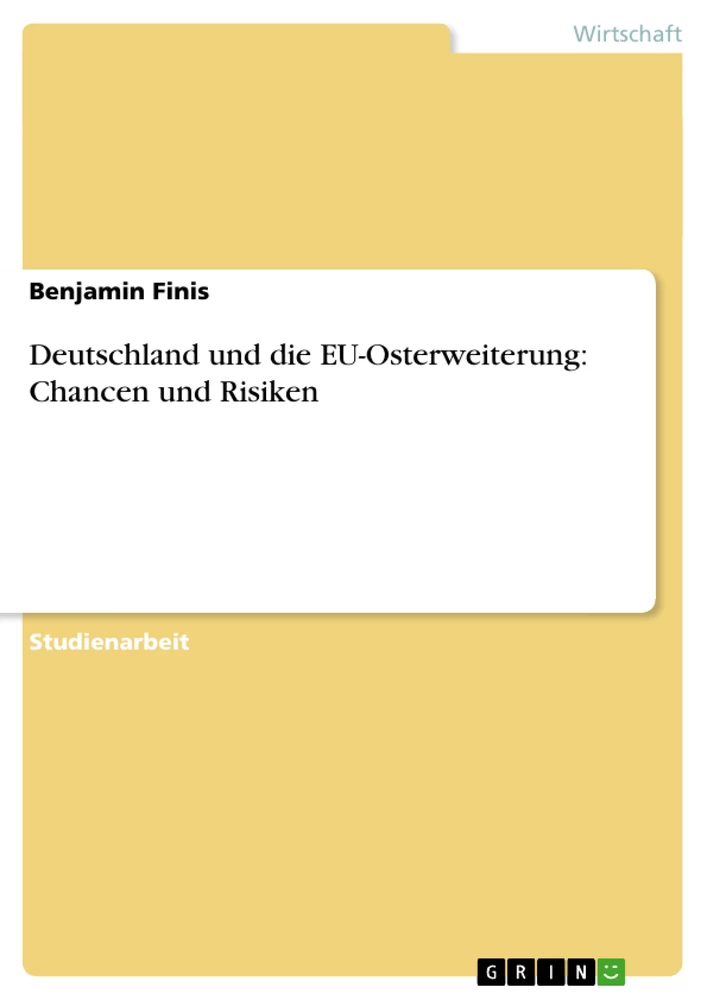Die EU-Osterweiterung am 01. Mai 2004, bei der gleich zehn neue Länder in die Europäische Union (EU) aufgenommen wurden, hat die Europäische Staatengemeinschaft vor große Herausforderungen gestellt und gleichzeitig mit vielen Entwicklungschancen ausgestattet. In zahlreichen Kommentaren in Europa wurde die Erweiterung als historische Chance gesehen, den europäischen Kontinent wiederzuvereinigen und damit eine dauerhafte Sicherung von Frieden und Stabilität zu gewährleisten (vgl. Landtag von Baden-Württemberg, Drucksache 14/228, S. 2). Gleichzeitig gab und gibt es aber auch eine große Skepsis gegenüber den neuen Mitgliedsländern, die sich durch weite Teile der deutschen Bevölkerung erstreckt (vgl. Europa digital, 22.04.07).
In meiner Seminararbeit will ich die Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf die Bundesrepublik Deutschland betrachten, Chancen und Risiken gegeneinander abwägen und einen Ausblick wagen, wie auf die Entwicklungen der EU-Osterweiterung nachhaltig reagiert werden sollte.
Ich verstehe unter der ›EU-Osterweiterung‹ den Beitritt der zehn neuen Mitgliedsstaaten am 01. Mai 2004 – den Beitritt von Bulgarien und Rumänien zum 01. Januar 2007 werde ich in der Seminararbeit nicht explizit berücksichtigen, da die grundlegenden Wirkungsketten und die für Deutschland relevanten Veränderungen bereits im Mai 2004 ausgelöst wurden. Bevor ich auf die Situation der Bundesrepublik Deutschland eingehe, möchte ich einen kurzen Abriss über die historische Entwicklung des europäischen Einigungsprozesses und der Osterweiterung geben. Als am 25. März 1957 sechs Länder in Rom den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG-Vertrag) unterzeichneten, war noch nicht abzusehen, dass dieser Vertrag den Startpunkt für einen dynamischen Annäherungs- und Einigungsprozess darstellen sollte. In den Folgejahren und -jahrzehnten wurde eine Erweiterungsrunde nach der anderen durchgeführt, so dass die Gemeinschaft bis 1995 auf 15 Mitglieder anwuchs.
Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1989/90 bemühten sich zudem viele ehemalige Sowjet-Staaten intensiv um eine Annäherung an die EU und in langwierigen Verhandlungen und durch zahlreiche Reformprozesse in ihrem eigenen Land signalisierten sie ihre Beitrittsbereitschaft. Anhand der ›Kopenhagener Kriterien‹ wurden die Beitrittskandidaten auf ihre Aufnahmefähigkeit überprüft.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung, Problemstellung und Zielsetzung
- 2. Hintergrund der EU-Osterweiterung
- 2.1. Die historische Entwicklung der Osterweiterung
- 2.2. Rückblick: Die Stimmungslage in Deutschland vor dem Beitritt
- 3. Chancen und Risiken
- 3.1. Die Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt
- 3.1.1. Der reglementierte Arbeitsmarktzugang und seine Auswirkungen
- 3.1.2. Die Entwicklung der Beschäftigung und mögliche Arbeitslosigkeit
- 3.1.3. Direktinvestitionen in den neuen Mitgliedsstaaten
- 3.2. Der verschärfte internationale Steuerwettbewerb
- 3.3. Migration
- 3.3.1. Effekte der Zuwanderung auf Wachstum, Löhne und Beschäftigung
- 3.3.2. Effekte der Zuwanderung für den Sozialstaat
- 3.4. Innere Sicherheit
- 3.5. Handel
- 3.5.1. Die Entwicklung des Außenhandels
- 3.5.2. Sonderfall Baden-Württemberg
- 3.6. Die Gefährdung der Entwicklung Ostdeutschlands
- 3.7. Finanzielle Belastungen
- 3.7.1. Der Strukturfonds
- 3.7.2. Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)
- 3.1. Die Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt
- 4. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf die Bundesrepublik Deutschland, indem sie Chancen und Risiken gegeneinander abwägt und einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung und die Reaktion Deutschlands auf diese Entwicklungen bietet. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die Auswirkungen der EU-Osterweiterung im Mai 2004, wobei der Beitritt von Bulgarien und Rumänien im Januar 2007 nicht explizit behandelt wird, da die wesentlichen Veränderungen bereits im Mai 2004 einsetzten.
- Die Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf den deutschen Arbeitsmarkt
- Die Chancen und Risiken des verschärften internationalen Steuerwettbewerbs
- Die Auswirkungen der Migration auf die deutsche Wirtschaft und den Sozialstaat
- Die Folgen der EU-Osterweiterung für die innere Sicherheit Deutschlands
- Die Auswirkungen auf den deutschen Außenhandel und die Entwicklung Ostdeutschlands
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung, Problemstellung und Zielsetzung
Die EU-Osterweiterung am 1. Mai 2004 stellte die Europäische Staatengemeinschaft vor große Herausforderungen und Chancen. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen dieser Erweiterung auf Deutschland, insbesondere die Chancen und Risiken, die sie für die Bundesrepublik mit sich bringt.2. Hintergrund der EU-Osterweiterung
Das Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der EU-Osterweiterung und die Stimmungslage in Deutschland vor dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten.2.1. Die historische Entwicklung der Osterweiterung
Der Abschnitt beschreibt die Erweiterungsschritte der EU seit ihrer Gründung im Jahr 1957 und führt die Kopenhagener Kriterien ein, die zur Überprüfung der Beitrittskandidaten dienen.2.2. Rückblick: Die Stimmungslage in Deutschland vor dem Beitritt
Dieses Kapitel stellt die unterschiedlichen Meinungen und Befürchtungen der deutschen Bevölkerung vor dem Beitritt der neuen Länder dar.3. Chancen und Risiken
Dieser Abschnitt befasst sich mit den konkreten Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf Deutschland.3.1. Die Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt
Das Kapitel analysiert die Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf den deutschen Arbeitsmarkt, einschließlich des reglementierten Arbeitsmarktzugangs, der Beschäftigungsentwicklung und der Direktinvestitionen in den neuen Mitgliedsstaaten.3.2. Der verschärfte internationale Steuerwettbewerb
Dieser Abschnitt beleuchtet die Auswirkungen des Beitritts der neuen Länder auf den internationalen Steuerwettbewerb.3.3. Migration
Das Kapitel untersucht die Auswirkungen der Zuwanderung aus den neuen Mitgliedsstaaten auf Wachstum, Löhne, Beschäftigung und den Sozialstaat in Deutschland.3.4. Innere Sicherheit
Dieser Abschnitt thematisiert die Folgen der EU-Osterweiterung für die innere Sicherheit Deutschlands.3.5. Handel
Das Kapitel beleuchtet die Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf den deutschen Außenhandel und befasst sich mit dem Sonderfall Baden-Württemberg.3.6. Die Gefährdung der Entwicklung Ostdeutschlands
Dieser Abschnitt diskutiert die Risiken, die die EU-Osterweiterung für die Entwicklung Ostdeutschlands mit sich bringt.3.7. Finanzielle Belastungen
Das Kapitel analysiert die finanziellen Belastungen, die der EU durch die Osterweiterung entstanden sind, insbesondere im Zusammenhang mit dem Strukturfonds und der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP).Schlüsselwörter
Die Seminararbeit konzentriert sich auf die EU-Osterweiterung und ihre Auswirkungen auf Deutschland. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: EU-Osterweiterung, Chancen und Risiken, Arbeitsmarkt, Steuerwettbewerb, Migration, Innere Sicherheit, Handel, Ostdeutschland, Finanzielle Belastungen, Strukturfonds, Gemeinsame Agrarpolitik (GAP).Häufig gestellte Fragen
Wann fand die EU-Osterweiterung statt und welche Länder betraf sie?
Die zentrale Erweiterung fand am 1. Mai 2004 statt, als zehn neue Länder (u.a. Polen, Tschechien, Ungarn) der EU beitraten.
Welche Auswirkungen hatte die Erweiterung auf den deutschen Arbeitsmarkt?
Es gab Diskussionen über reglementierten Arbeitsmarktzugang, mögliche Arbeitslosigkeit, aber auch Chancen durch Direktinvestitionen in den neuen Mitgliedsstaaten.
Wie beeinflusst die Migration aus Osteuropa Deutschland?
Die Arbeit untersucht Effekte der Zuwanderung auf das Wirtschaftswachstum, die Löhne, die Beschäftigung sowie die Belastung des Sozialstaats.
Was sind die „Kopenhagener Kriterien“?
Das sind die Voraussetzungen, die Beitrittskandidaten erfüllen müssen, um ihre Aufnahmefähigkeit in die Europäische Union zu beweisen.
Welche finanziellen Belastungen entstanden für die EU und Deutschland?
Besonders die Bereiche Strukturfonds und die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) führten zu erheblichen finanziellen Herausforderungen innerhalb der Gemeinschaft.
- Citar trabajo
- Benjamin Finis (Autor), 2007, Deutschland und die EU-Osterweiterung: Chancen und Risiken, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91913