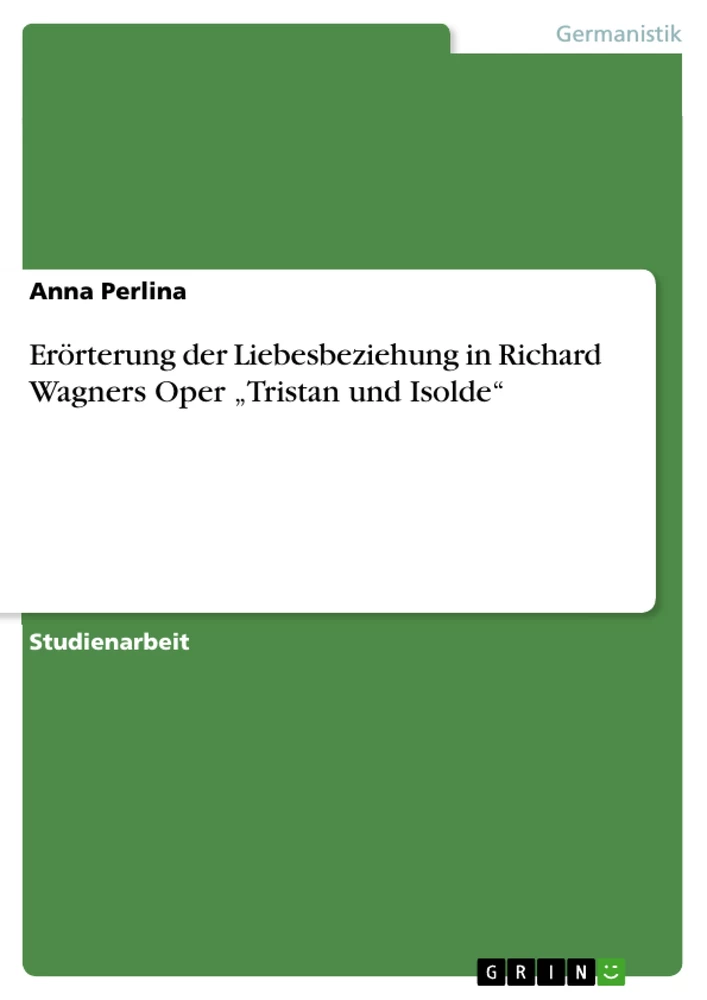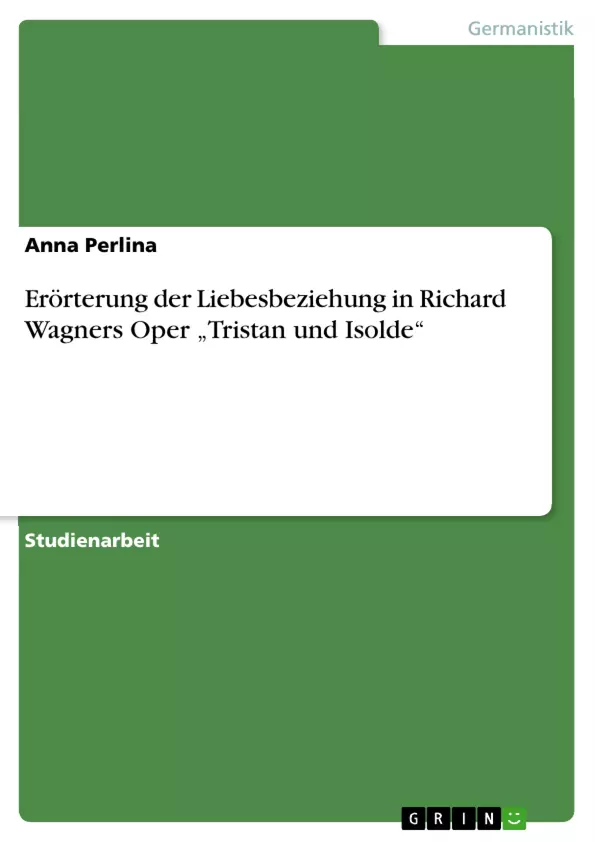Inhalt dieser Arbeit ist die Auseinandersetzung mit Richard Wagners musikalischer Neugestaltung der ergreifenden Liebesgeschichte von Tristan und Isolde. Die Grundlage für sein Opernlibretto schöpfte Wagner aus einer Überlieferung von dem mittelalterli-chen Dichter Gottfried von Strassburg, der seinerseits aus einer keltischen Volkssage die eigene Legende formte.
Bei Gottfried von Strassburg ist die berühmt gewordene Liebesgeschichte das Produkt eines Trankes, den die beiden Königskinder Isolde und Tristan irrtümlich zu sich neh-men. Jenes sexuell anregende Getränk braut die im zaubern kundige Mutter von Isolde, damit ihn die Tochter und ihr alternder Gemahl in ihrer Hochzeitsnacht einnehmen.
Richard Wagner lässt sich von dieser Geschichte inspirieren. Er übernimmt vieles, aber gestaltet im Grunde doch alles neu, legt zudem eine bedeutende philosophische und psychologische Basis seinem Entwurf zugrunde.
Diese Arbeit wird sich daher mit besonderer Aufmerksamkeit jener Tiefe, die der Be-ziehung zwischen Isolde und Tristan zu Grunde liegt, zuwenden. Welche vom Wagner neu eingeführten Elemente finden wir vor? Welche zusätzlichen Einflüsse wirkten sich auf die Opernkomposition aus? Diese und weitere Fragen sind im Folgenden zu beant-worten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil 1: Fremde Stimmen in Wagners Werk
- 1.1 Platon: Symposion
- 1.2 Wagners Buddhismus
- 1.3 Schopenhauer
- Teil 2: Postnatale Prägung Tristans
- 2.1 Figur Tristan in Anlehnung an Heideggers Idee der Geworfenheit
- 2.2 Tristan: Postnatale Traumaursachen
- 2.3 „Bedingung des geschädigten Dritten“ nach Peter Dettmering
- Teil 3: Begegnung und Entgleitung der Eigenkontrolle
- 3.1 Blickkontakt
- 3.2 Prozess der Kontrollaufgabe in Anlehnung an Hofmann
- 3.3 Tristans und Isoldes eigene Realitätsebene
- Teil 4: Liebessehnsucht und Todestrieb
- 4.1 Liebesmotiv und seine Ausprägungen
- 4.2 Zusammenspiel von Liebe und Tod
- 4.3 Novalis: Nachtmotiv und das Sehnen
- 4.4 Entschlüsselung des Todesmotivs
- 4.5 Funktion des Zaubertranks (Motiv: Trank)
- Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Liebesbeziehung in Richard Wagners Oper „Tristan und Isolde“, indem sie die philosophischen und psychologischen Grundlagen der Oper beleuchtet. Sie analysiert, wie Wagner die ursprüngliche Geschichte neu gestaltet und welche Einflüsse seine Komposition prägten. Die musikalische Umsetzung des Librettos wird dabei weitgehend ausgeklammert, der Fokus liegt auf der Tiefe der Beziehung zwischen Tristan und Isolde.
- Einfluss philosophischer Konzepte (Platon, Buddhismus, Schopenhauer) auf Wagners Werk
- Psychologische Analyse der Figuren Tristan und Isolde
- Das Liebesmotiv und seine verschiedenen Ausprägungen
- Das Zusammenspiel von Liebe und Tod
- Die Rolle des Zaubertranks
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit analysiert Richard Wagners „Tristan und Isolde“, indem sie die philosophischen und psychologischen Aspekte der Liebesgeschichte untersucht und Wagners Neugestaltung der ursprünglichen Legende beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Tiefe der Beziehung zwischen Tristan und Isolde und den Einflüssen, die Wagners Komposition prägten. Die musikalische Umsetzung des Librettos wird jedoch nur am Rande betrachtet.
Teil 1: Fremde Stimmen in Wagners Werk: Dieser Teil untersucht die philosophischen Einflüsse auf Wagners Werk. Es wird gezeigt, wie Platon's Vorstellung von der ursprünglichen Einheit des Menschen und die buddhistische Konzeption von Tod und Wiedergeburt Wagners Konzept der Liebe prägten. Der Einfluss von Schopenhauer wird ebenfalls angesprochen, jedoch im Detail nicht weiter ausgeführt.
Teil 2: Postnatale Prägung Tristans: Dieser Abschnitt befasst sich mit der psychologischen Prägung Tristans. Durch die Analyse der Figur Tristan unter dem Blickwinkel der Heideggerschen Idee der Geworfenheit, der postnatale Traumaursachen und der „Bedingung des geschädigten Dritten“ nach Dettmering wird versucht, Tristans Handlungen und sein Verhalten zu erklären.
Teil 3: Begegnung und Entgleitung der Eigenkontrolle: Dieser Teil beleuchtet die Begegnung von Tristan und Isolde und den Prozess des Verlustes der Eigenkontrolle. Der Blickkontakt, der Prozess der Kontrollaufgabe und die von beiden Figuren geschaffene Realitätsebene werden detailliert analysiert.
Teil 4: Liebessehnsucht und Todestrieb: Dieser Abschnitt untersucht das Liebesmotiv und sein Zusammenspiel mit dem Todestrieb. Die verschiedenen Ausprägungen des Liebesmotivs, sowie die Rolle von Novalis’ Nachtmotiv und die Funktion des Zaubertranks werden analysiert, um das komplexe Gefüge von Liebe und Tod in der Oper zu verstehen.
Schlüsselwörter
Richard Wagner, Tristan und Isolde, Liebe, Tod, Platon, Buddhismus, Schopenhauer, Psychologie, Philosophie, Oper, Liebesmotiv, Todestrieb, Zaubertrank, postnatale Prägung, Geworfenheit.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Wagners "Tristan und Isolde"
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit analysiert Richard Wagners Oper "Tristan und Isolde" unter philosophischen und psychologischen Gesichtspunkten. Der Fokus liegt auf der Liebesbeziehung zwischen Tristan und Isolde und den Einflüssen, die Wagners Komposition prägten. Die musikalische Umsetzung wird dabei nur am Rande betrachtet.
Welche philosophischen Einflüsse werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Platon (Symposion), buddhistischen Konzepten von Tod und Wiedergeburt und Schopenhauers Philosophie auf Wagners Werk und deren Auswirkungen auf die Darstellung der Liebe in der Oper.
Welche psychologischen Aspekte werden behandelt?
Die psychologische Analyse konzentriert sich auf Tristan und beleuchtet seine Prägung anhand der Heideggerschen Idee der Geworfenheit, postnatale Traumaursachen und der "Bedingung des geschädigten Dritten" nach Dettmering. Der Prozess des Verlustes der Eigenkontrolle bei Tristan und Isolde und die von ihnen geschaffene Realitätsebene werden ebenfalls untersucht.
Wie wird das Liebesmotiv dargestellt?
Die Arbeit analysiert das Liebesmotiv in seinen verschiedenen Ausprägungen und sein komplexes Zusammenspiel mit dem Todestrieb. Dabei wird auch die Rolle von Novalis' Nachtmotiv und die Funktion des Zaubertranks untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, vier Hauptteile (Fremde Stimmen in Wagners Werk; Postnatale Prägung Tristans; Begegnung und Entgleitung der Eigenkontrolle; Liebessehnsucht und Todestrieb) und eine abschließende Betrachtung. Jeder Teil behandelt spezifische philosophische und psychologische Aspekte der Liebesgeschichte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Richard Wagner, Tristan und Isolde, Liebe, Tod, Platon, Buddhismus, Schopenhauer, Psychologie, Philosophie, Oper, Liebesmotiv, Todestrieb, Zaubertrank, postnatale Prägung, Geworfenheit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Liebesbeziehung in Wagners "Tristan und Isolde" durch die Beleuchtung der philosophischen und psychologischen Grundlagen zu verstehen und Wagners Neugestaltung der ursprünglichen Geschichte zu analysieren.
Wo finde ich Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel?
Die Arbeit bietet für jedes Kapitel (Einleitung und die vier Hauptteile) eine kurze Zusammenfassung der behandelten Inhalte und Ergebnisse.
- Citation du texte
- Anna Perlina (Auteur), 2004, Erörterung der Liebesbeziehung in Richard Wagners Oper „Tristan und Isolde“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91972