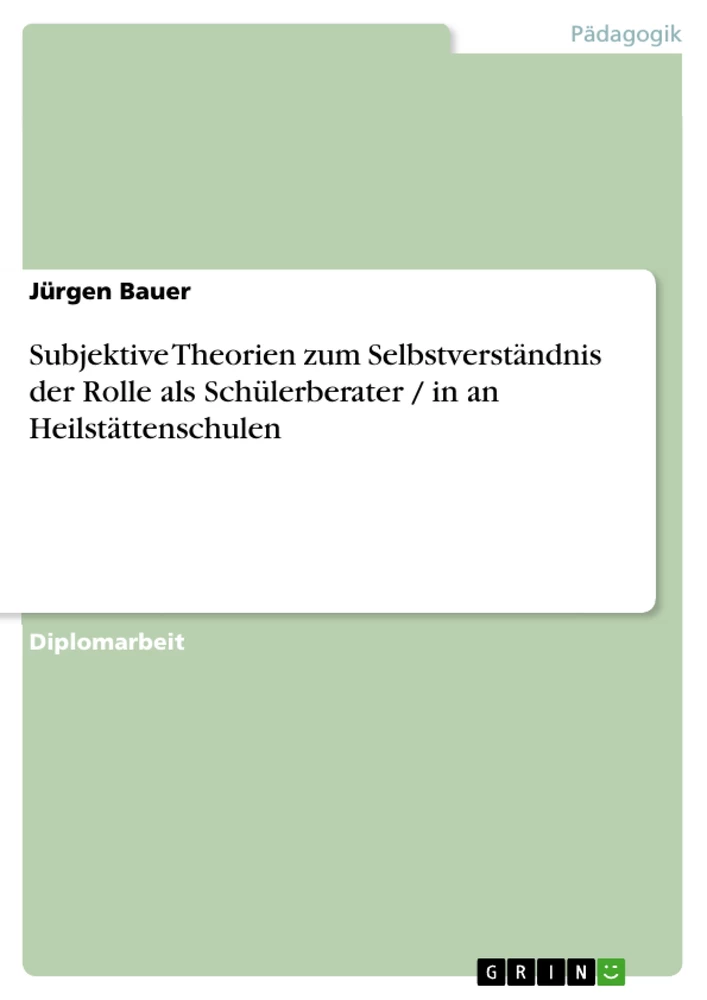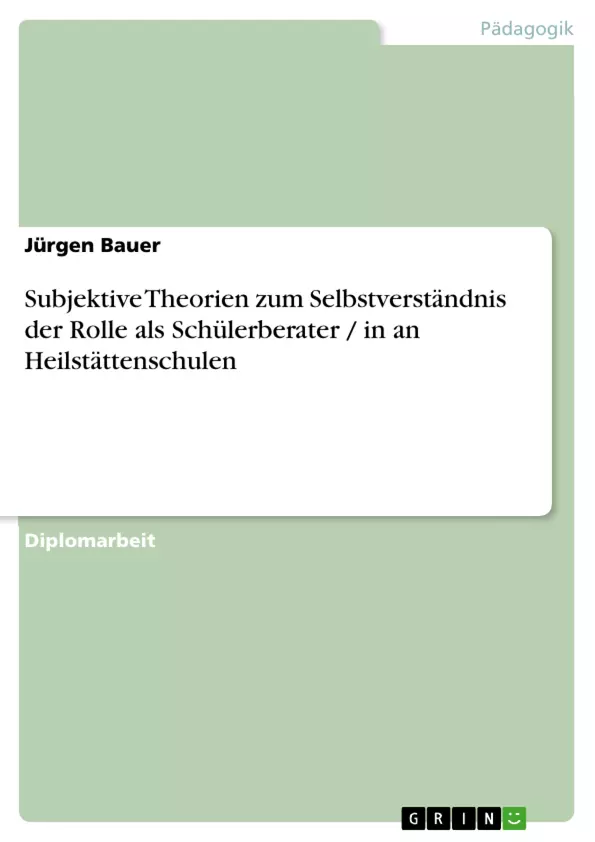In der vorliegenden Untersuchung wird die Rolle der SchülerberaterInnen an Heilstättenschulen unter Verwendung des Dialog-Konsens-Verfahrens nach dem Forschungsprogramm "Subjektive Theorien" mit Hilfe der Subjektiven Theorien von SchülerberaterInnen an Heilstätten- und Klinikschulen untersucht. Die Ideen und Bilder, die die Untersuchungspersonen über ihre Tätigkeiten im Kopf haben, werden mit Hilfe der Struktur-Lege-Methode visualisiert und im Anschluss kodiert, ausgewertet und interpretiert. Als Basis dient ein Telefoninterview, das die vier Teilkonstrukte "Förderliche/hemmende Aspekte in der Schülerberatung", "Schullaufbahnberatung", "Abgrenzung der Beratung / Grenzziehung zwischen Beratung und Therapie (Rollenkonflikt)" und "Koordination der einzelnen Berufsgruppen und deren Funktion im Hinblick auf fließende Kommunikation" untersucht. Die Subjektiven Theorien werden aufgrund der geringen Zahl der SchülerberaterInnen an Heilstättenschulen in Österreich mit Hilfe von zwei SchülerberaterInnen an österreichischen Heilstättenschulen und zwei SchülerberaterInnen an Klinikschulen im süddeutschen Raum erfasst. Die Ergebnisse zeigen, dass die Schülerberatung an diesem so speziellen Schultyp als notwendig erachtet wird und in der täglichen Arbeit mit den erkrankten Kindern und Jugendlichen ihre Relevanz hat. Die SchülerberaterInnen nehmen klar dazu Stellung, dass sie sich nicht als Konkurrenz zu den TherapeutInnen sehen und auch nicht als solche wahrgenommen werden. Weiters gelingt es ihnen, förderliche und hemmende Aspekte der Schülerberatung an Heilstättenschulen klar zu benennen und die sich daraus entwickelnden kontrastierenden Handlungstypen klar zu unterscheiden. Die Wichtigkeit der Schullaufbahnberatung, als Teilaspekt der Schülerberatung, wird ebenso klar aufgezeigt und anhand von Beispielen belegt. Somit zeigt sich, dass mit Hilfe der Subjektiven Theorien die Rolle der SchülerberaterInnen an Heilstättenschulen nicht nur erstmalig aufgezeigt, sondern gestärkt werden kann. Die Funktion der SchülerberaterInnen an diesem Schultyp wird als positiv und notwendig erachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Dank
- Vorwort
- Zusammenfassung
- 1 Fragestellung
- 2 Schultyp Heilstättenschule
- 2.1 Stellenwert der Heilstättenschule innerhalb der Heilpädagogik
- 2.2 Allgemeine Hinführung
- 2.3 Definition
- 2.4 Konzepte der Heilstättenschule
- 2.4.1 Allgemeines
- 2.4.2 Historischer Hintergrund
- 2.4.3 Gesetzliche Grundlagen
- 2.4.4 Organisation und Unterrichtsformen
- 2.4.5 Aufgaben und Ziele
- 2.4.5.1 Schulischer Aspekt
- 2.4.5.2 Heilpädagogischer Aspekt
- 2.4.6 HeilstättenlehrerInnen-Ausbildung
- 2.4.7 Standorte
- 2.4.8 Interdisziplinäre Zusammenarbeit
- 2.5 Zusammenfassung und Ausblick
- 3 Schülerberatung
- 3.1 Beratung
- 3.1.1 Definition
- 3.1.2 Ziele
- 3.1.3 Beratungskompetenz
- 3.1.4 Beratungsgespräch
- 3.1.5 Pädagogische vs. psychologische Beratung
- 3.1.6 Abgrenzung zur Therapie
- 3.1.7 Praktische Aspekte der Beratung
- 3.1.8 Beratung an Heilstättenschulen
- 3.2 Konzepte der Schülerberatung
- 3.2.1 Grundsatzerlass
- 3.2.2 Aufgaben und Ziele
- 3.2.3 Gesetzliche Grundlagen
- 3.2.4 Organisation
- 3.1 Beratung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die subjektiven Theorien von SchülerberaterInnen an Heilstättenschulen in Österreich und im süddeutschen Raum. Ziel ist es, die Rolle der SchülerberaterInnen an diesem spezifischen Schultyp zu beleuchten und deren Bedeutung im Kontext der Arbeit mit erkrankten Kindern und Jugendlichen zu verstehen. Die Arbeit stützt sich auf das Dialog-Konsens-Verfahren und die Struktur-Lege-Methode zur Erfassung und Analyse der subjektiven Theorien.
- Die Rolle der Schülerberatung an Heilstättenschulen
- Subjektive Theorien von SchülerberaterInnen
- Förderliche und hemmende Aspekte der Schülerberatung
- Abgrenzung zwischen Schülerberatung und Therapie
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit an Heilstättenschulen
Zusammenfassung der Kapitel
2 Schultyp Heilstättenschule: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über Heilstättenschulen, beginnend mit ihrer Stellung innerhalb der Heilpädagogik und ihrer Definition. Es beleuchtet den historischen Hintergrund, die gesetzlichen Grundlagen, die Organisationsstrukturen und Unterrichtsformen. Besonderes Augenmerk liegt auf den Aufgaben und Zielen der Heilstättenschule, sowohl im schulischen als auch im heilpädagogischen Kontext. Die Ausbildung der HeilstättenlehrerInnen, die Standorte der Schulen und die Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit werden ebenfalls detailliert dargestellt. Das Kapitel liefert somit ein fundiertes Verständnis des spezifischen Schultyps und seines Kontextes.
3 Schülerberatung: Dieses Kapitel fokussiert auf das Konzept der Schülerberatung, beginnend mit der Definition des Begriffs Beratung und der Beschreibung seiner Ziele. Es untersucht die Beratungskompetenz, den Ablauf von Beratungsgesprächen und die Abgrenzung zwischen pädagogischer und psychologischer Beratung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Abgrenzung der Schülerberatung von Therapie und der Darstellung praktischer Aspekte der Beratung. Das Kapitel beleuchtet schließlich die Besonderheiten der Schülerberatung an Heilstättenschulen, einschließlich der relevanten Konzepte, Aufgaben, Ziele, gesetzlichen Grundlagen und der Organisation.
Schlüsselwörter
Schülerberatung, Heilstättenschule, Klinikschule, Subjektive Theorien, Dialog-Konsens-Verfahren, Struktur-Lege-Methode, Heilpädagogik, Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Schullaufbahnberatung, Rollenkonflikt.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Schülerberatung an Heilstättenschulen
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Diese Masterarbeit untersucht die subjektiven Theorien von SchülerberaterInnen an Heilstättenschulen in Österreich und im süddeutschen Raum. Das Ziel ist es, die Rolle der SchülerberaterInnen an diesem spezifischen Schultyp zu beleuchten und deren Bedeutung im Kontext der Arbeit mit erkrankten Kindern und Jugendlichen zu verstehen. Die Arbeit stützt sich auf das Dialog-Konsens-Verfahren und die Struktur-Lege-Methode zur Erfassung und Analyse der subjektiven Theorien.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Die Rolle der Schülerberatung an Heilstättenschulen; Subjektive Theorien von SchülerberaterInnen; Förderliche und hemmende Aspekte der Schülerberatung; Abgrenzung zwischen Schülerberatung und Therapie; Interdisziplinäre Zusammenarbeit an Heilstättenschulen. Darüber hinaus bietet sie einen umfassenden Überblick über Heilstättenschulen selbst, inklusive ihrer Geschichte, rechtlichen Grundlagen, Organisationsstrukturen und des pädagogischen Ansatzes.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel. Ein Kapitel widmet sich umfassend dem Schultyp "Heilstättenschule", einschließlich ihrer Stellung in der Heilpädagogik, ihrer Geschichte, rechtlichen Grundlagen, Organisation und den Zielen schulischer und heilpädagogischer Arbeit. Ein weiteres Kapitel konzentriert sich auf die Schülerberatung, ihre Definition, Ziele, die Beratungskompetenz, den Ablauf von Beratungsgesprächen und die Abgrenzung zur Therapie. Besonderes Augenmerk liegt auf den Besonderheiten der Schülerberatung im Kontext von Heilstättenschulen.
Welche Methoden wurden angewendet?
Zur Erfassung und Analyse der subjektiven Theorien der SchülerberaterInnen wurden das Dialog-Konsens-Verfahren und die Struktur-Lege-Methode verwendet.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Schülerberatung, Heilstättenschule, Klinikschule, Subjektive Theorien, Dialog-Konsens-Verfahren, Struktur-Lege-Methode, Heilpädagogik, Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Schullaufbahnberatung, Rollenkonflikt.
Welche Informationen bietet die Arbeit über Heilstättenschulen?
Das Kapitel über Heilstättenschulen bietet einen umfassenden Überblick über diesen Schultyp, einschließlich seiner Definition, seines historischen Hintergrunds, der gesetzlichen Grundlagen, der Organisationsstrukturen, der Unterrichtsformen, der Aufgaben und Ziele (sowohl schulisch als auch heilpädagogisch), der Ausbildung der Lehrkräfte, der Standorte der Schulen und der Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit.
Welche Aspekte der Schülerberatung werden detailliert behandelt?
Das Kapitel zur Schülerberatung behandelt detailliert die Definition von Beratung, ihre Ziele, die Beratungskompetenz, den Ablauf von Beratungsgesprächen, die Abgrenzung zwischen pädagogischer und psychologischer Beratung sowie die Abgrenzung zur Therapie. Praktische Aspekte der Beratung und die Besonderheiten der Schülerberatung an Heilstättenschulen werden ebenfalls beleuchtet.
- Citar trabajo
- MA Jürgen Bauer (Autor), 2008, Subjektive Theorien zum Selbstverständnis der Rolle als Schülerberater / in an Heilstättenschulen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91985