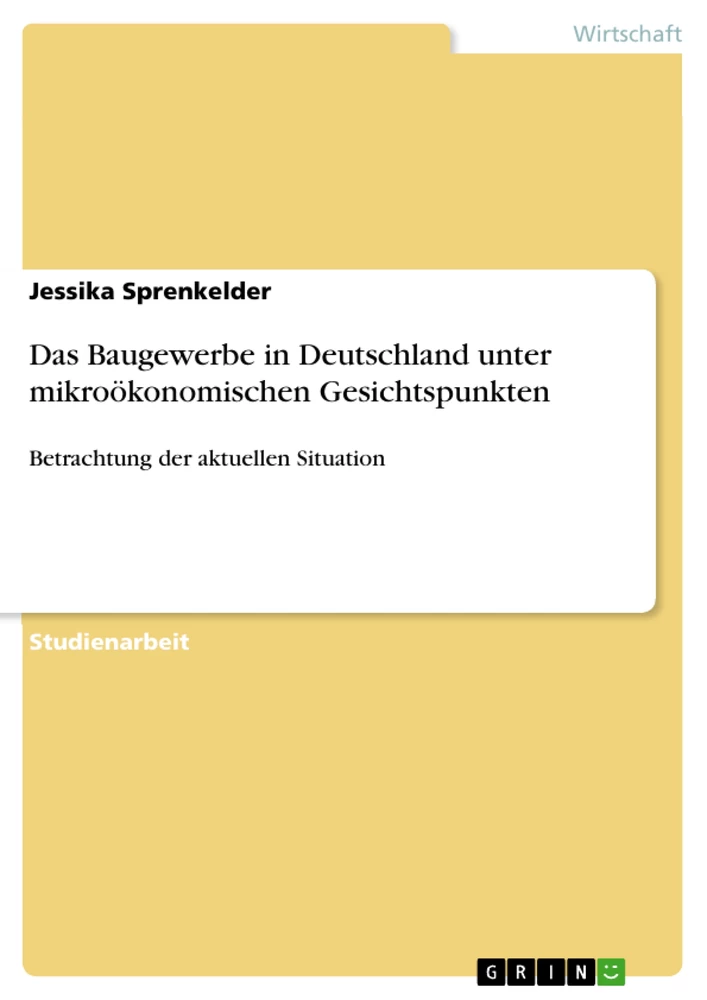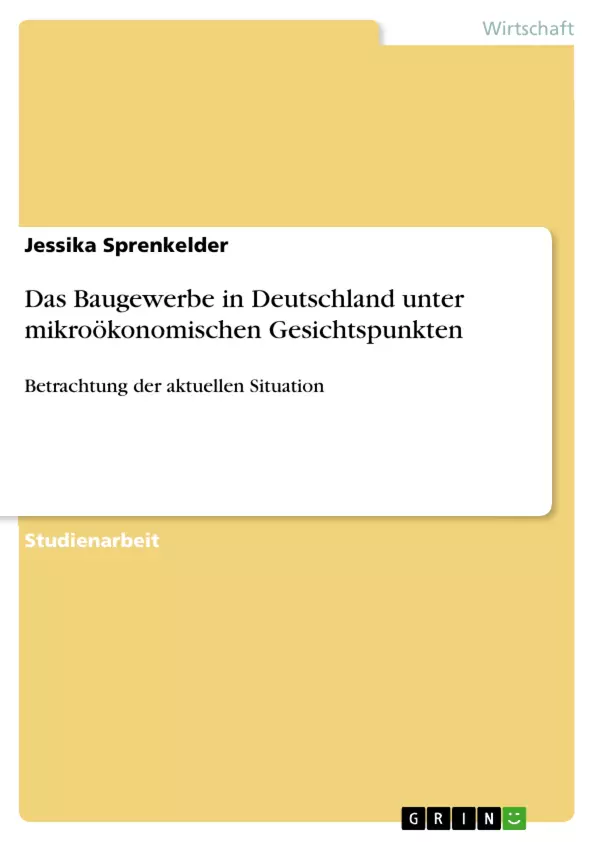Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Baugewerbe in Deutschland. Hierbei wird diese Branche einer mikroökonomischen Analyse unterzogen, welche die Marktstruktur, die Angebots- und Nachfragefunktionen sowie die Elastizitäten umfasst. Weitergehend werden Wettbewerbsstrategien der Unternehmen und Effekte von Steuern auf das Baugewerbe genauer beleuchtet. Zuletzt wird der Einfluss der aktuellen Corona-Pandemie auf das Baugewerbe untersucht und ein Ausblick auf die zu erwartenden zukünftigen Entwicklungen gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Baugewerbe in Deutschland
- Struktur des Baugewerbes
- Volumen des Baugewerbes
- Mikroökonomische Analyse des Baugewerbes
- Marktstruktur des Baugewerbes
- Angebot und Nachfrage
- Elastizitäten
- Wettbewerbsstrategien der Unternehmen
- Effekt von Steuern
- Aktuelle Pandemie
- Einfluss auf die Wirtschaft
- Zu erwartende Folgen für das Baugewerbe
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Stellung des Baugewerbes in Deutschland aus mikroökonomischer Perspektive. Ziel ist es, anhand der Analyse der Marktstruktur, des Angebots und der Nachfrage sowie der Elastizitäten, Wettbewerbsstrategien und Steuereffekte, Schlüsse über die gegenwärtige Situation und zukünftige Entwicklung des Baugewerbes zu ziehen.
- Struktur und Volumen des Baugewerbes in Deutschland
- Mikroökonomische Analyse des Baugewerbes unter Berücksichtigung von Marktstruktur, Angebot und Nachfrage
- Elastizitäten, Wettbewerbsstrategien und Steuereffekte im Baugewerbe
- Einfluss der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft und das Baugewerbe
- Prognose der zukünftigen Entwicklung des Baugewerbes
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Hausarbeit stellt das Thema des Baugewerbes in Deutschland vor und skizziert die Zielsetzung der Analyse.
- Das Baugewerbe in Deutschland: Dieses Kapitel bietet einen Einblick in die grundlegende Struktur und das Volumen des Baugewerbes in Deutschland.
- Mikroökonomische Analyse des Baugewerbes: Dieses Kapitel untersucht das Baugewerbe aus mikroökonomischer Sicht, analysiert die Marktstruktur, das Angebot und die Nachfrage sowie die daraus resultierenden Elastizitäten. Es betrachtet auch Wettbewerbsstrategien von Unternehmen und die Auswirkungen von Steuern auf die Branche.
- Aktuelle Pandemie: Dieses Kapitel beleuchtet die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft im Allgemeinen und das Baugewerbe im Besonderen. Es werden die zu erwartenden Folgen für die Branche betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit konzentriert sich auf die Analyse des Baugewerbes in Deutschland aus mikroökonomischer Sicht. Schlüsselwörter sind daher: Baugewerbe, Mikroökonomik, Marktstruktur, Angebot und Nachfrage, Elastizitäten, Wettbewerbsstrategien, Steuereffekte, Corona-Pandemie, Wirtschaft, Prognose.
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Baugewerbe in Deutschland strukturiert?
Das Baugewerbe ist stark mittelständisch geprägt, mit einer Vielzahl kleiner und mittlerer Unternehmen sowie einigen wenigen Großkonzernen. Es wird zwischen dem Bauhauptgewerbe und dem Ausbaugewerbe unterschieden.
Welchen Einfluss hat die Corona-Pandemie auf den Bau?
Trotz allgemeiner Wirtschaftskrise erwies sich das Baugewerbe als robust, kämpfte jedoch mit unterbrochenen Lieferketten, Materialknappheit und steigenden Preisen für Baustoffe.
Was sind mikroökonomische Kennzahlen der Baubranche?
Wichtige Aspekte sind die Angebots- und Nachfragefunktionen, die Preiselastizität der Nachfrage sowie die Wettbewerbsstrategien zur Differenzierung im Markt.
Wie wirken sich Steuern auf das Baugewerbe aus?
Steuern wie die Grunderwerbsteuer oder steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten (AfA) beeinflussen massiv die Nachfrage nach Neubauten und Sanierungen.
Wie sieht die Zukunftsprognose für das Baugewerbe aus?
Die Nachfrage nach Wohnraum bleibt hoch, jedoch stellen steigende Zinsen, Fachkräftemangel und energetische Sanierungsauflagen die Branche vor große Herausforderungen.
- Citar trabajo
- Jessika Sprenkelder (Autor), 2020, Das Baugewerbe in Deutschland unter mikroökonomischen Gesichtspunkten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/920194