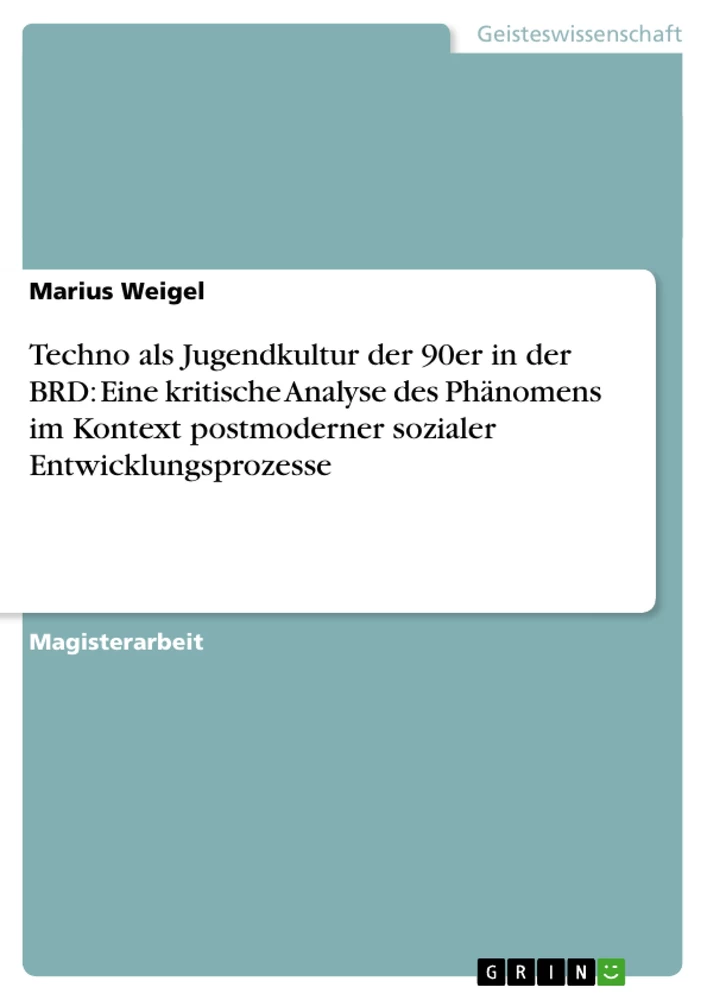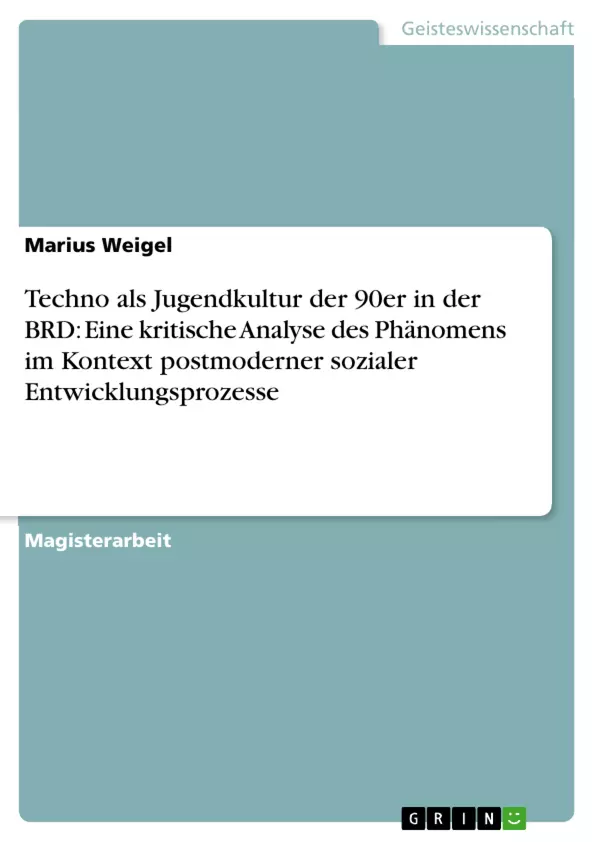"Anything goes: Am reichhaltigen Büffet der pluralistischen Gesellschaft bedient sich die Jugend 2000 mit selbstbewußtem Pragmatismus. (...) Nie waren die Optionen so vielfältig, und nie sampelte eine Generation daraus derart heterogene Lebensentwürfe. Die Teens und Twens nach Null-Bock-Kids, Generation X, Y und @ verweigern sich einem eindeutigen Label." (Esser/ Holzer, 2000, 64/65)
In diesen Worten etikettieren die Autoren des Artikels "Jugend 2000: Das Geheimnis der ´Generation Flex´" im Focus vom 20. März 2000 die "Jugend 2000". Schlagwörter wie "anything goes", "pluralistische Gesellschaft" und "heterogene Lebensentwürfe" umreißen den Interpretationsrahmen, in dem die "Jugend 2000" charakterisiert wird. Auch die aktuelle Shell-Jugendstudie, die von dem Frankfurter Sozialwissenschaftler Arthur Fischer miterstellt wurde, beschäftigt sich mit der Jugend-Generation im Jahr 2000. Als zentrales Ergebnis wird festgehalten, daß die "Generation 2000" leicht optimistisch und leistungsbereit eingestellt sei.
In den Neunziger Jahren konzentrierten sich Teile der bundesdeutschen sozialwissenschaftlichen Jugendforschung vor allem auf einen sozialen Entwicklungsprozeß, der als Individualisierung begriffen wurde. Der Kultursoziologie Gerhard Schulze vertritt in seinen Arbeiten die These, das sich die Formen sozialer Aggregation geändert haben. Die Jugend der Neunziger zeichne sich durch eine "Ästhetisierung des Alltagslebens" aus, ferner sei die freiwillige Teilnahme an kollektiven Engagements ein Charakteristikum individualisierter Gesellschaften. Jugendliche in den Neunziger Jahren präferierten informale Gruppen, in denen sich eine spezifische kulturelle Praxis manifestiere, die sich vornehmlich aus Elementen wie bspw. Unterhaltung, Spaß, Umgang mit Gleichgesinnten ohne längerfristige Bindungen zusammensetze.
Im Zuge dieser angedeuteten Entwicklungen gewann eine Jugendkultur an Bedeutung, die unter dem Namen "Techno" subsumiert wird. Die Bedeutung dieser kulturellen Aggregation manifestiert sich v.a. für die bundesdeutsche Öffentlichkeit an der offiziell als Demonstration angemeldeten sog. "Love Parade", die seit 1989 jährlich in Berlin stattfindet. Die Besucherzahlen in den Jahren 1997 und 1998 mit ca. einer Million Teilnehmern verdeutlichen die Dimension dieser jugendkulturellen Praxis.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Thema der Arbeit
- 1.2. Stand der Forschung
- 1.3. Hauptthese und Zielsetzung
- 1.4. Eigene Motivation und Position
- 1.5. Methodisches Vorgehen
- 2. Postmoderne Entwicklungsprozesse und Thesen Jean Baudrillards als Beispiel für eine postmoderne soziologische Theorie
- 2.1. Zur Geschichte des Begriffs „Postmoderne“
- 2.2. Zur Differenzierung des Begriffs „Postmoderne“
- 2.3. Zentrale postmoderne Entwicklungsprozesse
- 2.3.1. Pluralität
- 2.3.2. Pastiche
- 2.3.3. Mehrfachkodierung
- 2.3.4. Fragmentierung
- 2.3.5. Anti-Heroismus
- 2.3.6. Recycling
- 2.4. Baudrillard - Drei Fragmente einer postmodernen soziologischen Theorie
- 2.4.1. Das Theorem der Simulation
- 2.4.2. Die drei Simulakren
- 2.4.3. Das Modell der Ekstase
- 2.5. Exkurs: Zum Verhältnis der Soziologie zur Postmoderne
- 3. Techno
- 3.1. Das Phänomen „Techno“
- 3.2. Zur Differenzierung des Begriffs „Techno“
- 3.3. Historische Rekonstruktion von „Techno“
- 3.3.1. Elektronische Musik
- 3.3.2. Elektronische Musik in den USA
- 3.3.2.1. Disco
- 3.3.2.2. Chicago - House
- 3.3.2.3. Detroit - Techno
- 3.3.3. Elektronische Musik in Großbritannien
- 3.3.4. Elektronische Musik in Deutschland
- 3.4. Produktion und Rezeption von „Techno“
- 3.4.1. Produktion
- 3.4.1.1. Der Produzent der „Techno“-Musik
- 3.4.1.2. Zur Funktion des DJs
- 3.4.2. Rezeption
- 3.4.2.1. Clubs und Clubkultur
- 3.4.2.2. Raves und Rave-Kultur
- 3.5. Zentrale Elemente von Techno
- 3.5.1. Musik: Struktur und Funktion der Techno-Musik
- 3.5.2. Tanz: Zur Funktion des Tanzes
- 3.5.3. Drogen: Zur Funktion des Konsums von „Ecstasy“
- 4. Techno als Jugendkultur?
- 4.1. Zur Differenzierung des Begriffs „Jugend“
- 4.2. Kritik der Konzepte Jugend- und Subkultur
- 4.3. Techno als „Szene“ und postmoderne informelle Gruppe von Jugendlichen
- 5. Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit analysiert die Techno-Kultur der 1990er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland im Kontext postmodernen gesellschaftlichen Wandels. Ziel ist es, das Phänomen „Techno“ zu untersuchen und seine Bedeutung als Jugendkultur im Lichte postmoderner Theorien zu hinterfragen.
- Techno als Jugendkulturphänomen der 90er Jahre
- Die Anwendbarkeit des traditionellen Jugendkulturbegriffs auf Techno
- Postmoderne Entwicklungsprozesse und ihre Relevanz für die Techno-Kultur
- Analyse der Produktion und Rezeption von Techno-Musik
- Jean Baudrillards Theorien als analytisches Werkzeug
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Thema der Arbeit, den Stand der Forschung, die Hauptthese, die Motivation und das methodische Vorgehen. Sie stellt die „Techno“-Kultur als ein Massenphänomen vor, das im Kontext der Individualisierungsprozesse der 1990er Jahre und der postmodernen Gesellschaft zu analysieren ist. Die Arbeit fokussiert sich auf die Entwicklung in der BRD, insbesondere Berlin, aber bezieht auch die Vorläufer in den USA (Disco, House, Detroit Techno) ein. Die Arbeit untersucht die Produktion (Produzenten, DJs) und Rezeption (Clubs, Raves) von Techno, einschließlich zentraler Praktiken wie Tanz und Drogenkonsum.
2. Postmoderne Entwicklungsprozesse und Thesen Jean Baudrillards: Dieses Kapitel untersucht den Begriff „Postmoderne“ und differenziert ihn im soziologischen Diskurs. Es identifiziert zentrale postmoderne Entwicklungsprozesse wie Pluralität, Pastiche, Mehrfachkodierung, Fragmentierung, Anti-Heroismus und Recycling. Im Anschluss werden drei Thesen Jean Baudrillards (Simulation, Simulakren, Ekstase) dargestellt, die als analytische Werkzeuge für die Untersuchung der Techno-Kultur dienen. Das Kapitel schließt mit einem Exkurs zum Verhältnis der Soziologie zur Postmoderne.
3. Techno: Kapitel 3 analysiert das Phänomen „Techno“ umfassend. Es untersucht die historische Entwicklung elektronischer Musik von den Vorläufern in den USA bis zur Entwicklung in Deutschland. Die Analyse der Produktion konzentriert sich auf die Rolle der Produzenten und DJs, während die Rezeption im Kontext von Clubs, Raves, Veranstaltungen wie der „Love Parade“ und „Mayday“ betrachtet wird. Zentrale Elemente wie die Musikstruktur, die Funktion des Tanzes und der Konsum von Ecstasy werden eingehend untersucht, um den kulturellen und sozialen Kontext der Techno-Szene umfassend darzulegen.
4. Techno als Jugendkultur?: Dieses Kapitel hinterfragt die Gleichsetzung von „Techno“ mit dem Begriff „Jugendkultur“. Es diskutiert die Anwendbarkeit des traditionellen Jugendkulturbegriffs auf Techno und analysiert die Techno-Szene als eine postmoderne, informelle Gruppe von Jugendlichen. Die Kapitel thematisiert kritisch die Konzepte „Jugend“ und „Subkultur“ im Kontext der Techno-Kultur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Techno-Kultur der 1990er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit analysiert die Techno-Kultur der 1990er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere in Berlin, im Kontext postmodernen gesellschaftlichen Wandels. Sie untersucht das Phänomen „Techno“ und hinterfragt dessen Bedeutung als Jugendkultur im Lichte postmoderner Theorien.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit Techno als Jugendkulturphänomen der 90er Jahre, der Anwendbarkeit des traditionellen Jugendkulturbegriffs auf Techno, postmodernen Entwicklungsprozessen und deren Relevanz für die Techno-Kultur, der Analyse der Produktion und Rezeption von Techno-Musik sowie der Anwendung von Jean Baudrillards Theorien als analytisches Werkzeug.
Welche Theorien werden angewendet?
Die Arbeit nutzt die Theorien von Jean Baudrillard, insbesondere dessen Konzepte von Simulation, Simulakren und Ekstase, um die Techno-Kultur zu analysieren. Der Begriff „Postmoderne“ wird im soziologischen Diskurs differenziert, wobei zentrale postmoderne Entwicklungsprozesse wie Pluralität, Pastiche, Mehrfachkodierung, Fragmentierung, Anti-Heroismus und Recycling identifiziert werden.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zu postmodernen Entwicklungsprozessen und Baudrillards Theorien, ein Kapitel zur umfassenden Analyse von Techno (inklusive historischer Entwicklung, Produktion und Rezeption), ein Kapitel zur kritischen Auseinandersetzung mit Techno als Jugendkultur und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird in Unterkapitel detailliert untergliedert.
Was wird unter „Techno“ verstanden und wie wird es analysiert?
Die Arbeit differenziert den Begriff „Techno“ und rekonstruiert dessen historische Entwicklung von den Vorläufern in den USA (Disco, House, Detroit Techno) bis zur Entwicklung in Deutschland. Die Analyse umfasst die Produktion (Produzenten, DJs), die Rezeption (Clubs, Raves, Love Parade, Mayday) und zentrale Elemente wie Musikstruktur, Tanz und Drogenkonsum (Ecstasy).
Wie wird der Begriff „Jugendkultur“ behandelt?
Die Arbeit hinterfragt kritisch die Gleichsetzung von „Techno“ mit dem Begriff „Jugendkultur“. Sie diskutiert die Anwendbarkeit des traditionellen Jugendkulturbegriffs und analysiert die Techno-Szene als eine postmoderne, informelle Gruppe von Jugendlichen. Die Konzepte „Jugend“ und „Subkultur“ werden im Kontext der Techno-Kultur kritisch thematisiert.
Welche methodischen Vorgehensweisen werden verwendet?
Die Einleitung beschreibt das methodische Vorgehen der Arbeit. Die genaue Methodik wird im Detail im Text erläutert.
Welche Quellen werden verwendet?
Die genauen Quellenangaben sind im Text der Magisterarbeit zu finden.
- Citation du texte
- Marius Weigel (Auteur), 2000, Techno als Jugendkultur der 90er in der BRD: Eine kritische Analyse des Phänomens im Kontext postmoderner sozialer Entwicklungsprozesse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9202