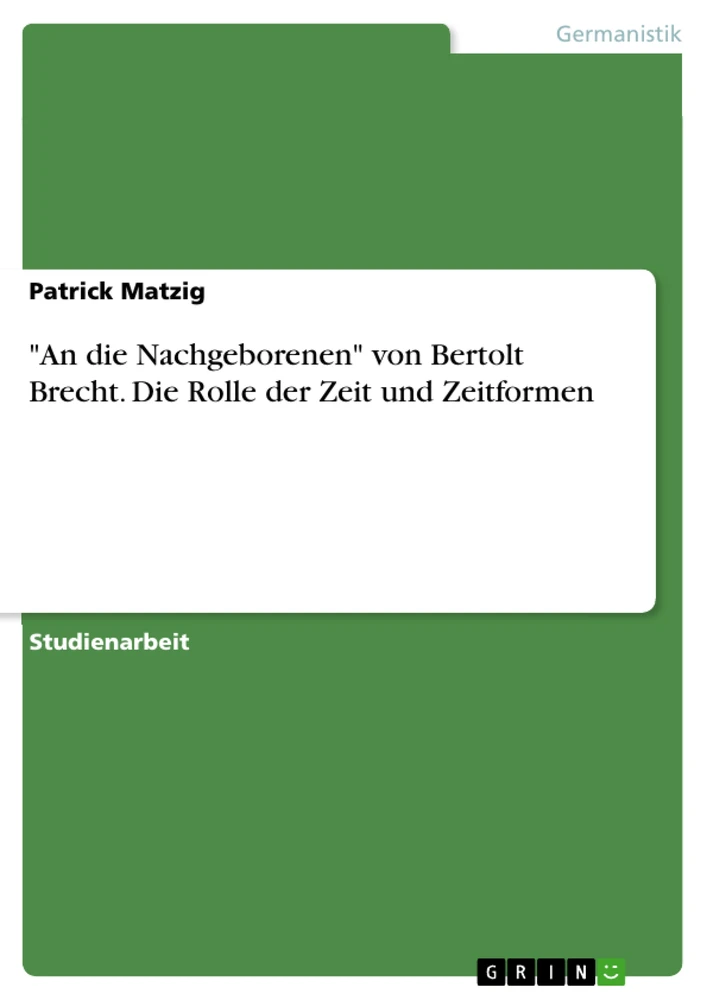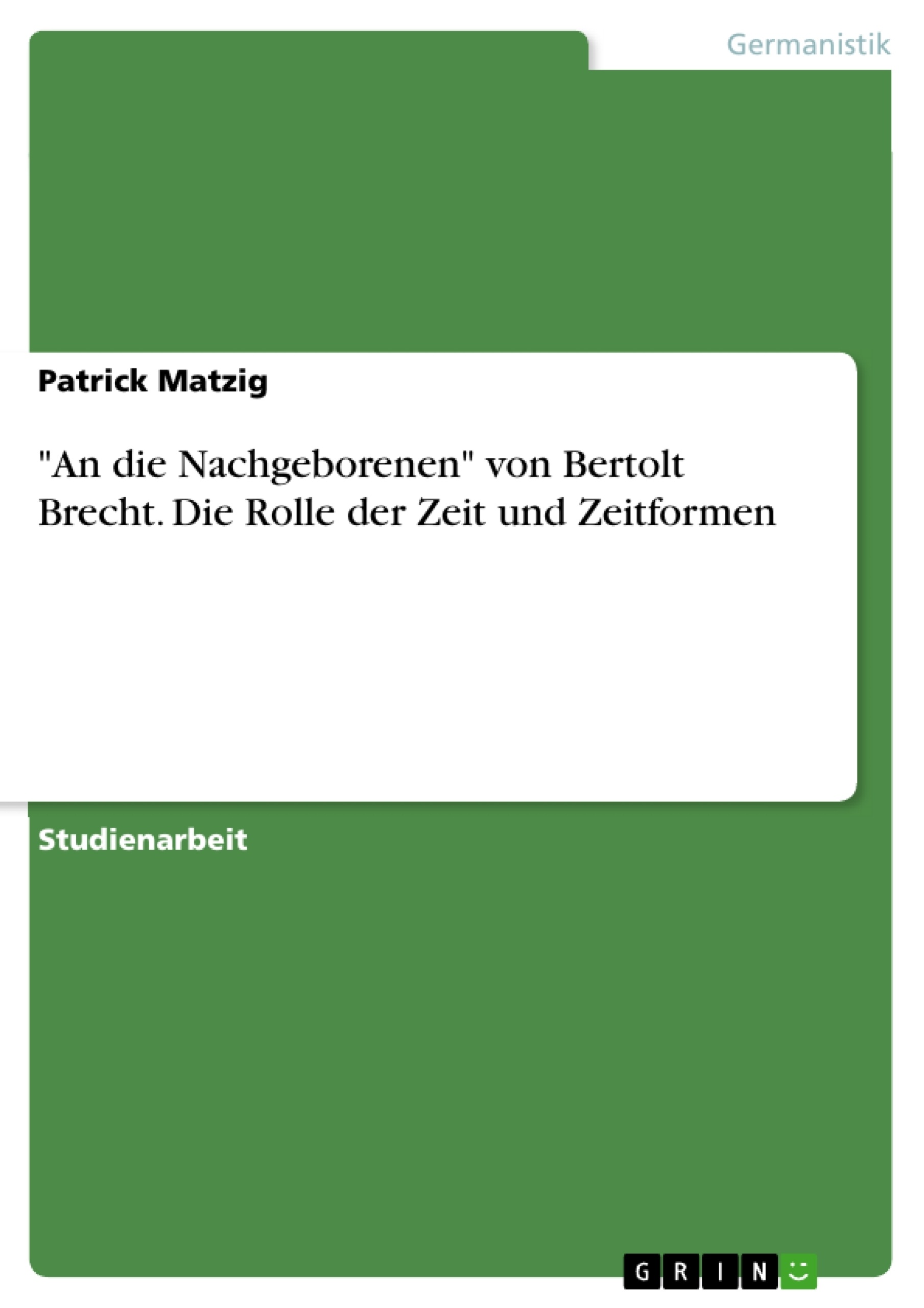Diese Arbeit befasst sich mit der Form, dem Aufbau, der Analyse und Deutung von Bertolt Brechts "An die Nachgeborenen". Ziel der Arbeit ist die Deutung des Gedichts mit Hinblick auf die Intensität seines Appells. Die Grundlage für diese Auseinandersetzung ist die erste Auflage der großen kommentierten Berliner und Frankfurter Ausgabe, welche gemeinsam von dem Suhrkamp Verlag aus Frankfurt am Main und Berlin im Jahr 1988 herausgegeben wurde.
Der 12 Band dieser Ausgabe beinhaltet den Svendborger Gedichtzyklus, welcher im Original mit dem Gedicht „An die Nachgeborenen“ endet. Arbeitend in einem umgebauten Pferdestall schrieb Bertolt Brecht in den Jahren 1933-1938 dort seine wichtigsten Werke, darunter auch jenen Zyklus.
Das Gedicht weist damalige zeitgenössische Themen wie den Kampf im Widerstand gegen den Nationalsozialismus, Existenzangst und über das Leben im Exil auf. Es ist eines der bekanntesten Gedichte Bertolt Brechts und gilt als sein größtes Vermächtnis.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. TEXTANALYSE
- 2.1. FORM UND AUFBAU
- 2.2. ANALYSE UND DEUTUNG
- 2.3. DIE ROLLE DER ZEIT UND DER ZEITFORMEN
- 2.4. NATURLYRIK ALS VERMEINTLICHES VERBRECHEN
- 2.5. DIE WIRKUNG DES APPELLS
- 3. ERGEBNIS DER TEXTANALYSE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Textanalyse befasst sich mit Bertolt Brechts Gedicht „An die Nachgeborenen“ und zielt darauf ab, die Analyse und Deutung des Gedichts zu untersuchen. Ziel ist es, die Intensität von Brechts Appell zu ergründen und zu verstehen, warum er eine solche Wirkung erzielt.
- Form und Aufbau des Gedichts
- Analyse der Sprache und der Bedeutung des Gedichts
- Die Rolle der Zeit und der Zeitformen in der Gestaltung des Gedichts
- Die Kritik an Naturlyrik als vermeintliches Verbrechen
- Die Wirkung und Bedeutung von Brechts Appell an die Nachgeborenen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Gedicht „An die Nachgeborenen“ von Bertolt Brecht vor und erläutert die Motivation der Autorin für die Analyse. Die Analyse des Gedichts betrachtet zunächst die Form und den Aufbau des Gedichts, wobei die Verwendung von freien Rhythmen, die Verslängen und Enjambements beleuchtet werden. Anschließend wird eine detaillierte Analyse der Sprache und Bedeutung des Gedichts durchgeführt, wobei insbesondere auf die Themen der finsteren Zeit, der gesellschaftlichen Verhältnisse und der Rolle der Natur eingegangen wird.
Schlüsselwörter
Bertolt Brecht, „An die Nachgeborenen“, Textanalyse, Form und Aufbau, Analyse und Deutung, Zeitformen, Naturlyrik, Appell, Widerstand, Nationalsozialismus, Existenzangst, Exil.
- Quote paper
- Patrick Matzig (Author), 2018, "An die Nachgeborenen" von Bertolt Brecht. Die Rolle der Zeit und Zeitformen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/920339