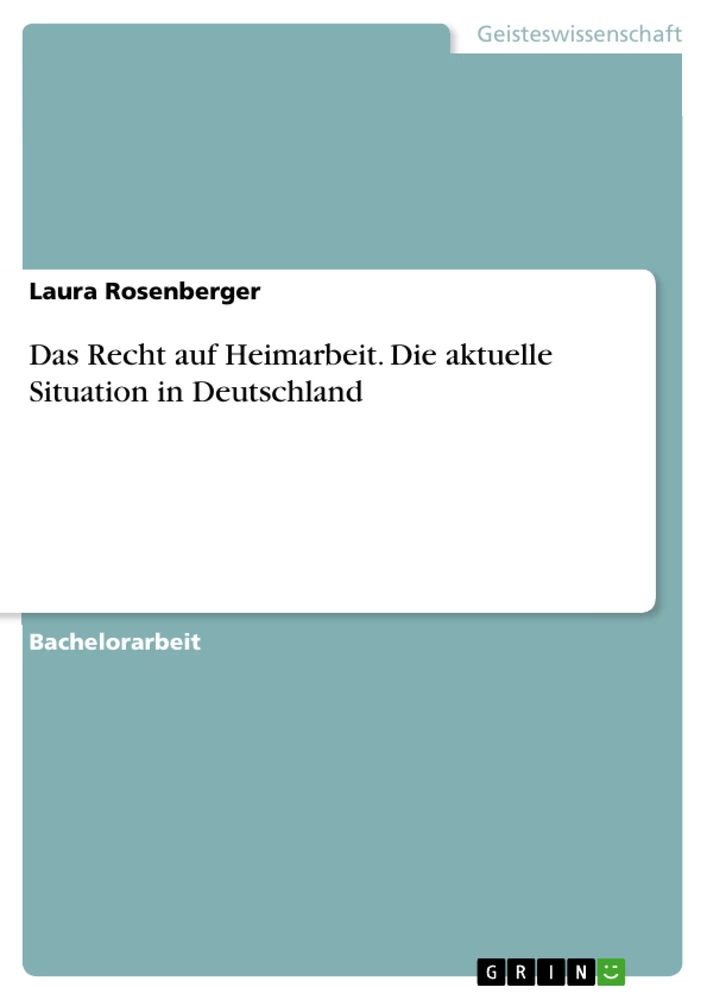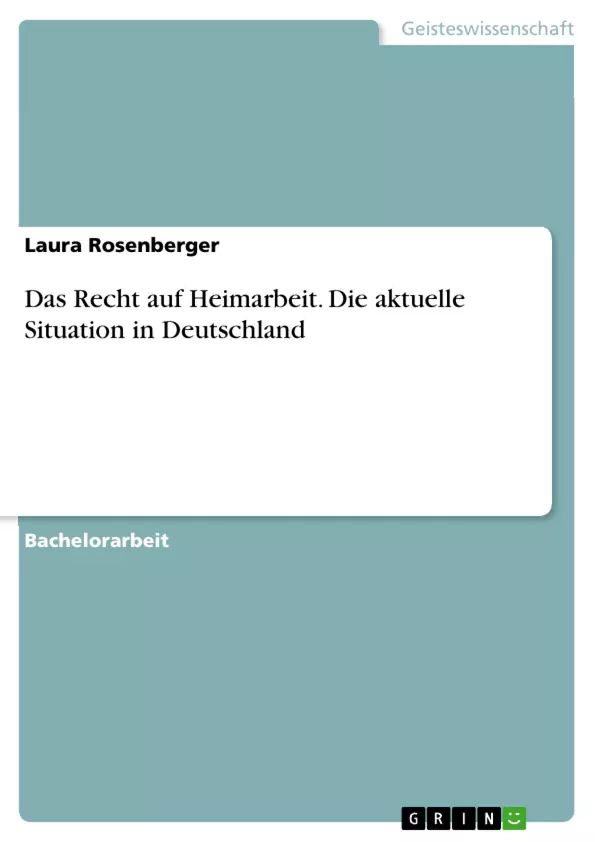Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Frage, ob wir in Deutschland ein gesetzliches Recht auf Heimarbeit brauchen. Das Ziel ist es, die Veränderungen aufzuzeigen, welche die Megatrends in Bezug auf die Arbeitswelt nach sich ziehen, die aktuelle Bedarfssituation der Beschäftigten durch eine gezielte Umfrage festzustellen und zu analysieren und letztlich die Frage dieser Arbeit zu beantworten. Dazu findet zunächst eine Einordnung der aktuellen gesellschaftlichen, digitalen, politischen und rechtlichen Entwicklungen zum Thema Heimarbeit statt. Es folgt eine Klärung der aktuellen Bedarfssituation bei Beschäftigten und eine Gesamtinterpretation der Ergebnisse.
Im ersten Teil wird die Problemstellung geschildert sowie die Fragestellung er-läutert. Der zweite Teil widmet sich der theoretischen Klärung der verwendeten Fachbegriffe. Zudem werden die gesetzlichen Grundlagen in Deutschland zu diesem Thema erläutert. Auch die Begrifflichkeiten der Megatrends werden genauer definiert und abschließend werden Thesen entworfen, die in dieser Arbeit überprüft werden sollen. Darauf aufbauend wird im dritten Teil eine Umfrage entworfen und deren Design sowie die Methode zur Datenauswertung dargestellt. Der vierte Teil fokussiert sich auf die Ergebnisse dieser Umfrage. Diese werden in Bezug auf die Fragestellung und in Bezug auf weitere Interpretationen untersucht. Im fünften und letzten Teil dieser Arbeit werden die Ergebnisse in einer Gesamtinterpretation betrachtet und kritische Punkte werden diskutiert. Abschließend gibt die Arbeit einen kurzen Ausblick auf mögliche Handlungsbedarfe in Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
- Fragestellung
- Herleiten der Fragestellung und Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Herleitung und Anwendung der Methode Umfrage
- Theoretische Fundierung zum Begriff „Heimarbeit“
- Definitionen und Begriffsunterscheidungen Heimarbeit und mobiles Arbeiten
- Definition und Erläuterung der Megatrends und die aktuelle Situation in Deutschland
- Thesen
- Begründung der Methode
- Methode: Umfrage
- Design der Studie
- Durchführung und Datenauswertung
- Ergebnisse der Umfrage
- Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellung
- Weitere Befunde oder Interpretationen
- Diskussion
- Gesamtinterpretation der Ergebnisse
- Bezug auf die in dieser Arbeit aufgestellten Thesen
- Kritische Auseinandersetzung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Heimarbeit und untersucht die aktuelle Situation in Deutschland sowie den Bedarf eines Rechts auf Heimarbeit. Die Arbeit analysiert die theoretischen Grundlagen des Begriffs „Heimarbeit“, beleuchtet die relevanten Megatrends und die aktuelle Situation in Deutschland und stellt auf Basis der Ergebnisse der durchgeführten Umfrage fest, ob ein Recht auf Heimarbeit in Deutschland notwendig ist.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Heimarbeit“
- Einfluss von Megatrends auf die Entwicklung der Heimarbeit
- Analyse der aktuellen Situation der Heimarbeit in Deutschland
- Untersuchung des Bedarfs eines Rechts auf Heimarbeit
- Bewertung der Vor- und Nachteile der Heimarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Problemstellung und Zielsetzung. Es werden die Fragestellung, die Herleitung der Zielsetzung und der Aufbau der Arbeit dargestellt. Zudem wird die Methode der Umfrage eingeführt und ihre Anwendung erläutert. Im zweiten Kapitel erfolgt die theoretische Fundierung des Begriffs „Heimarbeit“. Hier werden Definitionen und Begriffsunterscheidungen zwischen Heimarbeit und mobilem Arbeiten vorgenommen. Die Arbeit beleuchtet auch die Megatrends, die die aktuelle Situation der Heimarbeit in Deutschland prägen. Darüber hinaus werden Thesen zur Bedeutung der Heimarbeit aufgestellt und die Begründung der Methode erläutert. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Methode der Umfrage, wobei das Design der Studie und die Durchführung sowie die Datenauswertung im Fokus stehen. Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse der Umfrage in Bezug auf die Fragestellung und weitere Befunde oder Interpretationen vorgestellt. Im fünften Kapitel erfolgt die Diskussion der Ergebnisse, die Gesamtinterpretation, der Bezug zu den Thesen, eine kritische Auseinandersetzung sowie ein Ausblick.
Schlüsselwörter
Heimarbeit, mobiles Arbeiten, Megatrends, Recht auf Heimarbeit, Umfrage, Deutschland, Arbeitssituation, digitale Arbeitswelt, Flexibilität, Unternehmenskultur.
Häufig gestellte Fragen
Brauchen wir in Deutschland ein gesetzliches Recht auf Heimarbeit?
Diese Frage wird in der Arbeit untersucht, wobei aktuelle Bedarfe der Beschäftigten und Megatrends wie die Digitalisierung analysiert werden.
Was ist der Unterschied zwischen Heimarbeit und mobilem Arbeiten?
Heimarbeit findet primär in der eigenen Wohnung statt, während mobiles Arbeiten ortsunabhängig (z.B. im Zug oder Café) erfolgen kann.
Welche Rolle spielen Megatrends für die Arbeitswelt?
Megatrends wie die digitale Transformation fordern flexiblere Arbeitsmodelle und verändern die Anforderungen an Unternehmenskulturen nachhaltig.
Wie wurde der Bedarf für Heimarbeit ermittelt?
Die Datenerhebung erfolgte durch eine gezielte Umfrage unter Beschäftigten, um deren Wünsche nach Flexibilität und Work-Life-Balance zu erfassen.
Was sind kritische Punkte bei der gesetzlichen Regelung von Heimarbeit?
Diskutiert werden unter anderem die Abgrenzung von Arbeits- und Privatzeit sowie die Gewährleistung des Arbeitsschutzes im häuslichen Umfeld.
- Citar trabajo
- Laura Rosenberger (Autor), 2020, Das Recht auf Heimarbeit. Die aktuelle Situation in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/920492